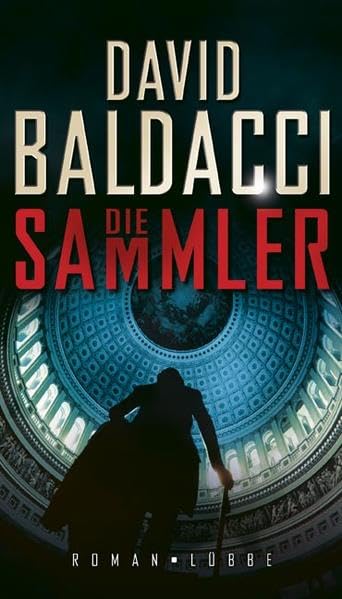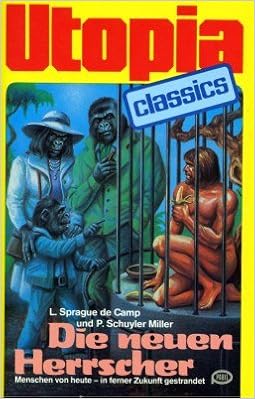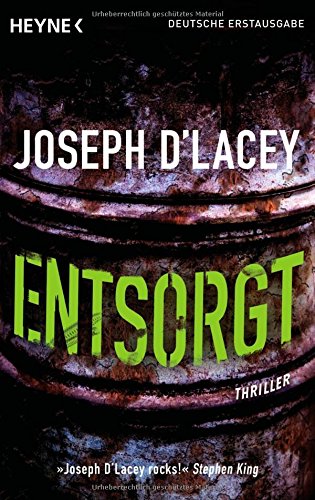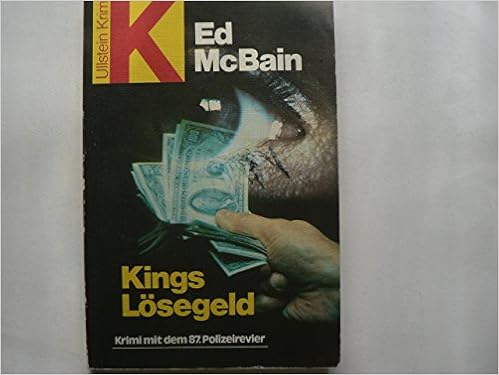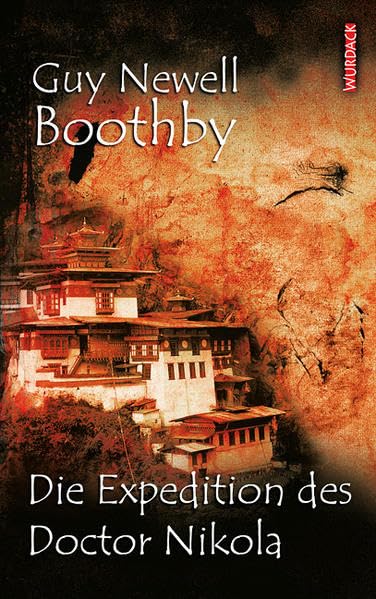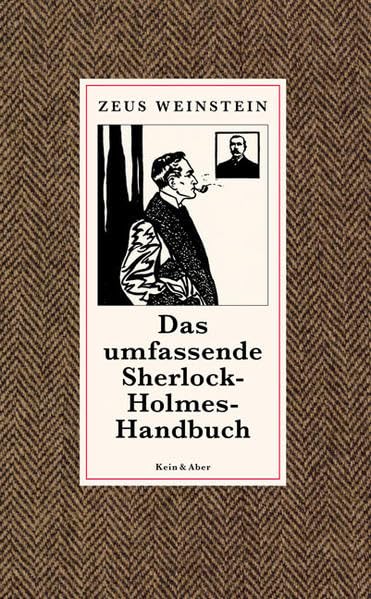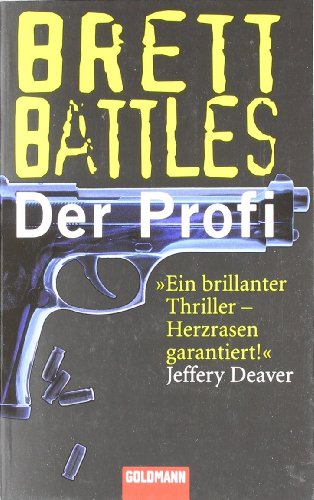Alle Beiträge von Michael Drewniok
Baldacci, David – Sammler, Die
_Das geschieht:_
In Washington D. C., der Hauptstadt der USA, geraten die vier Mitglieder des „Camel Clubs“ in ein neues Abenteuer. Caleb Shaw, der in der Raritätenabteilung der berühmten Kongressbibliothek beschäftigt ist, sieht sich nach dem jähen Tod seines Abteilungsleiters zu dessen Nachlassverwalter bestimmt. Womöglich ist es beim Tod von Jonathan DeHaven nicht mit rechten Dingen zugegangen. Der „Camel Club“ wird plötzlich observiert. Shaws Freund Oliver Stone, einst selbst Top-Agent, identifiziert die Verfolger als Angehörige der CIA.
Doch nicht der Geheimdienst, sondern zwei kriminelle Mitarbeiter stecken hinter der Überwachung: Albert Trent und Roger Seagraves verschaffen sich einen hübschen Nebenverdienst, indem sie Agenten-Identitäten an Schurkenstaaten verkaufen. Die enttarnten US-Spione werden umgebracht, ebenso ergeht es denen, die den beiden Verrätern auf die Schliche zu kommen drohen. DeHaven hatte dieses Pech, und nun will vor allem Seagraves wissen, ob dieser vor seinem Ende den „Camel Club“ informieren konnte. Zwar trifft dies nicht zu, aber Stone und seine Freunde drehen in der Not den Spieß um, beginnen eigene Recherchen und bringen sich dadurch erst recht in Lebensgefahr.
In Atlantic City drehen die Gauner Annabelle Conroy, Leo Richter, Tony Wallace und Freddy Driscoll das Ding ihres Lebens: Mit einem genialen Trick luchsen sie dem Kasino-Mogul und Gangsterboss Jerry Bagger 40 Millionen Dollar ab. Statt anschließend in einen möglichst abgelegenen Winkel der Erde zu flüchten, reist Annabelle nach Washington: Jonathan DeHaven war die Liebe ihres Lebens. Um sein Ende zu rächen, tut sich Annabelle mit dem „Camel Club“ zusammen. Gemeinsam setzt man Trickreichtum gegen Gewalt; eine Methode, die allerdings nicht immer funktioniert, was für brenzlige Situationen sorgt …
_Hau in die Tasten, Baldacci!_
David Baldacci ist ein fleißiger Autor. Mindestens einen Thriller wirft er jährlich auf jenen Buchmarkt, der vor allem die Gelegenheits-Leser bedient, die während eines Fluges, einer Bahnfahrt oder am Strand bratend eine spannende Geschichte lesen wollen, die sich auch mit abgelenktem Hirn verfolgen lässt. Bei einem solchen Ausstoß gilt es ökonomisch zu arbeiten. Baldacci hat deshalb den Faktor „Originalität“ aus seinem Werk getilgt. Er bedient sich bekannter und bewährter Elemente, die er jeweils routiniert neu kombiniert.
Der empörte Fan wird diese Einschätzung sogleich persönlich nehmen und ablehnen. Allerdings befindet sich der Rezensent mit seiner Einschätzung auf der sicheren Seite, denn Baldacci macht aus seinem Vorgehen nie einen Hehl. Er produziert seine Verbrauchslektüre mit dem redlichen Vorsatz der möglichst intensiven Unterhaltung. Literarische Wertvorstellungen bleiben von vornherein ausgeklammert.
Auf diesem Level funktioniert „Die Sammler“ reibungslos. Obwohl ein Großteil der Handlung in stillen Bibliothekssälen zwischen staubigen Buchregalen spielt, legt Baldacci ab der ersten Seite ein Tempo vor, das er bis zum großen, leichenreichen Finale durchhält. Dabei legt er durchaus Einfallsreichtum an den Tag, wenn er betont harmlose Bücherwürmer in einen aufregend ungleichen Kampf mit skrupellosen CIA-Agenten verwickelt.
|Ist es spannend, wird es verwurstet|
Der moderne US-Mainstream-Thriller gehorcht seit jeher gewissen Regeln, die ihn gleichzeitig spannend und berechenbar machen. Entweder sitzt ‚der Feind‘ in Schurkenstaaten wie Nordkorea, Iran/Irak oder in einem der zahlreichen Nachfolge-Länder der ehemaligen Sowjetunion, oder er ist – ganz besonders heimtückisch! – Teil jener US-Einrichtungen, die Attacken aus dem Ausland abwehren sollen. Baldacci geht auf Nummer Sicher und mischt beide Konzepte. Dabei differenziert er sorgfältig: Gefoltert und gemordet wird nur von lumpigen Individuen. Die von ihnen missbrauchten Institutionen sind selbst Opfer. Scheinbare Kritik an den Praktiken der CIA wird dadurch relativiert: „Die Sammler“ ist ein ‚konservativer‘ Thriller im softkritisch aufgepepptem Gewand.
Behauptet ist ebenfalls jeder Gegenwartsbezug. Baldacci schlachtet Vorurteile gegen Politiker, Lobbyisten, Geheimdienstler, Bürokraten und andere unentbehrliche aber wenig geliebte Gruppen aus. Er instrumentalisiert sie im Rahmen einer Geschichte, die der Leser nicht ernst nehmen sollte, da er sich sonst grob veräppelt fühlen müsste. Was Baldacci als kriminelle Volte verräterischer Geheimagenten ausklügelt, ist nicht raffiniert, sondern so kompliziert und von glücklichen Zufällen abhängig, dass nur Papier-Strolche wie Albert Trent und Roger Seagraves damit durchkommen können. Aber: Es |klingt| plausibel und sorgt für Spannung. Damit ist Baldaccis Primärziel einmal mehr abgedeckt.
|Kuriose Figuren sorgen für Entertainment|
Den gar schröcklichen Finsterbolden stehen ähnlich überzeichnete Gutmenschen gegenüber. Der „Camel Club“ ist eine anachronistische Verbindung, die mit ihrem Idealismus im 19. Jahrhundert besser aufgehoben wäre. Natürlich ist dies Teil von Baldaccis Spiel mit dem Klischee (das er freilich nicht so gut beherrscht, wie er glaubt): Zirkel mit hehren Zielen gehören zum festen Inventar einer versunkenen Epoche der Unterhaltungsliteratur. Von „Lord Percy vom Excentric Club. Der Held und kühne Abenteurer“ (1913) bis zur „Liga der außergewöhnlichen Gentlemen“ hat sich das Konzept erhalten. Erneut überhöht (oder übertreibt) Baldacci das Vorbild, indem er vier ebenso mutige, entschlossene und ehrenhafte wie exzentrische, unkonventionelle und sympathische Figuren als Clubmitglieder vorstellt.
Dass sie im Dienst der guten Sache ständig das Gesetz biegen und brechen, macht sie nur interessanter. Baldaccis Welt ist ohnehin zynisch schwarzgefärbt: Das Establishment schreibt die Regeln vor, ohne sich selbst daran zu halten. Der brave, arglose, dumme Bürger ist ihm hilflos ausgeliefert. Als intellektuelles „A-Team“ tritt dann der „Camel Club“ auf. Er kann die Welt nicht insgesamt bessern aber seinen Teil dazu beitragen – und dabei viele Leser begeistern.
|Schräg-Helden mit Vergangenheiten|
Damit diese Klischees nicht gar zu eindimensional wirken, unterlegt Baldacci seinen vier seltsamen Helden tragische Vergangenheiten. Alle sind sie enttäuschte und gescheiterte Idealisten, die unter einem Panzer fröhlicher Gleichgültigkeit verletzte Menschenwürde durchschimmern lassen, wenn Baldacci ernste Töne anschlagen möchte.
Neu ins Boot kommt in diesem zweiten Abenteuer des „Camel Club“ die Trickdiebin Annabelle Conroy, mit der Baldacci die Figuren-Exzentrik übertreibt und ins Gegenteil verkehrt: Annabelle ist eine Super-Frau, deren Geschick das gesamte Club-Quartett in den Schatten stellt. Sie weiß immer Rat, ist schlagfertig, selbstverständlich wunderschön, und in ihrem Busen hegt sie ein trauriges Herkunfts-Geheimnis, das sie nur uns, den Lesern, und dem weisen Oliver Stone enthüllt, was den Grundstein für eine sicherlich romantische aber komplizierte Lovestory legt.
|Puzzle-Thriller mit zu vielen Teilen|
Womit wir zu den weniger erfreulichen Aspekten dieses Romans kommen. 500 Seiten ist er stark und doch nur Episode, denn Baldacci handhabt seine „Camel Club“-Reihe wie eine TV-Serie. Er beschränkt sich keineswegs auf eine Story. So hat die Jerry-Bagger-Story in diesem Roman eigentlich nichts verloren. Knapp zweihundert Seiten laufen zwei geografisch und thematisch separate Geschichten nebeneinander her. Dass der „Camel-Club“-Strang den Sieg davontragen wird, steht lange nicht fest. Baldacci schildert den Kasino-Coup und seine Beteiligten in Details, die in der zweiten Romanhälfte keine Rolle mehr spielen bzw. nur alibihaft und kurz aufgenommen werden. Erst im Finale tritt Bagger erneut und als personifizierter Schlussgag auf: Er bereitet das nächste Abenteuer des „Camel-Club“-Teams vor, das sich natürlich um Annabelles Rettung vor den vertierten Knechten des Gangsterkönigs drehen wird. (Als „Stone Cold“ – dt. „Die Spieler“ – ist es inzwischen erschienen.)
Baldacci versucht, mit überlappenden Handlungssträngen die Publikumsbindung zu erzwingen. Als Autor gedenkt er sich nicht zu disziplinieren. Er schreibt und schreibt und scheint dabei vor allem das tägliche Seitensoll im Auge zu behalten. Dies würde auch den Stillstand im Mittelteil erklären. Scheinbar geschieht weiterhin viel, aber de facto tritt die Handlung auf der Stelle und wird mit ausladenden Exkursen und durchaus netten Episoden in die Länge gezogen. So erweist sich das mit großem Getöse eingeführte und breit ausgewalzte Geschehen um ein geheimnisvolles Buch als reine Schaumschlägerei, die im Finale alibihaft in ein paar Nebensätzen lächerlich ‚aufgeklärt‘ wird.
|Spannend oder witzig?|
Kühles Kalkül legt der Verfasser schließlich auch an den Tag, wenn er den Grundton seiner Geschichte wählt. „Die Sammler“ soll möglichst alle Thriller-Wünsche befriedigen, also spannend, aktuell, actionreich, komplex und im Detail blutrünstig sein. Dazu mischt Baldacci beinahe mutwillig so viel Humor in seine Mixtur, dass diese immer wieder in einer Thriller-Parodie umzuschlagen droht. Möchte er Kritikern damit den Wind aus den Segeln nehmen? Soll der Leser die Handlung gar nicht ernst genommen werden? Oder möchte Baldacci mit ‚lustigen‘ Einschüben für Entspannung sorgen?
Auf jeden Fall ist sein Verständnis von Komik eher robust. Diversen gelungenen, weil schwarz- und trockenhumorigen Onelinern (die der Übersetzer entweder gut übertragen konnte oder für das deutsche Publikum aufpoliert hat) stehen flaue, sich ständig wiederholende Witzchen – Buchwurm Caleb verliert in kritischer Lage die Nerven, Frauenheld Reuben sabbert der hübschen Annabelle hinterher, die ihn schallend abblitzen lässt, Bibliothekare und Bibliotheksbesucher sind weltfremde Lachgestalten – gegenüber. Sie wirken besonders befremdlich und sogar zynisch, wenn Baldacci wenige Zeilen später CIA-Schergen und Gangster detailfroh foltern und verstümmeln lässt.
Die grob gesponnene Story gewinnt dennoch durch Baldaccis gefälligen Sprach- und Schreibstil. „Die Sammler“ ist kein notdürftig als Roman maskiertes Drehbuch und der Verfasser ein gewandter Routinier, der nur leider allzu geschmeidig seinem Publikum bietet, womit er sich zufriedengibt – nicht weniger, aber auch niemals mehr.
|Taschenbuch: 494 Seiten
Originaltitel: The Collectors (New York : Warner Books 2006)
Übersetzung: Uwe Anton
Deutsche Erstausgabe (geb.): Dezember 2008 (Lübbe Verlag)
ISBN-13: 978-3-7857-2354-8
Als Taschenbuch: Oktober 2010 (Bastei-Lübbe-Verlag/Allgemeine Reihe 16479), 494 Seiten
ISBN-13: 978-3-404-16479-0
Als Hörbuch: November 2008 (Bastei-Lübbe-Verlag)
6 CDs (= 447 min.), gelesen von K. Dieter Klebsch
ISBN-13: 978-3-7857-3842-9
Als (MP3-) Download: November 2008 (Bastei-Lübbe-Verlag)
6 CDs (= 447 min.), gelesen von K. Dieter Klebsch
ISBN-13: 978-3-7857-4097-2|
[Autorenhomepage]http://davidbaldacci.com
[Verlagshomepage]http://www.luebbe.de
_David Baldacci bei |Buchwurm.info|:_
[„Die Verschwörung“ 396
[„Der Abgrund“ 414
[„Mit jedem Schlag der Stunde“ 2400
[„Die Wächter“ 4513
[„Die Versuchung“ 676
[„Das Versprechen“ 361
[„Im Bruchteil der Sekunde“ 836
[„Das Geschenk“ 815
[„Im Takt des Todes“ 5677
[„Die Sammler“ 5748
Frank Tallis – Kopflos

Frank Tallis – Kopflos weiterlesen
Stephen M. Irwin – Der Sog
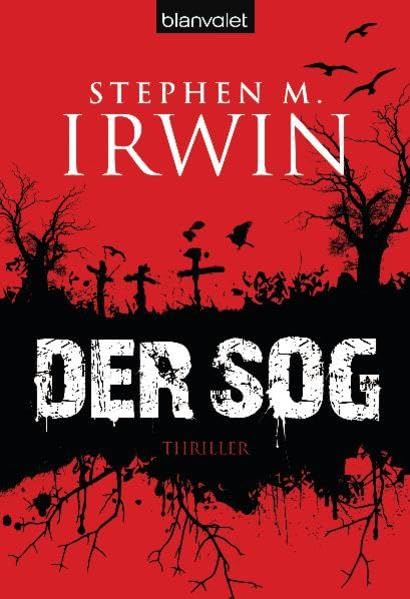
Freeman Wills Crofts – Es war Mord

Freeman Wills Crofts – Es war Mord weiterlesen
David Moody – Todeshunger (Hater 2)

Charles Eric Maine – Zwei … eins … null

Das geschieht:
Kaluiki, eine öde Insel irgendwo im tropischen Pazifik. Heiß ist es hier und einsam – gerade der richtige Ort für ein Experiment, das Geschichte machen wird: Abseits allzu neugieriger Sowjets, Chinesen und anderer Kommunisten-Strolche erproben Amerikaner und Briten das erste durch Antischwerkraft ins All zu hievende Raumschiff. „Projekt Agnes“ ist top secret, Kaluiki hermetisch vom Militär abgeriegelt. Nur fünf Wissenschaftler blieben unter der Leitung des genialen Professors Guy Strang auf der Insel zurück, zu ihnen gesellen sich der Sicherheitsoffizier George Earl und der Journalist Russ Farrant, der im Auftrag der beteiligten Regierungen Countdown und Start dokumentieren soll.
Die hochkomplexen Vorbereitungen werden sich über 72 Stunden hinziehen, während derer die sechs Männer und zwei Frauen völlig auf sich gestellt bleiben. Farrant langweilt sich und lässt sich daher gern von Earl rekrutieren, der per Radar eine mysteriöse Metallmasse irgendwo auf der Insel geortet zu haben glaubt. Die beiden Männer finden ein merkwürdiges Flugobjekt, doch bevor sie es näher untersuchen können, werden sie geistig von einer unbekannten Macht unterjocht. Earl attackiert Farrant, der seinen Gegner in Notwehr tötet und sogleich die Erinnerung an diese Tat verliert.
Ahnungslos kehrt Farrant ins Lager zurück, wo bald die Hölle losbricht. Auf brutale Weise wird ein Forscher nach dem anderen umgebracht. Jeder verdächtigt und belauert jeden, aber besonders argwöhnisch wird Farrant betrachtet, der für keine Tatzeit ein überzeugendes Alibi vorweisen kann. Der so Bedrängte kämpft gleich an mehreren Fronten: um seine Unschuld, die geliebte Kay Kinley, die misstrauischen Gefährten und den unsichtbaren, mörderischen Feind, der sich nicht unbedingt als außerirdisch erweisen wird …
Großes Drama auf kleiner Insel
Ganz und gar keine große Literatur, aber ein wunderbares, nostalgisches SF-Abenteuer mit ausgeprägten filmischen Qualitäten legt Verfasser Charles Eric Maine hier vor. Die Geschichte ist wahrlich nicht neu; wir kennen sie aus zahlreichen B-Movies der Jahrzehnte nach dem II. Weltkrieg. Das heißt aber nicht, dass wir sie über haben, wenn sie so gut erzählt wird wie hier!
Maine unterhält überaus ökonomisch: Die Kulisse ist überschaubar, die Grenzen sind abgesteckt. Das Personal beschränkt sich auf acht Personen, die sich nach Gestalt, Charakter und Verhalten klar unterscheiden lassen. Der Plot ist simpel, aber bewährt: eine Invasionsgeschichte, die über weite Strecken dem uralten Prinzip der „Zehn kleinen Negerlein“ (die man heute politisch korrekt sicher nicht mehr so nennen darf) huldigt.
So lange unklar bleibt, wer oder was hinter den Morden & Hirnverbiegungen steckt, funktioniert „Zwei … eins … null“ prächtig. Die finale Auflösung enttäuscht ein bisschen, aber das liegt in der Natur von Mysterien. Sie sind gemeinhin interessanter als die Wahrheit, die hinter ihnen steckt. Viele ‚logische‘ Lösungen gäbe es ohnehin nicht. Maine sei aber dafür gelobt, dass er sich trotzdem bemüht, einen Überraschungseffekt einzubauen.
Vorsicht ist besser als Neugier!
Ansonsten lernen wir, dass Misstrauen stets der beste Begleiter des freien Menschen ist. Lange argwöhnen die in Bedrängnis geratenen Wissenschaftler, dass hinter dem üblen Treiben die bösen Roten stecken, die in dieser Zeit des Kalten Krieges – „Zwei … eins … null“ spielt in der unmittelbaren Zukunft des Jahres 1959 – immer und überall darauf lauern, die Weltherrschaft zu übernehmen.
Der ursprüngliche Titel „The Big Countdown“ ist übrigens eine mit britisch schwarzem Humor aufgeladene Zweideutigkeit. Er beschreibt nicht nur die endlosen letzten 72 Stunden des Projektes „Agnes“, sondern auch die Besorgnis erregende Verminderung der Darstellerriege.
Figuren mit klaren Konturen
Russ Farrant ist der Junge, Kay Kinley das Mädchen, womit wir bereits knapp in Worte gefasst haben, dass „Zwei … eins … null“ auch eine Liebesgeschichte der züchtig-korrekten Art erzählt. Den zeitgenössischen Leser mag Kays wissenschaftliche Bildung und ihre Selbstständigkeit verstört haben, aber keine Sorge: Wenn’s richtig gefährlich wird, muss doch wieder ein echter Kerl ‚ran, und ansonsten träumt auch eine gestandene Forscherfrau eigentlich nur davon, endlich geheiratet zu werden.
Wenn er nicht gerade balzt, ist Russ kein besonders schlauer, aber wackerer Streiter für die Dinge, die wirklich zählen im Leben (Vaterland, Job, Kumpels, die Rettung der Welt). Wie es sich für einen echten Helden gehört, steht er sogleich wieder auf, wenn ihn das Schicksal niederwirft (was hier recht häufig geschieht), und setzt den Kampf fort, bis er endlich – natürlich – den Sieg (und das Mädchen) davonträgt.
Die übrigen Darsteller bilden die typische Riege des vordergründig belebten Kanonenfutters, das über einige kräftige Konturen verfügt, damit sie der Leser auseinander halten kann, aber ansonsten ziemlich gesichtslos bleibt. Sie müssen auch gar nicht so markant sein, denn sie werden ohnehin umgebracht und bescheren dann als Leiche den eigentlichen Hauptfiguren schockierende Momente: Auch das belegt das Niveau, auf dem sich dieser Roman bewegt und dabei sehr unterhaltsam bleibt.
Autor
Charles Eric Maine wurde als David McIlwain am 21. Januar 1921 im britischen Liverpool geboren, verbrachte seine Jugendjahre aber in Indien. Nach der Rückkehr wurde er in den späten 1930er Jahren im Science Fiction-Fandom aktiv und gab u. a. gemeinsam mit den späteren Autorenkollegen John Burke ein Fanzine namens „The Satellite“ (1938) heraus. Außerdem schrieb das Duo SF-Geschichten unter dem Pseudonym Charles Eric Maine, das McIlwain später allein übernahm.
Im II. Weltkrieg diente McIlwain als Signaloffizier in der Royal Air Force. 1943 verschlug es ihn nach Nordafrika. Ins Zivilleben zurückgekehrt, wurde er Fernsehtechniker, freier Journalist mit dem Spezialgebiet Elektronik und später Herausgeber einer Zeitschrift für Radio und Fernsehen.
1952 begann McIlwain seine eigentliche SF-Karriere. Er schrieb Hörspiele als Charles Eric Maine, die er, wie gesagt ein ökonomisch arbeitender Autor, zu Romanen und Filmdrehbüchern umarbeitete. In der Filmwelt kreierte Maine solide Durchschnittsware, darunter den gar nicht uninteressanten „Time Slip“ (1955, dt. „Sieben Sekunden zu spät“) über einen zeitversetzten Unglückswurm oder den unterhaltsam-schundigen „Escapement“ (GB 1957, dt. „Mit 1000 Volt in den Tod“).
David McIlwain blieb als Autor aktiv bis zu seinem frühen Tod am 30. November 1981. Zu den wirklich Großen des SF-Genres kann man ihn nicht zählen, aber er hinterließ eine Reihe gut erzählter, spannender Geschichten, was nicht die schlechteste Grabinschrift für einen Schriftsteller ist.
Taschenbuch: 170 Seiten
Originaltitel: The Big Countdown/Fire Past the Future (New York : Ballantine Books 1959)
Übersetzung: Tony Westermayr
http://www.randomhouse.de/goldmann
Der Autor vergibt: 



Richard Montanari – Septagon
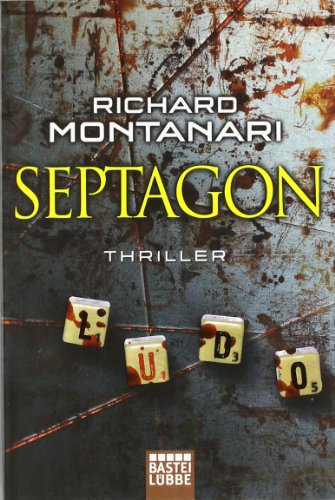
Richard Montanari – Septagon weiterlesen
L. Sprague De Camp , P. Schyler Miller – Die neuen Herrscher (Utopia Classics 13)
Auf einer Busfahrt durch den US-Staat Pennsylvania werden 28 Menschen gänzlich unterschiedlicher Herkunft während einer Tunnelfahrt Opfer eines Autounfalls. Einer der Passagiere transportierte im Gepäck ein neu entwickeltes Gas, das beim Aufprall entweicht und alle Insassen in eine Art Winterschlaf versetzt, der mehr als eine Million Jahre dauert.
Als sie erwachen und sich zur Oberfläche durchkämpfen, finden sich die Männer und Frauen auf einer gänzlich veränderten Erde wieder. Unberührte und schier unendliche Wälder umgeben sie, und bewohnt werden diese von seltsamen Kreaturen. Riesen-Fledermäuse, bärengroße Nagetiere oder halbintelligente Ratten sind immerhin friedlich, während groteske Räuber schnell die Anzahl der überraschten und entsetzten Neuankömmlinge vermindern.
L. Sprague De Camp , P. Schyler Miller – Die neuen Herrscher (Utopia Classics 13) weiterlesen
D’Lacey, Joseph – Entsorgt
_Das geschieht:_
Shreve ist eine gesichtslose Stadt irgendwo in den englischen Midlands. Die einzige ‚Sehenswürdigkeit‘ bildet eine gewaltige Müllkippe, auf der die Abfälle des gesamten Landkreises gesammelt werden. Korruption und Gleichgültigkeit führen dazu, dass kaum kontrolliert wird, was da täglich (und vor allem heimlich in der Nacht) angeliefert wird. Tief im Boden schwappt daher eine giftige aber unheilvoll fruchtbare Suppe, in der organische und anorganische Elemente seltsame Verbindungen eingehen.
Eines Tages ist es soweit: Ausgerechnet in Shreve gelingt die abiogenetische Urzeugung bisher unbekannten Lebens. Aus Unrat und Schrott entstehen formlose aber bewegliche, instinktgesteuerte und hungrige Kreaturen. Sie ernähren sich von Blut und sind ständig damit beschäftigt, ihre Mischkörper zu modifizieren und zu verbessern. Bei guter Ernährung wachsen sie schnell – und sie sind intelligent, wie der Einsiedler Mason Brand zufällig herausfindet, als sich eines Abends eines der Wesen in seinen Garten verirrt. Statt es zu töten, nimmt es der neugierige Mann auf, füttert und versteckt es. Ungestört kann der „Fäkalith“ sich entwickeln; er nimmt sich dabei seinen ‚Vater‘ zum Vorbild.
Andere Bürger begegnen den Artgenossen des Fäkalithen. Ohne Schutz und Förderung mutieren diese zu fressgierigen, aggressiven Ungeheuern, die unvorsichtigen Haustieren und bald auch Wanderern auflauern. Als der Fäkalith seine Entwicklung abgeschlossen hat, schwingt er sich zum Anführer auf. In seinem Auftrag fallen die Kreaturen über Shreve und seine Einwohner her. Sie säen Angst & Schrecken, und sie nutzen den Rohstoff Mensch mit nie gekanntem Einfallsreichtum. Die Außenwelt wird aufmerksam, Militär marschiert auf. Unbarmherzig werden Müll-Monster und ‚infizierte‘ Menschen ausgelöscht, ohne dem Phänomen auf den Grund zu gehen – das typisch grobe Vorgehen eines Establishments, dem dadurch entgeht, dass es dem bizarren Gegner in die Hände bzw. Tentakeln arbeitet …
_Horror der wahrhaft schmutzigen Art_
|“Geld stinkt nicht“|, wies der römische Imperator Vespasian (9-79 n. Chr.) Kritiker in die Schranken, als er ausgerechnet die öffentlichen Toiletten mit einer Latrinensteuer belegte. Sein Plan war ebenso einfach wie genial, sodass er aufgehen musste: Der Mensch kann nicht existieren, ohne Dreck zu verursachen, um den er sich – dies ist der nächste logische Gedankenschritt – tunlichst nicht selbst kümmern möchte.
Was stört, wird ausgelagert. Wer sich in dieses anrüchige Geschäft wagt, lässt sich gut dafür bezahlen. Der Profit steigt, wenn man nicht genau hinschaut, was die Kundschaft heranschafft, sondern es einfach dort stapelt oder vergräbt, wo es aus den Augen und damit aus dem Sinn gerät.
Leider bleibt der richtig gefährliche, grässliche Dreck oft nicht dort. Ungestört sickert er ins Erdreich, ins Grundwasser, verseucht Pflanzen und Tiere und landet letztlich doch wieder bei seinen Verursachern. Joseph D’Lacey dreht diese Schraube einige Windungen weiter und erfindet einen Müll, der sich seiner fauligen Haut zu wehren beginnt. Da es seiner Natur entspricht, geht er (der Müll, aber auch D’Lacey) dabei überaus garstig zu Werke.
Wer sich fragt, was damit gemeint ist, wird im letzten Drittel des hier vorgestellten Romans so offen ins Bild gesetzt, dass keine Frage mehr, sondern nur noch Übelkeit bleibt. Autor D’Lacey hat sich viel Mühe gegeben und tief im Wortschatz seiner Sprache geschürft, um die blutigen Exzesse kotig-brandiger Schreckgestalten möglichst anschaulich zu schildern. Vom Ehrgeiz gepackt, blieb ihm der Übersetzer nichts schuldig.
|Die Stadt als Spiegelbild der Müllkippe|
Obwohl man es angesichts der bizarren Handlung weder erwarten würde noch es zunächst bemerkt, hat diese Geschichte eine Moral. D’Lacey hat gelernt und serviert sie den Lesern nicht mehr wie in seinem Romanerstling „Meat“ mit der ganz groben Kelle. Gesellschaftskritik wird geübt, aber D’Lacey ordnet sie dieses Mal seiner Geschichte unter.
Der „Garbage-Man“-Horror setzt ähnlich schleichend und trügerisch ein wie ein weicher Furz. (Dieser Roman erzwingt solche Assoziationen.) Die halbe Geschichte vergeht für den Leser mit dem Kennenlernen immer neuer, generell unsympathischer Figuren und ihrer banalen, abstoßenden Geheimnisse. Immer lauter fragt man sich, wann dies endet und endlich der Horror beginnt.
Erst allmählich schält sich D’Laceys Intention heraus: Müllkippe und Stadt Shreve bilden Spiegelbilder, wobei der eigentliche Schrecken zunächst nicht von der Gift-Deponie ausgeht. In der Stadt ist das Leben aus den Fugen geraten. Sämtliche Figuren sind kriminell, psychisch gestört, ausgebrannt oder stecken in einer anderen Sackgasse fest. Nicht nur die Abfälle, die sie täglich verursachen, finden ihren Weg auf die Kippe. Hinzu kommt emotionaler Ballast, der das ohnehin geschädigte Erdreich zusätzlich tränkt.
Auf diese Weise schaffen die Menschen sich ihre Monster selbst. Als der Müll seine Kreaturen freigibt, sind diese zwar gefährlich aber nicht bösartig. Sie wollen nur leben, und dafür müssen sie fressen. Erst im Laufe ihrer Entwicklung verändern sie sich. Sie bauen ihre Körper und Hirne mit weiterem Unrat auf. Unabsichtlich verleiben sie sich dabei noch mehr Negatives aus Menschenhand und -hirn ein, was nicht folgenlos bleibt: Die Kreaturen wachsen, sie werden intelligent – und aggressiv.
|Müll mit Mission?|
An diesem Punkt weicht D’Lacey leider von seiner fröhlich-anarchischen Linie ab. Der lebende Müll entsteht nicht einfach. Er wird von Gäa, der personifizierten Mutter Erde, ins Leben gerufen. Gäa hat die Nase voll von den schmutzigen Umtrieben der Menschen, die ihre ‚Haut‘ mit Abfällen und Giften aller Art besudeln. Sie wirft die Evolutions-Maschine an und schafft den Fäkalithen und seine Brut.
Mit dieser Idee gerät „Entsorgt“ auf ein unerquickliches Nebengleis. Die Story verträgt so, wie D’Lacey sie erzählt, keinen Ernst. „Entsorgt“ ist dem „Toxic Avenger“ des Trash-Filmstudios Troma zu nah. Als der Verfasser seinem Garn eine Botschaft unterlegen will, macht er sich unnötig lächerlich. Grober Horror und esoterisches Fein-Gefasel vertragen sich nicht, weshalb man die entsprechenden Passagen am besten nur überfliegt, ausblendet und sich auf die rabiaten Szenen konzentriert, für die der Verfasser ein weitaus besseres Händchen hat.
P. S.: Das Cover-Zitat „Joseph D’Lacey rocks“, angeblich gesprochen von Stephen King, sollte der Leser mit der angemessenen Nichtachtung solcher Plump-Werbung strafen; es findet sich genauso bereits auf dem Cover von „Meat“, D’Laceys Roman-Erstling (der übrigens gar nicht rockt).
_Autor_
Joseph D’Lacey wurde in London geboren, lebte aber die meiste Zeit in den englischen Midlands. Auch heute lebt und arbeitet er in der mittelenglischen Grafschaft Northamptonshire – und zwar hauptberuflich nicht als Schriftsteller, sondern als Inhaber einer eigenen Praxis für Akupunktur. Als Autor trat er lange vor allem online in Erscheinung. Der Erfolg seines Romanerstlings „Meat“ sorgte dafür, dass D’Laceys Werke verstärkt im Druck erscheinen.
|Taschenbuch: 416 Seiten
Originaltitel: Garbage Man (London: Bloody Books, Beautiful Books 2009)
Übersetzung: Stephan Glietsch
ISBN-13: 978-3-453-43510-0|
[www.randomhouse.de/heyne]http://www.randomhouse.de/heyne
Koontz, Dean / Anderson, Kevin J. – Frankenstein: Das Gesicht
_Die |Frankenstein|-Trilogie:_
Band 1: _“Das Gesicht“_
Band 2: „Die Kreatur“
Band 3: „Der Schatten“
_Das geschieht:_
In der US-amerikanischen Südstaatenmetropole New Orleans verursacht ein Serienmörder der Polizei Kopfzerbrechen: Er tötet Frauen und Männer, denen er jeweils Gliedmaßen oder Organe entfernt. Detective Carson O’Connor und Partner Michael Maddison stehen auch nach dem sechsten Fall vor einem Rätsel bzw. mit indizienleeren Händen da.
Auch auf der anderen Seite der Erdkugel werden die Morde mit Besorgnis zur Kenntnis genommen. Ins tibetische Kloster Rombuk und damit in die größtmögliche Einsamkeit hat sich jene Kreatur zurückgezogen, die einst der ebenso geniale wie skrupellose Wissenschaftler Viktor Frankenstein aus Leichenteilen schuf. Das „Monster“, wie es einmal genannt wurde, ist inzwischen zweieinhalb Jahrhunderte alt aber weiterhin gut bei Kräften. Es nennt sich Deucalion, hat hart und erfolgreich an seiner Bildung gearbeitet, sich mit seinem grotesken Äußeren abgefunden und ist mit Körper und Geist im 21. Jahrhundert angekommen.
Dies trifft auch auf Frankenstein zu, der zum ultrareichen Konzernboss Helios mit guten politischen Kontakten geworden ist. Ihn verdächtigt Deucalion der Mordserie im Süden der USA. Um ihn zu stoppen, reist er nach New Orleans. Dort gerät er rasch ins Visier von O’Connor und Maddison, die verständlicherweise wenig geneigt sind, an die Existenz einer alten Gruselmär zu glauben. Doch die Not schafft bekanntlich seltsame Bettgenossen: Als seltsame, anscheinend künstliche Wesen ihr Unwesen zu treiben beginnen, offenbart sich ein diabolischer Plan: Frankenstein will eine neue, ‚verbesserte‘ Menschenrasse ins Leben rufen, deren Meister natürlich er selbst sein soll. Ihn aufzuhalten ist schwierig, denn Frankenstein ging bereits erfolgreich in die Massenproduktion und schickt seine Geschöpfe aus, um jene zu jagen und zu töten, die sich ihm in den Weg stellen …
_Ein Kult auf modernen (Ab-)Wegen_
Verrückter Wissenschaftler will die Welt nach seinem Gusto verändern und bedient sich dafür kapital krimineller Methoden, worauf sich ein hoffnungslos unterlegenes Grüppchen aufrechter Gesellen aufmacht, genau dies zu verhindern: Eine Geschichte wird uns hier kredenzt, die wir schon oft gelesen oder als Film umgesetzt gesehen haben. Das geht in Ordnung, wenn sie rasant und ohne Längen erzählt wird, wofür die Namen Koontz & Anderson grundsätzlich garantieren.
Aufmerksamkeit soll in diesem Fall erfolgreich erregt werden, indem besagte Geschichte mit einem Romanklassiker verquickt wird, der über seine literaturgeschichtliche Bedeutung hinaus zu einem festen Bestandteil der Populärkultur geworden ist: Ein echter Kult, der nicht gemacht wurde, sondern aus eigener Kraft wuchs. Baron Frankenstein, der sich gegen Gott versündigte, als er dessen Monopol als Schöpfer von Leben missachtete, und seine Kreatur, die an ihrer Herkunft verzweifelte und ohne Erfolg versuchte, als Mensch unter Menschen einen Platz zu finden, bewegen die Fantasie seit dreihundert Jahren. Die Ankündigung ihres neuerlichen Auftritts stellt bereits ein gewisses Grundinteresse sicher: Was werden sie dieses Mal erleben, da sie im 21. Jahrhundert aufeinandertreffen?
Eigentlich nichts Neues, muss man feststellen. Frankenstein und sein Geschöpf führen ihre Auseinandersetzung fort, die vor vielen Jahren für beide beinahe tödlich geendet hätte. Weiterhin weigert sich Frankenstein einzusehen, dass er intelligente Wesen nicht im Labor ‚bauen‘ darf, um ihnen, ist dieses ‚Experiment‘ gelungen, seinen Willen aufzuzwingen. Das „Monster“, das dieses Schicksal am eigenen Leib erfahren musste, bemühte sich bisher vergeblich, Frankenstein dies klarzumachen. Jetzt geht es ihm darum, seinen ‚Meister‘ zu stoppen.
|Action statt Anspruch: Horror im Höchsttempo|
Der Konflikt beschränkt sich nicht mehr auf Frankenstein und seine Kreatur. Koontz (sein Name wird im folgenden Text allein genannt, da er die treibende Kraft hinter diesem neuen „Frankenstein“-Projekt war) erweitert die Bühne. Die ganze Welt ist nunmehr Spielplatz des globalisierten Barons geworden, was seine Verfolger zwingt, sehr reiselustig zu werden. „Das Gesicht“ fügt sich der Dramaturgie eines „Hit & Run“-Games. Immer geschieht etwas, kaum gibt es jemals einen Moment der Ruhe. Aus Jäger werden Gejagte, wobei die Rollen rasch getauscht werden können. Koontz beherrscht dieses Konzept gut genug, dass kaum jemals der Gedanke beim Leser aufkommt, ob es denn wirklich notwendig ist, dieses Hin und Her auf mehrere Bände auszuwalzen.
Tiefgang dürfen wir folgerichtig nicht erwarten, auch wenn ihn uns Koontz manchmal vorgaukeln möchte, wenn es Frankensteins Monster hier und da über sein Schicksal und seinen Status in dieser grausamen, kalten Welt sinnieren lässt. Es sind trivialisierte Echos jener philosophischen Grundsatzdiskussionen, die Mary W. Shelley, die Autorin des ursprünglichen Romans, Frankenstein und sein ‚Kind‘ vor drei Jahrhunderten führen ließ. „Das Gesicht“ ist dagegen ein moderner Horror-Thriller mit Copkrimi-Einsprengseln, der sich auf die bekannten und bewährten Elemente beider Genres verlässt.
|Unsterblicher Vater-Sohn-Konflikt|
Wie würde ein Frankenstein-Monster – wäre es real – in der modernen Welt leben? Die neue „Frankenstein“-Trilogie basiert zu einem guten Teil auf dieser Frage bzw. den möglichen Antworten. Natürlich gilt es zuvor zu unterscheiden zwischen der zwar hässlichen aber hochintelligenten Kreatur, die Mary Wollstonecraft Shelley 1819 schuf, und dem relativ tumben, schnaubenden Hollywood-Monster, das vor allem in den 1930er Jahren von Boris Karloff gemimt wurde.
Koontzes Deucalion ist Shelleys Kreatur, was bereits die selbstironische Namenwahl belegt: „Deucalion“ war in der griechischen Mythologie ein Sohn des Prometheus, der wiederum als Schöpfer der Menschen und Tiere verehrt wurde. Als „modernen Prometheus“ bezeichnete Shelley Victor Frankenstein, den sein Geschöpf lange Zeit als „Vater“ betrachtete.
Das ist Vergangenheit, „Vater“ und „Sohn“ sind sich schon lange spinnefeind. Deucalion hasst Frankenstein – nicht zwangsläufig, weil der ihn wider die Naturgesetze bzw. Gott in eine Welt gebracht hat, die ihm nur Furcht und Hass entgegenbrachte, sondern weil er sich zum einen feige weigerte, Verantwortung für seine unglückliche Schöpfung zu übernehmen, während er zum anderen seine unheilvollen Experimente fortsetzte. Das eigentliche Monster ist folgerichtig Frankenstein.
Deucalion hat zu sich selbst und seine Nische in dieser Welt gefunden. Vorbei sind die Zeiten, in denen ihn ängstliches, ungebildetes Volk mit Fackeln und Mistgabeln jagte oder er sich als kurioses Scheusal auf Jahrmärkten prostituieren musste. Die Welt ist politisch korrekter geworden. Deucalion zieht noch immer die Blicke auf sich, aber er muss sich nicht mehr verstecken, sondern kann, wenn es nötig ist, ganz modern von Tibet in die USA reisen.
|Frankenstein: Ein Erfolgsmodell|
Frankenstein hat inzwischen nur als Wissenschaftler und Machtmensch dazugelernt. Er kann es in Sachen Langlebigkeit mit seiner Kreatur aufnehmen, sodass auch er auf das Wissen von und die Erfahrungen aus Jahrhunderten zurückzugreifen vermag. In der globalisierten Gegenwart, für die er geboren zu sein scheint, hat ihm seine rücksichtlose Gleichgültigkeit den Aufbau eines milliardenschweren Konzerns ermöglicht. Sein grundsätzliches Interesse ist jedoch geblieben: Frankenstein baut weiterhin künstliche Menschen. Ständige Experimente haben ihn gelehrt, welche ‚Konstruktionsfehler‘ er vermeiden sollte. Seine aktuellen Geschöpfe haben nichts mehr mit dem plumpen, klobigen Deucalion gemeinsam. Sie verschwinden in der Menschenmenge, und genau das sollen sie auch, denn Frankenstein, bei Shelley noch eine durchaus tragische Gestalt, ist unter Koontzes Feder endgültig zum intelligenten „mad scientist“ mutiert, der die Welt erobern bzw. mit seinen neuen, vollkommenen Menschen bevölkern will.
|Cops zwischen Mythos und ‚Realität’|
Überlebensgroße Gestalten benötigen normalmenschliche Begleiter, in die sich der Leser/die Leserin projizieren kann. Diese Rollen übernehmen die Polizisten O’Connor und Maddison, harte US-Cops, die in Wort und Tat praktisch alle aktuellen sowie die meisten zeitlosen Klischees verkörpern, die Film, Fernsehen & Unterhaltungsliteratur jemals erschaffen haben. Detective O’Connor ist ein eisenhartes Frauenzimmer, das ständig beim Chef aneckt, kleine Ganoven gern gleich auf offener Straße vertrimmt und selten im Büro beim Papierkram anzutreffen ist. Natürlich ist sie hübsch, damit es hier und da ein wenig prüdamerikanisch knistern kann. Maddison ist in diesem Roman das Yang zum O’Connorschen Yin; originell soll vermutlich wirken, dass er in diesem Duo den zurückhaltenden Part übernimmt.
Plumpwitz kommt zum Einsatz, wenn Koontz zwei unsympathische Polizistenkollegen „Jonathan Harker“ und „Dwight Frye“ nennt: Der eine ist Graf Draculas erstes Opfer in Bram Stokers berühmtem Roman, der andere heißt nach dem Schauspieler, der in dem klassischen „Frankenstein“-Filmen von 1931 Frankensteins buckligen Laborgehilfen mimte. Solche ‚Einfälle‘ passen gut zu „Dean Koontz’s Frankenstein“, der nichts Neues, Originelles schafft, sondern stets nur imitiert.
|Exkurs: Frankensteins schwere Wiedergeburt|
Ihre neue „Frankenstein“-Geschichte hatten sich Koontz und Anderson ursprünglich für das USA Cable Network einfallen lassen, dem sie als Grundlage für den Pilotfilm zu einer ganzen „Frankenstein“-TV-Serie dienen sollte. Koontz wurde als Ausführender Produzent angeheuert. Ihm zur Seite stand niemand Geringerer als Meisterregisseur Martin Scorsese. Allerdings überwarf sich Koontz bald mit seinem Auftraggeber und verließ das Projekt. „Frankenstein“ wurde 2004 unter der Regie von Marcus Nispel („The Texas Chainsaw Massacre“, „Freitag der 13te“ – das Remake) mit Vincent Perez als Monster und Thomas Kretschmann als Meister verfilmt. Das Ergebnis ist keine Sternstunde des phantastischen Films, bietet aber solide gestaltetes und visuell überdurchschnittliches Handwerk.
Dieser Film erschien in Deutschland als DVD unter dem Titel „Frankenstein – Auf der Jagd nach seinem Schöpfer“. Eine Serie folgte aufgrund der Streitigkeiten, die sich auch nach Koontzes Abgang fortsetzten, nicht mehr. Der sparsame Koontz hat seine Ideen deshalb recycelt und zu einer Romanserie umgearbeitet.
_Autoren_
Dean Ray Koontz wurde am 9. Juli 1945 geboren. Er studierte Englisch und arbeitete bis in die späten 1960er Jahre als Lehrer für eine High School nahe Harrisburg. In seiner Freizeit begann Koontz zu schreiben, doch erst in den 1970er Jahren machte er sein Hobby zum Beruf. In diesen Jahren versuchte er sich in vielen Genres, schrieb außer Horror auch Sciencefiction, Krimis oder Liebesschnulzen, wobei er sich oft hinter Pseudonymen verbarg.
Seinen Durchbruch verdankte Koontz dem Roman „Demon Seed“ (1973, dt. „Des Teufels Saat“ bzw. „Security“), der zwar wenig innovativ aber erfolgreich verfilmt wurde. Sein Publikum liebt Koontz für die simplen aber stringent entwickelten Plots, die überzeugend ‚menschlich‘ wirkenden Figuren und das Geschick, mit dem der Autor diese in solide inszenierte unheimliche Abenteuer verwickelt. Da sich Koontz gern bewährter Klischees bedient, sind seine Romane als Vorlagen für Filme beliebt. „Watchers“ (dt. „Brandzeichen“), „Whispers“ (dt. „Höllenqualen“ bzw. „Flüstern in der Nacht“) oder „Hideaway“ (dt. „Das Versteck“) wurden allerdings unfreiwillig kongenial verfilmt: als unterhaltsame aber völlig unoriginelle B-Movies.
Als Produzent anspruchslosen Lesefutters hat Koontz inzwischen Bestsellerstatus erreicht. Von der Kritik werden seine zahlreichen, oft überhastet und unfertig wirkenden, sich in endlosen Verfolgungsjagden erschöpfenden Werke selten positiv gewürdigt. Seine Leser teilen diese Vorbehalte nicht. Koontz weiß, was er an seinen Fans hat, und versorgt sie regelmäßig mit Informationen auf der [sehr professionellen Website]http://www.deankoontz.com .
Kevin J. Anderson (geb. 27. März 1962) gehört zu den bekannten und gern gelesenen Autoren des Genres Sciencefiction, was vor allem seinem Fleiß, seinem Hang zu simpel gestrickten und bewährten Plots sowie der Verwendung einfacher Worte in ebensolchen Sätzen zu verdanken ist. Diese Fähigkeiten machen ihn zum idealen, weil zuverlässigen Lieferanten von Romanen zu Filmen und Fernsehserien; Anderson produzierte u. a. Lesefutter für anspruchsarme „Star Wars-“ und „Akte X“-Fans. Außerdem verfügte er über die Kühnheit, Fortsetzungen bzw. Prequels zu Frank Herberts klassischer „Dune“-Saga zu verfassen, die nicht nur ebenso umfangreich sind, sondern zur Freude des Verlags sehr viel schneller auf den Buchmarkt geworfen werden können als die Originale. Selbst ausgedacht hat sich Anderson die Second-Brain-Space-Opera „Saga of Seven Suns“, die es auf bisher sieben Bände (plus eine Vorgeschichte) gebracht hat. Über sein quasi stündlich wachsendes Werk informiert Anderson auf dieser Website: [www.wordfire.com]http://www.wordfire.com
|Taschenbuch: 382 Seiten
Originaltitel: Dean Koontz’s Frankenstein, Book One – Prodigal Son (New York : Bantam Dell, a division of Random House, Inc. 2005)
Übersetzung: Ursula Gnade
ISBN-13: 978-3-453-56504-3|
[www.randomhouse.de/heyne]http://www.randomhouse.de/heyne
_Dean Koontz bei |Buchwurm.info|:_
[„Die Anbetung“ 3066
[„Seelenlos“ 4825
[„Schattennacht“ 5476
[„Meer der Nacht“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=5942
[„Meer der Finsternis“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=6119
[„Todeszeit“ 5423
[„Todesregen“ 3840
[„Irrsinn“ 4317
[„Frankenstein: Das Gesicht“ 3303
[„Kalt“ 1443
[„Der Wächter“ 1145
[„Der Geblendete“ 1629
[„Nacht der Zaubertiere“ 4145
[„Stimmen der Angst“ 1639
[„Phantom – »Unheil über der Stadt«“ 455
[„Nackte Angst / Phantom“ 728
[„Schattenfeuer“ 67
[„Eiszeit“ 1674
[„Geisterbahn“ 2125
[„Die zweite Haut“ 2648
[„Meer der Finsternis“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=6119
Ed McBain – Kings Lösegeld
_Das geschieht:_
Schon in jungen Jahren schuftete Douglas King, Kind armer Eltern und geboren in einem verrufenen Viertel der Großstadt Isola, in der Schuhfabrik Granger. Mit eiserner Disziplin und rücksichtslos hat er sich seinen Weg nach ganz oben gebahnt. Nun steht er vor der Erfüllung seines Herzenswunsches: King kann und wird die Aktenmehrheit und damit die Fabrik übernehmen. Freilich musste er nicht nur sein gesamtes Geldvermögen einsetzen, sondern auch seinen beträchtlichen Besitz verpfänden, um die erforderliche Summe aufzubringen. Platzt das Geschäft, ist Kings Ruf als erfolgreicher Manager dahin und er selbst finanziell ruiniert.
Genau jetzt schlagen die Kleinkriminellen Sy Barnard, Eddie Folsom und seine Ehefrau Kathy zu. Barnard will groß absahnen und plant die Entführung von Bobby, Kings achtjährigem Sohn. Er überredet Eddie mitzumachen, wozu dieser ohne Kathys Wissen bereit ist, denn 500.000 Dollar Lösegeld locken. Doch die unerfahrenen Kidnapper begehen einen kapitalen Fehler: Sie schnappen sich nicht Bobby, sondern Jeff, den Sohn von Kings Chauffeur Charles Reynolds.
Als sich der Schrecken legt, sieht Barnard keinen Grund, die Entführung abzubrechen. King soll für Jeff zahlen. Die Gangster sehen ihn in der Verpflichtung. Genauso geht es Kings Gattin Diane und den Polizisten vom 87. Revier, die mit dem Fall betraut wurden. Deshalb fallen die Beteiligten aus allen Wolken, als King sich weigert: Er kann und will seinen Traum vom Besitz der Schuhfabrik nicht aufgeben. Zwingen kann man ihn nicht, und dem moralischen Druck hält er Stand. Für Steve Carella und seine Kollegen herrscht Alarmstufe Rot. Die Kidnapper dürfen nicht erfahren, dass sie kein Geld bekommen werden. Ohnehin kommt es innerhalb der Bande zum Streit, denn Kathy ahnt, dass Barnard nicht vorhat, Jeff lebendig freizulassen …
_Ein Autor verschafft sich Freiraum_
Ed McBains Kriminalromane um das 87. Polizeirevier enthalten immer ein moralisches Element. In den frühen Werken war es – aus heutiger Sicht – noch recht deutlich und ein wenig aufdringlich. Später verpackte McBain seine Anliegen eleganter und wurde wohl auch ein wenig zynischer; gänzlich mochte er aber nicht auf die Moral von der Geschicht‘ verzichten. „Kings Lösegeld“ ist der 10. Roman um das genannte Revier – 54 wurden es insgesamt – und entstand 1959. Moral stand damals hoch im Kurs, wobei sich ein Gutteil Bigotterie in die Rechtschaffenheit mischte, mit der die braven Bürger auf jene hinabblickten, die ins Straucheln gerieten.
McBain machte da nicht mit. Allerdings war er kein ‚großer‘ Autor, sondern schrieb Unterhaltungsromane. Davon lebte er und musste sich deshalb mit seiner Kritik zurückhalten. Dass er seine Kriminalgeschichten nicht in einer realen Großstadt, sondern in einer fiktiven Metropole spielen ließ, war dabei hilfreich. Isola wurde zwar ein Spiegelbild von New York, doch hier war McBain Herr über seine eigene Welt. Was hier schief lief, musste der empfindliche Leser nicht auf die Realität ’seiner‘ USA beziehen.
|Der reiche Mann liebt sein Geld|
Denn McBain bot mit „Kings Lösegeld“ in mehrfacher Hinsicht durchaus harten Tobak. Da war vor allem die Kardinalfrage nach dem Wert eines Menschenlebens. McBain scheute nicht davor zurück, ein Kind in Lebensgefahr zu bringen. Unabhängig von der Zahlung des Lösegelds wird Jeff die Entführung nicht überleben. Daran lässt der Verfasser keinen Zweifel. Auf diese Weise schürt er die Spannung – wie kann Jeff gerettet werden? – und verschärft gleichzeitig die Gewissensqualen, in denen sich Douglas King windet.
McBain kennt kein Erbarmen. King muss Farbe bekennen. Ausflüchte werden ihm nicht gestattet. Wie würdest du dich entscheiden? Diese Frage stellt McBain auch seinen Lesern, was er geschickt mit der Handlung verknüpft. Als King seine Entscheidung fällt, unterwirft er sich nicht der gängigen Moral, sondern folgt seinem Egoismus. Dafür zahlt er einen hohen Preis: Seine Frau, sein Sohn und die Polizei verachten ihn. Reynolds, Jeffs Vater, demütigt sich in einer schwer erträglichen Szene und fleht seinen Chef an, das Geld zu zahlen. Er bleibt dabei der klägliche Wurm, als den ihn McBain charakterisierte, und King verliert noch den Rest seiner Integrität.
McBain schafft es, seine Leser verstehen zu lassen, wieso King ist, wie er ist bzw. wie er geschaffen wurde. King ist selbst ein Opfer. Seine Menschlichkeit hat er dem finanziellen und gesellschaftlichen Aufstieg geopfert. Angesicht der dabei erfahrenen Erniedrigungen ist es ihm unmöglich, das Erreichte aufs Spiel zu setzen.
|Die Kehrseite der Medaille|
Kidnapper rangieren in der Verbrecherwelt tief unten. Gewalt gegen Kinder sorgt sogar unter Kriminellen für Abscheu. Politisch korrekt hätte McBain Jeffs Entführer als Tiere in Menschengestalt schildern müssen. Solche plumpen Vereinfachungen erspart der Verfasser sich und seinem Publikum. Höchstens der brutale und zum Kindsmord bereite Sy Barnard scheint in diese Kategorie zu fallen, aber auch er überrascht im Finale mit unerwarteter und echter Emotionalität.
Im Zentrum stehen Eddie und Kathy Folsom. Eddie ist Douglas Kings dunkles Spiegelbild – ein Mann, der nach oben will, weil er es ganz unten nicht mehr aushält. Dabei treibt Folsom nicht reiner Eigennutz. Er will seiner Kathy ein Leben bieten, das sie ‚verdient‘. Sie war bisher problemlos einverstanden damit, dass er dies als Räuber und Dieb versuchte. Doch nun hat Eddie eine Grenze überschritten. Kathy muss ihren moralischen Status neu definieren. Sie wird aktiv, will Jeff, sich und Eddie retten. Dafür begibt sie sich notfalls selbst in Lebensgefahr.
„Kings Lösegeld“ endet versöhnlich aber nicht ‚happy‘. Das Schlimmste kann verhindert werden. Nicht alle Entführer enden im Gefängnis. Douglas King muss weder seinen finanziellen noch moralischen Bankrott erklären. Diane kann zu ihm und in ihr luxuriöses Heim zurückkehren – eine ironische Note, mit der McBain das Finale seiner Sentimentalität entkleidet. „King’s Ransom“ lautet der Originaltitel, den er seinem Roman gab. Dies bedeutet nicht nur „Kings Lösegeld“, sondern auch „Kings Erlösung“. Sie wird ihm zuteil, aber McBain lässt offen, ob er sie wirklich verdient hat. Zumindest die Polizisten des 87. Reviers sind da skeptisch.
|Männer des Gesetzes|
Sie sind zwar alle wieder dabei, spielen aber dennoch Nebenrollen und beschränken sich vor allem auf ihre Arbeit, die McBain, der Meister des „police procedural“, gewohnt penibel und trotzdem spannend beschreibt. Aus heutiger Sicht wirken die Methoden veraltet, aber im zeitgenössischen Rahmen funktionieren sie gut genug, um den Kidnappern auf die Spur zu kommen. Einmal mehr macht McBain deutlich, dass Polizisten keine maschinenhaften Vertreter von Law & Order, sondern Menschen sind. Steve Carella ist es dieses Mal, der keinen Hehl aus seiner Verachtung gegenüber King macht, bis er von einem Vorgesetzten zur Ordnung gerufen wird.
Was den Leser heute erstaunt, ist die Tatsache, dass offenbar niemand die geforderten 500.000 Dollar aufzubringen gedenkt, die Douglas King ausgeben soll. Lässt das Gesetz unvermögende Entführungsopfer völlig im Stich? Schießt keine Behörde dieses Geld vor? Leider geht McBain auf diesen Aspekt nicht ein. An der beachtlichen Leistung des Verfassers, der auf weniger als 180 Seiten schnörkelfrei und ohne Längen eine Vielzahl menschlicher Dramen durchspielt, ändert dies freilich nichts.
|Eine ungewöhnliche Verfilmung|
Vier Jahre nach der Veröffentlichung wurde „Kings Lösegeld“ verfilmt – allerdings nicht in den USA, sondern in Japan. Meisterregisseur Akira Kurosawa (1910-1998) faszinierte die Frage, ob der ‚Wert‘ eines Kindes am Vermögen des Vaters zu messen ist. Als |Tengoku to jigoku| (dt. |Zwischen Himmel und Hölle|) inszenierte er mit seinem Schauspieler-Favoriten Toshirō Mifune (1920-1997) eine 143 Minuten lange Mischung aus Krimi und Drama, die nicht zu Kurosawas Glanzleistungen gezählt wird, aber durch die für diesen Regisseur typischen urjapanischen und ‚westlichen‘ Film-Elemente das Beste beider Kino-Welten unterhaltsam vereint.
_Autor_
Ed McBain wurde als Salvatore Albert Lombino am 15. Oktober 1926 geboren. Dies war in den USA in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg kein Name, der einem ehrgeizigen Nachwuchsschriftsteller hilfreich gewesen wäre. Also ‚amerikanisierte‘ sich Lombino 1952 zu Evan Hunter und schrieb ‚richtige‘ Bücher, d. h. Literatur mit Botschaft und Anspruch, darüber hinaus Kinderbücher und Drehbücher.
Da sich der Erfolg in Grenzen hielt, wählte Vollprofi Hunter ein neues Pseudonym und verfasste als „Ed McBain“ den ersten der von Anfang an als Serie konzipierten Kriminalromane um das 87. Polizeirevier. Schnelles Geld sollten sie vor allem bringen und ohne großen Aufwand zu recherchieren sein. Deshalb ist Isola mehr oder weniger das Spiegelbild von New York, wo Lombino im italienischen Getto East Harlems groß wurde. Aber Hunter bzw. McBain kochte nicht einfach alte Erfolgsrezepte auf. Er schuf ein neues Konzept, ließ realistisch gezeichnete Polizisten im Team auf ‚richtigen‘ Straßen ihren Job erledigen. Das Subgenre „police procedural“ hat er nicht erfunden aber entscheidend geprägt.
1956 erschien „Cop Hater“ (dt. „Polizisten leben gefährlich“). Schnell kam der Erfolg und es folgten bis 2005 54 weitere Folgen dieser Serie, der McBain niemals überdrüssig wurde, obwohl er ’nebenher‘ weiter als Evan Hunter publizierte und als McBain die 13-teilige Serie um den Anwalt Matthew Hope verfasste. Mehr als 100 Romane umfasste das Gesamtwerk schließlich – solides Handwerk, oft genug Überdurchschnittliches, geradlinig und gern fast dokumentarisch in Szene gesetzt, immer lesenswert -, als der Verfasser am 6. Juli 2005 einem Krebsleiden erlag.
Taschenbuch: 173 Seiten
Originaltitel: King’s Ransom (New York : Simon & Schuster 1959)
Übersetzung: Gitta Bauer
Deutsche Erstausgabe: 1961 (Ullstein Verlag/Ullstein Kriminalroman 817)
[keine ISBN]
Bisher letzte Ausgabe: August 1994 (Ullstein Verlag/Ullstein Kriminalroman 10657)
ISBN-13: 978-3-548-10657-1
www.ullsteinverlage.de
www.edmcbain.com
Boothby, Guy Newell – Expedition des Doctor Nikola, Die
_Die |Doctor Nikola|-Reihe:_
Band 1: [„Die Rache des Doctor Nikola“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=6319
Band 2: _“Die Expedition des Doctor Nikola“_
Band 3: „The Lust of Hate“ (1898, noch ohne dt. Titel)
Band 4: „Dr Nikola’s Experiment“ (1899, noch ohne dt. Titel)
Band 5: „Farewell, Nikola“ (1901, noch ohne dt. Titel)
_Das geschieht:_
Nach zahlreichen Entführungen, Intrigen u. a. Bosheiten ist es Dr. Nikola endlich gelungen, das ersehnte chinesische Zauberstäbchen an sich zu bringen. Mit ihm kann er sich als hochrangiges Mitglied einer Geheimgesellschaft tarnen und als solches den Zugang zum tief im gebirgigen Zentrum Tibets gelegenen Tempel einer Sekte erschwindeln, die sich dort seit dem dritten vorchristlichen Jahrhundert verborgen hält. Im Laufe dieser langen Zeit haben die Mönche unglaubliche Mysterien aufgedeckt.
Nikola ist besonders am Geheimnis des ewigen Lebens interessiert. Die lange und gefährliche Expedition will er nicht ohne einen mutigen und starken Gefährten an seiner Seite unternehmen. Nikolas Wahl fällt auf den jungen Abenteurer Wilfried Bruce. Dieser ist bekannt für seine Fähigkeit, sich so überzeugend als Chinese zu maskieren, dass er Orte bereisen konnte, an die zuvor nie Europäer gelangt sind.
Derzeit hat Bruce nach Schanghai verschlagen, wo er nach einer Möglichkeit sucht, seine leere Geldbörse zu füllen. Die 10.000 Pfund, die Nikola ihm bietet, sind ihm daher sehr willkommen. Getarnt macht man sich auf den langen und gefährlichen Weg nach Tibet. Unterwegs rettet Bruce die Missionarstochter Gladys Mary Medwin vor fremdenfeindlichen Chinesen.
Auch sonst verläuft die ohnehin riskante Expedition nicht ohne gefährliche Zwischenfälle. Mehrfach kommt man den beiden Schwindlern auf die Schliche. Nur Nikolas unglaublichem Einfallsreichtum und Bruces Wagemut ist das Entkommen zu verdanken. Die Glückssträhne der Reisenden wird freilich über ihre Zerreißgrenze hinaus gespannt, als sie ihr Ziel erreichen. Tief im Himalaya und fern aller Hilfe müssen sie extrem misstrauischen Mönchen ihre Geheimnisse entreißen …
_Der Weg ist das Ziel: Reisen als Abenteuer_
1895 hatte Guy Newell Boothby mit „Die Rache des Doctor Nikola“ das Interesse einer Leserschar erregt, deren Zahl groß genug war, dass der Autor – ein Unterhaltungs-Routinier, der jedes Genre bediente – das Eisen schmiedete, solange es heiß blieb, und umgehend eine Fortsetzung folgen ließ. „Die Expedition des Doctor Nikola“ fand auf einem anderen Kontinent und mit anderen Figuren statt; nur Nikola blieb. Die Verbindung zum ersten Teil stellte Boothby her, indem er seinen neuen Helden Wilfried Bruce in Schanghai auf einen Landsmann treffen lässt, zu dessen Freunden ‚zufällig‘ jemand zählt, der Nikolas Treiben in Australien ertragen musste: Boothby nahm sich nie die Zeit für raffinierte Handlungselemente, sondern spann ein einfaches Garn. Dies bedingte einerseits einen offensichtlichen Schematismus, sorgte aber andererseits für eine Schlichtheit, die seine Geschichten altern (i. S. von reifen) aber nicht veralten ließ.
Die Reise ist ein ideales Medium für eine stringente Abenteuergeschichte. Es gilt, von Punkt A nach Punkt Z zu gelangen. Die Buchstaben dazwischen markieren Zwischen- und Überfälle, Naturkatastrophen und Irrwege, aber auch wundersame Orte, die durch ausführliche Beschreibungen gewürdigt werden. Der Weg ist mindestens ebenso wichtig wie das Ziel, das nichtsdestotrotz den Höhepunkt markiert. Boothby folgt dem Vorgabemuster perfekt. In Schanghai beginnt die Expedition, und die stattliche Entfernung zum tibetischen Zielkloster lässt Raum für die genannten und andere Verwicklungen, mit denen die Handlung verlängert wird, ohne dass dies auf Kosten der Spannung geht.
|Männer der Tat, Frauen fürs Herz|
Zwei Identifikationsfiguren stellt Boothby in den Mittelpunkt der Geschichte. Da ist natürlich Nikola, den er bereits im ersten Teil sehr geheimnisvoll eingeführt hatte. Seine Mysterien musste Nikola sich bewahren, weshalb Boothby wiederholte, abwandelte und vertiefte, was er in „Die Rache des Doctor Nikola“ bereits erwähnt hatte. Also glänzt Nikola abermals durch erstaunliche Hypnosen, ergeht sich in Andeutungen früherer (Un-) Taten und ist generell ein solcher Übermensch, dass sich der Leser durchaus wundert, wieso er eigentlich Hilfe benötigt.
Doch genau dies ist der Punkt: Nikola ist als Handlungsfigur nur bedingt tauglich. Er kann nicht kämpfen, leiden und Gefühle zeigen, ohne dadurch seinen Status zu gefährden. Nikola muss geheimnisvoll bleiben. Deshalb stellt ihm Boothby Wilfried Bruce an die Seite, der vor positiven Eigenschaften und edlen Gefühlen schier platzt. Bruce ist dem Mann, um den und mit dem wir bangen. Ihn mögen wir, ihm trauen wir. Er ist tüchtig, aber nicht so talentiert, dass wir uns ihm gegenüber klein fühlen. Ein Mann wie Bruce kann glaubhaft in Gefahr geraten, aus denen er sich mit Muskelkraft und Köpfchen und nicht mit Magie, Hinterlist und Geheimwaffen à la Nikola befreien wird. Er ist so anständig und worttreu, dass nicht einmal Nikola umhin kommt, ihn mehrfach zu retten, obwohl er ihn schurkisch hätte zurücklassen können.
Außerdem ist Bruce der Idealpartner für die weibliche Figur. Dass Nikola eine Missionarstochter oder überhaupt eine Frau an seiner Seite auch nur duldet, mutet unwahrscheinlich an. Zu Gladys Mary Medwin gehört ein Bruce. Er wird sie retten, beschützen und sich schließlich in sie verlieben. Boothby folgt den viktorianischen Vorgaben, die der Frau – zumal im Trivialroman – eine passive Rolle zuwiesen. Gladys mag es irgendwie nach China geschafft haben, doch sobald sie in Nikolas und Bruces Gesellschaft gerät, kann sie gerade noch auf eigenen Beinen stehen. Ansonsten übernehmen die Männer das Denken und Handeln.
Erfreulicherweise beeinträchtigt dieses Klischee nicht die Handlung. Was in „Die Rache des Doctor Nikola“ noch für endlose Kitsch-Tiraden gesorgt hatte, entfällt dieses Mal: Gladys bleibt eine absolute Randfigur. Hin und wieder denkt Bruce sehnsuchtsvoll an sie, aber ansonsten konzentriert er sich auf das Abenteuer. Hier einfallsreich in eine aktionsreiche Handlung zu investieren, erweist sich als die beste Idee des Verfassers.
|Exotik und die Patina der Reife|
Realität ist dabei Boothbys Stärke nicht. Dem eifrigen Leser trivialer Romane ist so etwas seit jeher bewusst; es stört nicht, sondern fördert sogar das Lektürevergnügen: Die gern (auch vom jeweiligen Verfasser) vorgebrachte Behauptung präziser Faktenrecherche ist Unfug – glücklicherweise, denn die Unterhaltung existiert zwar auch auf dem Boden der Realität, so richtig blüht sie aber erst im milden Klima der Fiktion.
Guy Newell Boothby ist niemals in China gewesen. Die Schilderung von Land und Leuten entsprechen höchstens zufällig der Wirklichkeit. Seine wahren Inspirationsquellen bildeten jene zeitgenössischen Halbwahrheiten, Übertreibungen und Klischees, die in den Kreisen seines angelsächsischen Publikums kursierten. Sie klangen immerhin wahr und waren auf jeden Fall interessanter als die schnöde Realität, die auch die tatsächlich existierenden Himalaja-Klöster Tibets nicht verschont und ihnen bei genauer Betrachtung den Ruf des Mysteriösen raubt.
Boothbys China und Tibet sind bunte Kulissen für die Abenteuer eines Reiseromans. Die zentralen Protagonisten sind Ausländer, weder Dr. Nikola noch Wilfried Bruce wurden in Asien geboren. Dennoch gebärden sie sich – wenn nicht verkleidet – ganz selbstverständlich als Herren des Landes. Zumindest in diesem Punkt entspricht Boothby einer historischen Realität, die den Fernen Osten ins Interesse europäischer Kolonialmächte rückte. China war keine offizielle Kolonie, doch Ende des 19. Jahrhunderts nach verlorenen Kriegen gegen England und Japan sowie innenpolitisch geschwächt den ausländischen ‚Handelspartnern‘ ausgeliefert.
|Zeitloses Abenteuer nach Genre-Regeln|
Diese unschönen Wahrheiten werden selbstverständlich wortlos übergangen. Immerhin hält sich Boothby mit diskriminierenden Äußerungen zurück. (Wobei offenbleiben muss, was in der Übersetzung bzw. Bearbeitung eventuell getilgt wurde.) Er setzt auf die Exotik der Schauplätze. ‚Seine‘ Chinesen und Tibeter sind fremd und unheimlich aber Träger einer eigenständigen, uralten und – Boothby macht daraus keinen Hehl – durchaus hochstehenden Zivilisation. Er bedient sich hier eines weiteren bewährten Motivs des klassischen Abenteuerromans. Tief in grauer Vorzeit verwurzelte, von der Gegenwart isolierte Gemeinschaften, die im Besitz lange vergessenen Geheimwissens sind, waren in der zeitgenössischen Unterhaltungsliteratur ungemein beliebt. Autoren wie Henry Rider Haggard (1856-1925) oder Edgar Rice Burroughs (1875-1950) stützten sich immer wieder auf archaische Ur-Völker. In der Schilderung seltsamer und unterhaltsam ‚barbarischer‘ Regeln und Sitten mussten die Autoren ihrer Fantasie keine Zügel anlegen.
In diesen Kapiteln kann Boothby glänzen. Das Finale endet – auch dies genretypisch – in einer wilden Flucht vor erbosten Verfolgern. Dieses Mal ließ der Verfasser seiner Geschichte mit Bedacht einige lose Enden: Sie ließ sich bei Bedarf fortsetzen, was 1899 mit „Das Experiment des Doctor Nikola“ geschah.
In Deutschland erschien „Die Expedition des Doctor Nikola“ erstmals 1912. Selbst vom antiquarischen Buchmarkt ist dieses Werk längst verschwunden. Die aktuelle Ausgabe, Teil einer vierbändigen, neu oder erstmals aufgelegten sowie neu übersetzten Doctor-Nikola-Ausgabe, liest sich angemessen ‚retro-steif‘ aber stets flüssig und ist wieder schön als Paperback mit Klappenbroschur aufgemacht. Auf den dritten Teil kann man sich unter diesen Bedingungen erst recht freuen!
_Autor_
Am 13. Oktober 1867 wurde Guy Newell Boothby im australischen Glen Osmond, einer Vorstadt von Adelaide, geboren. Die Boothbys gehörten zur Oberschicht, Guys Vater saß im Parlament von Südaustralien. Der Sohn besuchte von 1874 bis 1883 die Schule im englischen Salisbury, dem Geburtsort seiner Mutter.
Nach Australien zurückgekehrt, versuchte sich Boothby als Theaterautor. Sein Geld verdiente er allerdings als Sekretär des Bürgermeisters von Adelaide. Beide Tätigkeiten wurden nicht von Erfolg gekrönt. Boothbys Lehr- und Wanderjahre führten ihn 1891/92 kreuz und quer durch Australien sowie den südasiatischen Inselraum. Sein 1894 veröffentlichter Reisebericht wurde zum Start einer außergewöhnlichen Schriftstellerkarriere.
1895 siedelte Boothby nach England um, heiratete und gründete eine Familie. Er schrieb nun Romane, wobei er sämtliche Genres der Unterhaltungsliteratur bediente und lieferte, was ein möglichst breites Publikum wünschte. Boothby war ein findiger und fleißiger Autor, der überaus ökonomisch arbeitete, indem er seine Worte nicht niederschrieb, sondern in einen Phonographen diktierte und die so besprochenen Wachswalzen von einer Sekretärin in Reinschrift bringen ließ. Jährlich konnten auf diese Weise durchschnittlich fünf Titel erscheinen. Boothbys Einkünfte ermöglichten ihm den Kauf eines Herrenhauses an der Südküste Englands, in dem er mit seiner Familie lebte, bis er am 26. Februar 1905 im Alter von nur 37 Jahren an einer Lungenentzündung starb.
|Paperback: 213 Seiten
Originaltitel: Dr. Nikola (London : Ward, Lock & Co. 1896)
Übersetzung: Michael Böhnhardt
Cover: Ernst Wurdack
ISBN-13: 978-3-938065-63-1|
[doctornikola.blogspot.com]http://doctornikola.blogspot.com
[www.wurdackverlag.de]http://www.wurdackverlag.de
_Guy Newell Boothby bei |Buchwurm.info|:_
[„Pharos der Ägypter“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=297
Hill, Joe – Teufelszeug
_Das geschieht:_
Vor einem Jahr ist das Leben von Ignatius Martin Perrish endgültig aus den Fugen geraten. Ohnehin das schwarze Schaf seiner Familie und im Gegensatz zum erfolgreichen Vater und berühmten Bruder beruflich erfolglos, wurde damals Merrin Williams, die Liebe seines Lebens, brutal ermordet aufgefunden. Weil sie sich an jenem Abend im Streit von Ig getrennt hatte, was viele Zeugen bestätigten, nahm die Polizei Ig als Täter fest. Die Beweiskette hielt jedoch nicht stand, und er kam auf freien Fuß. In seiner kleinen Heimatstadt im US-Staat Maine gilt Ig als nichtsdestotrotz als Mörder, der durch die Maschen des Gesetzes schlüpfen konnte. Die Polizei schurigelt, die Bürger meiden und verachten ihn. Sogar Lee Tourneau, Igs bester Freund seit Kindertagen, hat sich abgewendet; er wurde vom Alkohol ersetzt, dem Ig schon lange zu heftig zuspricht.
An die aktuelle Saufnacht kann sich Ig überhaupt nicht erinnern. Sie muss aber spektakulär gewesen sein, denn am Morgen sind ihm zwei Teufelshörner aus der Stirn gewachsen. Erschrocken bittet er seine Familie um Hilfe – und muss hören, dass ihn die Eltern ebenfalls für einen Mörder halten und sich seiner schämen: Wer sich dem gehörnten Ig nähert, unterliegt dem Zwang, ihn rückhaltlos in jedes intime Geheimnis einzuweihen. Bruder Terry gesteht ihm, in den Mord an Merrin verwickelt zu sein. Lee Tourneau hatte sie ermordet und die Indizien so manipuliert, dass Terry als Mittäter dagestanden hätte. In seiner Not hatte dieser Lee dabei geholfen, stattdessen Ig ans Messer zu liefern.
Der will Vergeltung. Aber die Macht der Hörner versagt bei Lee, der ihm stattdessen seinen Bodyguard Eric auf den Hals hetzt. Ig muss sich einen Plan ausdenken. Als Rächer ist er freilich denkbar untauglich. Er lotet seine neuen Fähigkeiten aus und entdeckt dabei interessante Möglichkeiten. Allerdings bleibt Lee, der sich als lupenreiner Soziopath entpuppt, inzwischen nicht untätig …
_Weiter nach unten geht immer!_
Die Geburt eines Höllenfürsten stellt man sich anders vor. Dass sich ausgerechnet der Nobody Ig Perrish in einen Teufel verwandelt, der darüber hinaus genauso aussieht, wie er in Kinderbibeln oder Comics abgebildet ist – rothäutig, gehörnt und mit Spitzbart -, stellt die satanische Mutation bereits in Frage. In der Tat ist und bleibt Ig auch in seiner neuen Inkarnation, was er als Mensch gewesen ist: ein armer Teufel.
Dies muss und sollte der Leser berücksichtigen, da sonst eine böse Überraschung droht: „Teufelszeug“ ist kein klassischer Horror-Roman und Ig alles andere als eine übermenschliche Gestalt, die entsprechende (Un-) Taten begeht. Ig ist ein Opfer, das meist reagiert. Versucht er zu agieren, geht dies in der Regel schief. Ig will auch kein Dämon sein, und als er versucht, seine neu gewonnenen Fähigkeiten trotzdem so einzusetzen, wie er es seinem teuflischen Äußeren schuldig zu sein glaubt, scheitert er kläglich: Ig ist auf den eigenen Mythos hereingefallen.
Die Verwandlung ist nur Station auf Igs Höllenfahrt durch das Finale des eigenen Lebens. Für ihn gibt es weder Rettung noch Wiederkehr. Dazu gibt es eine dreiteilige Vorgeschichte, der Autor Joe Hill viele Seiten widmet. „Teufelszeug“ erzählt von einer Freundschaft, die sich als schrecklicher Irrtum herausstellt, von einer Beziehung, deren wahre Tragik nicht in ihrem durch Mord begründeten Ende liegt, und von zwei Brüdern, die auf ungewöhnliche Weise wieder zueinanderfinden.
|Was möchte uns der Verfasser sagen?|
Der Literaturkritiker liest solche Worte mit Wohlgefallen. Ihm ist blanker Horror zu trivial, zu unterhaltsam; es fehlt ihm die Raffinesse, die den wahren Schrecken zumindest in seiner gedruckten Form auszeichnen sollte. Der weniger elitär eingestellte Leser denkt da oft anders, und ihm bleibt dabei ein Pfund, mit dem er argumentativ wuchern kann: Der literarische Schrecken ist oft denkbar langweilig.
Joe Hill ist kein Literat. Er versucht einfach, die tief ausgefahrenen Geleise des Horror-Genres zu vermeiden. In gewisser Weise gelingt ihm das. „Teufelszeug“ ist eben nicht die viel zu bekannte Story vom übernatürlich aufgepeppten Rachefeldzug eines Underdogs, dem das Schicksal die Kraft gegeben hat, es seinen Peinigern endlich zu zeigen.
In diesem Zusammenhang muss der Leser auf eine detailreiche Erklärung der Ereignisse verzichten. Hill begnügt sich mit Andeutungen, die der Leser selbst entschlüsseln kann (aber nicht muss). So gibt sich ein „L. Morgenstern“ als Erbauer des „magischen Baumhauses“ zu erkennen, das sich als Schnittpunkt zwischen den Zeiten herausstellt. In der Bibel wird der Morgenstern (= der Planet Venus) mehrfach „Luzifer“ (= „Lichtbringer“) genannt. Offenbar hat sich Satan nach seinem Himmelssturz einen gewissen Humor erhalten, denn es ist doch wohl er, der hinter Igs Metamorphose steckt. Wieso es dazu kam, bleibt indes offen.
|Das Rückgrat des Dackels|
Der Auftakt dieser Geschichte ist gut, und sie mündet in ein spektakuläres Finale, das auch den Horror-Puristen zufriedenstellen dürfte. Dazwischen gibt es leider viel Leerlauf. Wie Sheriff Kane in „12 Uhr mittags“ läuft Ig durch seine Heimatstadt und bittet um Hilfe. Stattdessen stößt er auf Ablehnung und offenen Hass, während Lee Tourneau, sein Todfeind, unerbittlich näher rückt. Ig muss sich ihm schließlich allein stellen, aber hier bleibt Hill dem Vorbild treu und bringt eine versöhnliche Note ein.
Bis es soweit ist, wiederholen sich die Ereignisse. Igs Versuche, die neue Persönlichkeit zu ergründen, treten auf der Stelle. Zahlreiche Rückblenden in die Vergangenheiten der Figuren tragen ebenfalls nichts zur Dynamik bei. Was Hill dort dramatisch aufblättert, hat er zuvor so gut skizziert, dass eine ausführliche Nacherzählung bloß überflüssige Wiederholungen bietet. Im Mittelteil hängt die Story dadurch spürbar durch. Als Novelle wäre „Teufelszeug“ vielleicht besser geraten.
|Pechvogel, Psychopath, Idealgefährtin & Bruderfreund|
Eine gewisse Ratlosigkeit hinterlässt Hills Figurenwahl und -zeichnung. Ig ist der reine Tor, dessen Sturz in den Abgrund auch zum Prozess einer Läuterung wird. Wirklich warm wird der Leser mit ihm jedoch nicht. Möglicherweise ist Hill zu erfolgreich in der Erschaffung einer Person gewesen, in deren Hirnschädel es nicht sonderlich hell leuchtet. Ig hatte seine Merrin, die ihn wohl so gut erdete, wie dies überhaupt möglich war. Besonders helle war sie allerdings ebenfalls nicht. Wie sonst hätte ihr entgehen können, dass ein Muster-Psychopath in ihrer direkten Nachbarschaft aufwuchs?
Wie ein dämonischer Bruder von Hannibal Lecter wirkt dieser Lee Tourneau übrigens nicht. Tatsächlich verdankt er sein erfolgreiches Wirken vor allem der kollektiven Hohlköpfigkeit seiner Mitbürger, denen der Riss in Lees Hirnwaffel unbemerkt bleibt. Ig, Merrin und Terry sind in dieses harsche Urteil ausdrücklich eingeschlossen: Nie haben sie nach Hill bemerkt, dass Lee der schönen Merrin ungesund und überhaupt hinterher gierte. Die überzeichnet Hill ohnehin kontraproduktiv als einen eher langweiligen Engel auf Erden, dem der Leser keine besonders freundlichen Gefühle entgegenbringt.
In einem Punkt kann Hill überzeugen: Zur Dummheit gesellt sich gern die Ignoranz. Niemand außer Lee und Terry hält Ig für unschuldig. Nicht einmal oder gerade die Polizei lässt sich durch die Beweislage eines Besseren belehren. Ig ist der ideale Sündenbock. Freudig nutzt man die Gelegenheiten, die sich aus dem sozialen Mobbing ergeben können: Das eigene kümmerliche Leben lässt sich aufwerten, indem man die noch Schwächeren mit Füßen tritt.
|Absturz mit Netz und doppeltem Boden|
Trotz der phantastischen Elemente bleibt „Teufelszeug“ ein konventioneller Unterhaltungsroman US-amerikanischer Prägung. So hart die Nackenschläge die Hauptfigur auch treffen, wirklich zu Boden geht sie nicht, und in totaler Niederlage mag Hill seinen Roman erst recht nicht enden lassen. Ig wird zusammengeschlagen und niedergeschossen, aber als ihm seine Widersacher den Gnadenstoß geben wollen, springt plötzlich Bruder Terry aus dem Gebüsch, lenkt die Strolche ab und gibt Ig die notwendigen Sekunden, in denen er sich verpusten, die Reste seiner Zurückhaltung abstreifen und endlich mit Gewalt zurückschlagen kann.
Terry war bisher nur Randfigur, und seine plötzlich hell auflodernde Bruderliebe nimmt man ihm nicht ab. Hill benötigt ihn, weil er Ig ohne eindeutige Erläuterungen aus der Handlung nimmt. Doch was wird aus dem nun endgültig geschlüpften Jung-Teufel? Die Frage ist berechtigt. Sie stellte Hill vor eine Herausforderung, der er sich nicht stellen mochte. Stattdessen begnügt er sich mit Andeutungen und lässt seine Geschichte mit einer langen, versöhnlichen, sehr banalen Coda ausklingen. Was immer uns Joe Hill mit „Teufelszeug“ sagen wollte, hat er handwerklich gut, aber nicht besonders stringent oder konsequent umgesetzt.
_Autor_
Joe Hill (eigentlich: Joseph Hillstrom King) wurde 1972 als zweiter Sohn der Schriftsteller Stephen und Tabitha King in Bangor (US-Staat Maine) geboren. Ende der 1990 Jahre begann er selbst zu schreiben. Sein Pseudonym wurde spätestens dann publicitywirksam enthüllt, als er 2007 mit „Heart-Shaped Box“ (dt. „Blind“) seinen ersten Roman, veröffentlichte, der solche flankierende Werbung durchaus gebrauchen konnte.
Dass Hill über eine eigene Stimme verfügen und ideenreich plotten kann, wenn er möchte, belegte er schon zwei Jahre früher mit der Storysammlung „20th Century Ghosts“ (dt. „Black Box“), für die er diverse Preise gewann (die allerdings im Literaturbetrieb recht inflationär ins Leben gerufen werden).
Über sein Werk berichtet Joe Hill, der mit seiner Familie in New Hamphire lebt, auf seiner Website. Dort findet man u. a. ein neckisches Online-Game namens „The Museum of Silence“, das auf der „Black-Box“-Story „Ein letzter Atemzug“ basiert und zur Zuordnung terminaler Schnaufer prominenter Persönlichkeiten auffordert.
|Gebunden: 544 Seiten
Originaltitel: Horns (New York : William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers 2010)
Übersetzung: Hannes Riffel
ISBN-13: 978-3-453-26561-5|
[www.randomhouse.de/heyne]http://www.randomhouse.de/heyne
[joehillfiction.com]http://joehillfiction.com
_Joe Hill bei |Buchwurm.info|:_
[„Blind“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=3842
[„Black Box“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=4539
Carter Dickson (= John Dickson Carr) – Hinter den Kulissen

Carter Dickson (= John Dickson Carr) – Hinter den Kulissen weiterlesen
Weinstein, Zeus – umfassende Sherlock Holmes Handbuch, Das
_Inhalt:_
Sechs Kapitel und ein Anhang führen in die Welt des Meisterdetektivs Sherlock Holmes ein:
Dessen Geschichte(n) ist bzw. sind nicht ohne seinen Freund, Begleiter und Chronisten Dr. John H. Watson denkbar, weshalb dieses Handbuch mit „Mr. Holmes und Dr. Watson“, dem „Portrait einer Freundschaft“ (S. 7-40) einsetzt. Michael (1924-1991) und Mollie (1916-2003) Hardwick, ausgewiesene Holmes-Experten und Verfasser zahlreicher Holmes-Pastiches, zeichnen in ihrem 1962 entstandenen Text das oft missverstandene Verhältnis der beiden Männer nach. Sie arbeiten Watsons unverzichtbare Gegenwart und keinesfalls zu unterschätzende Funktion heraus und illustrieren dies durch zahlreiche Zitate aus den Holmes-Romanen und Kurzgeschichten.
Herausgeber Zeus Weinstein erinnert in „Kleine Conan Doyle Chronik“ (S. 41-68) an den geistigen Vater von Holmes & Watson. Dabei beschränkt er sich nicht auf Doyle als (einen) Vater der modernen Kriminalliteratur, sondern macht deutlich, dass Holmes nur den kleinen Teil eines privat wie literarisch ereignisreichen Lebens darstellt.
Wieder das Ehepaar Hardwick präsentiert ein „Who ’s Who“ (S. 69-120) jener Klienten, Bösewichte, Opfer und anderer Figuren, die in den Romanen und Storys auftreten. Einer kurzen ‚Biografie‘ – falls möglich – folgt ein auf die Einzelperson bezogenes Zitat aus dem genannten Werkskanon. Wichtige Figuren wie Mycroft Holmes, Professor Moriarty oder Sebastian Moran werden zusätzlich in Zeichnungen sichtbar, die u. a. Sidney Paget, der berühmteste Illustrator der Holmes-Geschichten, zwischen 1891 und 1905 geschaffen hat.
Es folgen, erneut niedergeschrieben von den Hardwicks, „Die Plots aller Stories“ (S. 121-166); hinzu kommen Handlungsskizzen der vier Romane. Der Titel trifft (erfreulicherweise) nicht ganz zu, da die beiden Verfasser die eigentliche Auflösung jeweils verschweigen, um noch Holmes-unkundigen Lesern das Vergnügen zu bewahren.
Im Kapitel „Sherlock Holmes in Kontur“ (S. 167-194) erläutert Zeus Weinstein, wie das Holmes-Bild durch die Illustrationen der frühen Zeitschriften- und Buchausgaben entscheidend mitgeprägt wurde; so ist der berühmte „Deerstalker“ eine Erfindung von Sidney Paget (1860-1908), der auch die Physiognomie des berühmten Detektivs formte, die Frederic Dorr Steele (1873-1944) in den US-amerikanischen Ausgaben der Holmes-Storys zur Vollendung brachte.
Die weiterhin ungebrochene Präsenz der Holmes-Figur im 21. Jahrhundert ist nicht nur der Qualität der Geschichten, sondern auch ihrer Medientauglichkeit zu verdanken. Zeus Weinstein beschränkt sich auf „Sherlock Holmes im Kino“ (S. 195-245) und greift interessante und kuriose Beispiele aus mehr als einem Jahrhundert Holmes in Film und Fernsehen heraus. (Die ursprünglich 1987 endende Liste wurde von Michael Ross bis 2009 fortgesetzt.)
Am Ende des Handbuches steht ein Kartenanhang. Er zeigt zeitgenössische Karten, in die jene Stätten eingetragen wurden, an denen Holmes und Watson ermittelten, sowie zwei Grundrisse der Wohnung Baker Street 221b. Das Handbuch schließt mit einer „Kleine(n) Bibliographie der Doyle-Erstausgaben“ sowie einem Literatur- und Bildnachweis.
_Interessante Fakten für Holmes-Nichtkenner_
In den 1980er Jahren erschien im (inzwischen eingegangenen) Haffmans Verlag jene neunbändige Ausgabe der vier Romane und 56 Kurzgeschichten, die den klassischen Sherlock-Holmes-Kanon bilden. Zu diesen Büchern, die wohl jeder ‚richtige‘ Holmes-Fan besitzt, hütet (und immer wieder liest), gab es 1984 zwei „Sherlock Holmes Companions“, in denen Zeus Weinstein Hintergrundinformationen zusammenstellte.
Diese „Companions“ wurden 1988 zum „Sherlock Holmes Handbuch“ zusammengefasst. Als 2009 die Haffmans-Ausgabe im Verlag Kein & Aber aufgelegt wurde, erlebte auch der Begleitband seine Neuausgabe. Während sich die Holmes-Aficianados mit Recht über die wohlfeile Wiederkehr der Romane und Story-Bände freuen dürfen, hält sich die Begeisterung über das „Handbuch“ in Grenzen.
Darüber wird weiter unten ausführlich zu berichten sein. Beginnen wir mit den positiven Aspekten: Das doppelte ‚Psychogramm‘ des Duos Holmes & Watson ist eine wunderbare Einleitung, weil inhaltlich kenntnisreich und liebevoll im Stil der ursprünglichen Geschichten formuliert. Kein anderer Text im „Handbuch“ erreicht diese Qualität nur annähernd. Zumindest im Faktengehalt kommt ihm „Sherlock Holmes in Kontur“ nahe. Mit guten Beispielen belegt Herausgeber Weinstein, dass der Kultfaktor der Holmes-Figur sich aus vielen Quellen speist. Es brauchte den ‚richtigen‘ Künstler, um Holmes ein Gesicht zu geben, das Gefallen bei den Lesern fand und sich ins kollektive Gedächtnis ganzer Generationen verankerte.
|Handbuch ohne Aktualität|
Mit einem Fragezeichen muss man die ‚lexikalischen‘ Kapitel versehen. Ist eine Sammlung sämtlicher Story-Plots wirklich hilfreich? Kurz und knapp kann Holmes nicht wirken, und so kompliziert ist die Handlung einer Holmes-Story nicht, dass ihr Plot aufgedröselt werden müsste. Noch ratloser macht das Personenverzeichnis. Wen interessiert, dass Windigate der Wirt des „Alpha Inn“ in der Geschichte „Der blaue Karfunkel“ ist? Man muss es nicht vor der Lektüre dieser Story wissen, und anschließend ist es ebenso unwichtig. Wieso also keine Beschränkung auf zentrale Figuren, über die es echte Hintergrundinformationen gibt?
Während der Rezensent diesen Standpunkt für diskussionswürdig hält, ist er seiner folgenden Negativkritik sehr sicher. Ein „Handbuch“ muss und kann nicht sämtliche Aspekte eines Themas erfassen. Es sollte aber aktuell sein. Informationen altern nicht nur, sie verändern sich im Lauf der Zeit. Ein Vierteljahrhundert ist auch für Sherlock Holmes eine lange Zeit. Obwohl tief in London der viktorianischen Epoche verwurzelt, ist Holmes längst über seine Vergangenheit hinausgewachsen und hat sich zu einem gegenwärtigen und präsenten Multimedia-Phänomen entwickelt.
Davon erfährt man im „Handbuch“ leider wenig bis nichts. Es wurde für seine Neu-Inkarnation angeblich überarbeitet. Falls überhaupt, merkt man ihm dies nur im Kapitel „Sherlock Holmes im Kino“ an; es wäre in der Tat zu peinlich geworden, den „Sherlock Holmes“-Blockbuster des Kinojahres 2009 unerwähnt zu lassen.
|Lücken und Fehler|
Was ist mit den Holmes-Pastiches, d. h. den Romanen und Geschichten, die nach dem Tod von Conan Doyle geschrieben wurden? Sie stellen inzwischen eine üppig mit Titeln gepolsterte Genre-Nische der Kriminalliteratur dar. Nur beiläufig wird William Gilette erwähnt, der für einen Sherlock Holmes im Theater steht, in dem er ebenso präsent war und ist wie im Film. Gänzlich unerwähnt bleibt der digitale Holmes, der längst seine Fälle auch im Video-Game löst. Diese Lücken stehen beispielhaft für Fehlstellen, die sich ein Handbuch nicht leisten darf, das sich nicht auf den literarischen Sherlock Holmes des Conan Doyle – d. h. auf die Jahre bis 1930 – beschränkt.
Nicht verantwortlich ist der Verfasser bzw. Herausgeber für die mindere Qualität des gedruckten „Handbuchs“ zu machen. Es wurde offenbar vom Original gescannt, was prinzipiell praktikabel ist und ansehnliche Ergebnisse zeitigt. Dies gilt selbstverständlich nur, wenn die Vorlage kopierwürdig ist. Auf den Text trifft dies zu. Die Bildwiedergabe ist dagegen schauderhaft. Aus heutiger Sicht war sie dies schon 1985. Damals waren die technischen Möglichkeiten beschränkt. Heute gilt dies nicht mehr. Auch die besten Scanner müssen jedoch aufgeben, wenn die Vorlage nichts taugt. Das „Handbuch“ bietet zahlreiche Illustrationen. Man könnte meinen, dass die verschwommene, unterbelichtete Darstellung auf die alten Magazin- und Buch-Abbildungen zurückgeht. Dem ist nicht so; so lässt sich im Internet – ein weiteres Medium, in dem Sherlock Holmes heute omnipräsent ist, während es im „Handbuch“ ausgeklammert bleibt – problemlos nachprüfen, wie präzise und klar beispielsweise Sidney Paget gezeichnet hat.
Zeitgenössische Fotos von Conan Doyle oder Ausschnittbilder aus Sherlock-Holmes-Filmen mögen ’nur‘ schwarzweiß sein; an ihrer Schärfe gibt es nichts auszusetzen. Man darf aber nicht eine bereits minderwertige Kopiervorlage einfach noch einmal kopieren – oder sie zusätzlich auf Streichholzschachtelformat verkleinern, wonach vom Porträt des Sebastian Moran auf S. 99 nur noch ein tintenschwarzes Rechteck bleibt.
Verzichten müssen die Leser auf die Seiten 156 und 178; statt ihrer wurden die Seiten 56 bzw. 78 doppelt einmontiert. Angesichts des durchaus stolzen Preises ist dies ein weiteres Ärgernis, das zur Ablehnung eines ursprünglich nützlichen, nun jedoch veralteten Handbuchs beiträgt: Diese Chance wurde vertan!
_Autor_
Zeus Weinstein ist ein Pseudonym des Karikaturisten und Schriftstellers Peter Neugebauer. Geboren am 14. Februar 1929 in Hamburg, besuchte er 1948/49 die Werbefachschule Hamburg und studierte zwischen 1951 und 1954 freie Grafik an der Hochschule für bildende Künste ebendort.
Neugebauers berufliche Karriere fand vor allem in der Zeitschrift „Stern“ statt. Hier erschienen bereits 1950 Illustrationen und Karikaturen. 1958 wurde Neugebauer fester Mitarbeiter des „Stern“. Im folgenden Jahr erschien hier die erste Folge von „Zeus Weinsteins Abenteuer“: Ein an Sherlock Holmes angelehnter Detektiv übernimmt Fälle, die er mit allen Indizien vorstellt. Die Auflösung bleibt offen bzw. wird den mitratenden Lesern überlassen. Die ungemein beliebte, von Neugebauer selbst illustrierte Serie wurde bis 1987 fortgesetzt.
Im Zuge der Arbeit an den Zeus-Weinstein-Fällen entwickelte sich Neugebauer zum veritablen Sherlock-Holmes-Experten. 1978 schrieb er ein eigenes Holmes-Abenteuer. Zur neunbändigen Neuausgabe der Holmes-Romane und -Erzählungen im Haffmans-Verlag verfasste er ein begleitendes Handbuch.
|Gebunden: 246 [+ XVIII] Seiten
ISBN-13: 978-3-03-695538-4|
[www.zeusweinstein.de/Abenteuer.html]http://www.zeusweinstein.de/Abenteuer.html
[www.keinundaber.ch]http://www.keinundaber.ch
Ian Fleming – James Bond 007: Goldfinger

Ian Fleming – James Bond 007: Goldfinger weiterlesen
Battles, Brett – Profi, Der
_Das geschieht:_
Jonathan Quinn ist ein „Cleaner“ im Agentenmilieu. Für seine Auftraggeber untersucht er geplante Treffpunkte, organisiert Überwachungen oder ‚reinigt‘ Tatorte von entlarvenden Indizien. Er ist nie neugierig und will nur das Notwendige über einen Job wissen, weshalb er sich länger gehalten hat als viele Kollegen. In letzter Zeit arbeitet Quinn exklusiv für das „Office“, das – vielleicht – dem US-Geheimdienst angegliedert ist. Leiter Peter schickt ihn ins winterliche Colorado, wo Quinn den Tod von Robert Taggert untersuchen soll, der offenbar beim Brand seines Ferienhauses umkam.
Quinn hegt Zweifel, die sich verstärken, als er im Kofferraum von Taggerts Wagen die Leiche einer „Office“-Kurierfrau findet. Dennoch kehrt er auf Peters Wunsch nach Los Angeles zurück, um auf weitere Anweisungen zu warten. In seinem Haus wird Quinn schon in der folgenden Nacht vom Cleaner Gibson überfallen, der sich als Killer Geld dazuverdienen möchte: Auf Quinn wurde ein Kopfgeld ausgesetzt. Da Gibson seine Attacke nicht überlebt, bleibt Quinn ratlos zurück.
Kurz darauf werden die Agenten des „Office“ systematisch ausgelöscht. Nur Peter bleibt verschont. Quinn flüchtet mit seinem ‚Lehrling‘ Nate nach Saigon. Dort lebt seine alte Freundin Orlando, der allein er noch vertraut. Ebenfalls auf seiner Seite ist anscheinend Cleaner Duke, der Quinn bittet, ihn bei einem Überwachungsauftrag in Berlin zu unterstützen. Quinn wittert eine Falle, sagt aber zu.
Noch in Vietnam ermittelt Quinn den serbischen Kriegsverbrecher, Psychopathen und Mietkiller Borko als möglichen Mann hinter den Anschlägen. Auf den trifft er in Berlin, wo er wie befürchtet in eine Falle läuft. Erneut kann Quinn entkommen, aber Orlando und Nate wurden offenbar von Borko gefangen, weshalb der einsame Cleaner sein beachtliches Fachwissen einsetzen muss, um sich und seine Gefährten zu retten …
_Parallelwelt im Zwielicht_
Niedergeschriebene Gesetze sollen Ordnung in den komplexen und komplizierten Alltag des zwischenmenschlichen Zusammenlebens bringen. Allerdings halten sich die Bösewichter dieser Welt nicht an diese Regeln, während die Gutmenschen, die sich gegen solche Spielverderber durchaus zur Wehr setzen dürfen, bei deren Verfolgung besagte Gesetze beachten müssen. Das ist natürlich schwierig und unfair, weshalb die Guten sich seit jeher Gedanken darüber machen, wie man – selbstverständlich nur zum im Dienst der gerechten Sache – diese lästigen Gesetze umgehen kann.
Die Lösung an sich ist einfach: Man gründet einen „Geheimdienst“ und entzieht dessen Aktivitäten der Kontrolle der Justiz, so gut es geht. Unter diesem Gesetzmantel darf zwar eigentlich dennoch nicht getrickst, gefoltert oder gemordet werden, aber hier wandelt jeder Geheimdienst ein altehrwürdiges Sprichwort so ab: „Was du nicht weißt, macht dich nicht heiß“. Solange man sowohl den eigentlichen Gegner (= Schurkenstaat, Mafia, Schmuggelring) als auch die Justiz, die Medien u. a. lästige Gutmenschen mit Foto-Handys in Schach hält, kann man schalten und walten, wie man will.
Verschwiegenheit und Heimlichtuerei gehen im Agentenmilieu deshalb nicht nur arbeitstechnisch nahtlos ineinander über. Wer beide Künste beherrscht und sich zudem keine Illusionen über die Loyalität seines Arbeitgebers macht, kann gut abkassieren. Ob Geheimdienste freiberufliche Agenten anheuern, so wie Söldner sich für Gefechtsaktionen werben lassen, entzieht sich meiner Kenntnis; es ist auch unwichtig: Brett Battles stellt die Möglichkeit so glaubwürdig dar, dass sie die von ihm ersonnene Geschichte trägt.
|Wann bleibt die Zeit zum Spionieren?|
Auch ohne einen ausgeprägten James-Bond-Faktor lebt der Agenten-Thriller durch die Faktoren Tarnen und Täuschen. Wenn man verfolgt, wie Jonathan Quinn sich rund um den Globus geheime Identitäten, Konten und Schlupfwinkel angelegt hat, fragt man sich, wie er die Zeit gefunden hat, sich das dafür notwendige Geld und Knowhow zu verschaffen. Nur um auf dem aktuellen Stand zu halten, was ihm im Fall der Fälle Schutz bieten soll, müsste er rund um die Uhr beschäftigt sein.
Aber der Faktor Logik ist paradoxerweise gerade im scheinbar so realistischen Agenten-Thriller nur vorgeblich dominant. Wichtiger als die Frage nach der Herkunft der im Bedarfsfall aus dem Hut gezauberten Waffen, Hightech-Instrumente oder falschen Pässe ist ihre bloße Existenz. ‚Realismus‘ wird lieber in die Beschreibung tatsächlich vorhandener Orte investiert; so bewegt sich Quinn durch ein Berlin, in dem Autor Battles penibel jede Straße so beschreibt, wie sie sich im Stadtplan finden lässt.
Die Weltgewandtheit des Helden spiegelt sich ebenso in kundigen Anmerkungen wie dieser wider, dass Taxis in Deutschland immer von der Firma Mercedes hergestellt werden. In Saigon trinkt Quinn Tiger-Bier, in Berlin ein Hefeweizen: Agenten sind Kosmopoliten, die ihre Wurzellosigkeit durch eine Kenntnis von Ländern und Leuten ausgleichen, welche Brett Battles als leidenschaftlicher Weltreisender in seine Romane einfließen lässt.
|Der Mann ohne Eigenschaften|
Einsamkeit macht unangreifbar. Diese ‚Erkenntnis‘ ist zu einem zentralen Klischee des Agenten-Thrillers geworden. Battles treibt es auf die Spitze: Selbst der Name seines Helden ist nicht echt. Ansonsten entspricht Quinn völlig dem Bild des einsamen Wolfes: Er lebt allein, hält die Augen stets weit offen und beim Essen eine feste Wand im Rücken, hat keine Hobbys und vermeidet Angewohnheiten, die ihn in einen fixen und damit verräterischen Lebenswandel verwickeln.
Wie ernst der Job des Agenten ist, kann Quinn nicht oft genug betonen. Um ihn dies verlautbaren zu lassen, führt Battles die Figur des Cleaner-Lehrlings Nate ein. Dieser ist jung und genretypisch dumm, weil allzu lebenslustig und unbeschwert. Nate sorgt für Fehler, die Quinn nie machen darf, weil es die Hauptfigur beschädigen würde, und stellt jene Fragen, die dem Leser ebenfalls im Kopf herumgehen. Obwohl Quinn seinen Lehrling betont rüde behandelt, ist völlig klar, dass hier ein enges Mentor-Schützling-Verhältnis mit Vater-Sohn-Kontext besteht.
Selbstverständlich ist Quinn ein Profi, der ungerührt Folteropfer entsorgt und Blutseen aufwischt, ohne dabei gegen Gerechtigkeit und Moral zu verstoßen. Quinn gibt sich betont desillusioniert, nennt sich selbst aber einen Patrioten und handelt entsprechend. Die Rolle des echten Finsterlings bleibt dem Klischee-Schlächter Borko vorbehalten, der als „Serbe“ zumindest vom US-Durchschnittsleser mit dem „Araber“, dem „Südamerikaner“ oder dem „Nazi“ in jenen Topf geworfen werden, in dem die Feinde der Vereinigten Staaten schmoren sollten.
Für einen emotional beherrschten Mann schwelgt Quinn zudem sehr ausführlich in Gefühlen. Fürs Herz (und mögliche weibliche Leser) baut Battles eine Lovestory ein, die natürlich unglaublich kompliziert ist und ihre beiden Protagonisten in unausgesprochener Liebe einander umkreisen lässt: Es soll ‚knistern‘ aber nicht lodern – noch nicht, denn „Der Profi“ ist der Start einer ganzen Serie und eine gut gekühlte Orlando sicherlich noch haltbar für weitere Verwicklungen.
|Der Weg ist das Ziel|
Worum es in unserer Geschichte faktisch geht, ist sozusagen nebensächlich. Es ist viel spannender, Quinn & Co. über Ozeane und Kontinente flüchten zu sehen, wobei sie Strolche austricksen, vertrimmen und umlegen, während sie ständig raffiniert ausgetüftelten Todesfallen entkommen.
Die Rasanz der Handlung verbirgt nicht die Oberflächlichkeit eines Plots, der auf Quinn fokussiert ist, der nebenbei Steinchen für Steinchen das Mosaik einer Verschwörung zusammensetzt, während er hauptsächlich für die oben skizzierten Action-Elemente sorgt. „Der Profi“ outet sich damit als handwerklich professionell zubereitetes aber simples Lesefutter, dessen schematische Machart manchmal ein wenig zu deutlich durchschimmert. Doch wieso sollte Battles sein Pulver schon in einem Roman verschießen, der eine Serie startet? Wenn für ihn alles gut läuft – und (bisher) zwei weitere „Quinn“-Abenteuer belegen, dass dem so ist -, kann der Autor ohne große Veränderungen seines Arbeitsprinzips noch manche Fortsetzung stricken.
_Autor_
Brett Battles informiert zwar auf einer eigenen Website über seine Arbeit als Schriftsteller (s. u.), hält sich aber über sein Privatleben bedeckt. Bekannt ist nur, dass Battles in Südkalifornien geboren wurde, aufwuchs und weiterhin dort ansässig ist, wenn er nicht gerade auf einer seiner Weltreisen ist.
|Taschenbuch: 416 Seiten
Originaltitel: The Cleaner (New York : Delacorte Press 2007)
Übersetzung: Edith Walter
ISBN-13: 978-3-442-46633-7
Als eBook: ISBN-13: 978-3-641-02443-7|
[www.randomhouse.de/goldmann]http://www.randomhouse.de/goldmann
[www.brettbattles.com]http://www.brettbattles.com
Vyleta, Dan – Pavel & ich
_Das geschieht:_
Nach dem Untergang des „Dritten Reiches“ ist die deutsche Hauptstadt Berlin in vier Sektoren geteilt. Die US-Amerikaner, die Sowjetrussen, die Briten und die Franzosen üben die militärische Oberherrschaft in der durch Bomben und Brände fast völlig zerstörten Stadt aus. Da die Alliierten der gewaltigen Aufgabe, die Einwohner Berlins zu versorgen, nicht Herr werden können, sind Hunger und Seuchen im Dezember des Jahres 1946 an der Tagesordnung; zudem ist dieser zweite Nachkriegs-Winter der härteste seit Menschengedenken. Auf dem Schwarzmarkt verkaufen verzweifelte Menschen geretteten Besitz gegen Nahrung, warme Kleidung und Medikamente. Die Prostitution blüht, verwilderte Kinderbanden streifen durch die Trümmerlandschaft.
Inmitten dieses Chaos‘ haust Pavel Richter, geboren in den USA und vormals Dolmetscher im Dienst der US-Armee. Seit Kriegsende ist er Zivilist, blieb aber in Berlin, wo er wie die Einheimischen um sein Überleben kämpft. Dennoch ist er bereit, seinem besten Freund Boyd White zu helfen, der ebenfalls Zivilist geworden, aber als Zuhälter und Schieber zu Geld gekommen ist. White hat in der Nacht den Gangster Söldmann überfahren. Richter soll die Leiche verschwinden lassen. Dabei erregt er die Aufmerksamkeit des britischen Colonels Stuart Fosko, der in allerhand zwielichtige Aktivitäten verstrickt ist und einen Mikrofilm mit brisanten Geheim-Informationen an sich zu bringen sucht, den Söldmann bei sich trug.
Als White entführt, gefoltert und ermordet wird, will Richter seinen Mörder stellen. Die einzige Spur führt zur Prostituierten Sonja, die sich als Foskos Geliebte entpuppt. Der Colonel lässt Richter überwachen, und auch die Russen sind auf ihn aufmerksam geworden. Richter muss erkennen, dass ihn der letzte Dienst für den Freund in Lebensgefahr bringt, denn jeder ist käuflich im Berlin dieser kalten Tage …
_|“Nun ward der Winter unseres Missvergnügens …“|_
Der Winter 1946 auf 1947 zählte in Mitteleuropa zu den kältesten des 20. Jahrhunderts. Er fiel ausgerechnet in eine Zeit, in der die meisten Menschen ihm hilflos ausgeliefert waren. Vor allem in den ausgebombten Großstädten des ehemaligen „Dritten Reiches“ herrschte Not. Es fehlte an winterfesten Wohnungen, Heizmaterial, Kleidung und Vorräten. Wer diese schier endlosen Monate überlebte, erinnerte sich sein ganzes Leben daran.
Den Nachgeborenen blieben solche Erfahrungen erspart. Ihnen fällt schwer wirklich zu begreifen, welche Entbehrungen und Schrecken dieser Winter brachte, der seinerseits den generellen Ausnahmezustand nur verschärfte. Die Lebensrealität in der besetzten und geteilten Stadt Berlin war erst recht bizarr. Dan Vyleta ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch Historiker. Er hat sich mit den historischen Fakten so vertraut gemacht, wie dies nachträglich möglich ist. In „Pavel & ich“ errichtet er aus ihnen die Kulissen für eine wiederum zeitgebundene Handlung.
|Gefühle als riskanter Luxus|
Zigarettenwährung, Schwarzhandel, Trümmer, Fraternisierung mit den „Frolleins“: Viele Historienkrimis, die ebenfalls in der (deutschen) Nachkriegsära spielen, bedienen sich der Zeitumstände nur als Klischees. Vyletas Blick auf die Vergangenheit ist filterfrei. Er schildert die Kälte als unwiderstehliche Macht. Mit beachtlichem Wortschatz und einem Gespür für Ausdrucksstärke – die der deutsche Übersetzer zu bewahren wusste – findet er immer neue, prägnante Bilder für ihre grausame Allgegenwart. Oft sind es Details, die dem Leser den Schwebezustand zwischen Leben und Tod deutlich machen.
Die Kälte des Winters spiegelt zwischenmenschliche Kälte wider: Zwar lieben nicht nur die Literaten unter den Schriftstellern das Symbol, aber sie scheinen eine besondere Vorliebe für das Bildhafte zu haben. „Pavel & ich“ wimmelt von solchen Spiegelungen, denn im Inneren der Protagonisten geht es emotional hoch her. Diese innere Kälte weiß Vyleta zu differenzieren. Der Kampf ums Überleben hat nicht nur die Gesetze, sondern auch die gesellschaftlichen Regeln stärker beeinträchtigt als der verlorene Krieg. Der findet höchstens im Untergrund als Planspiel einiger Unverbesserlicher statt. Die Mehrheit hat Besseres zu tun.
Zuerst erwischt es die Schwachen – die Kranken, Alten und Kinder. Nur der ständige Regelbruch kann sie retten. Paulchens Bande ist die Konsequenz: Eine Generation von den Nazis ‚erzogener‘ und die erlernten Grundsätze ahnungslos konservierender Kinder lebt wie ein Wolfsrudel in der Trümmerwüste. Sie helfen sich selbst, weil ihnen sonst niemand hilft.
|Verrat als notwendige Selbstverständlichkeit|
Die Not hinterlässt überall ihre Spuren. Sonja ist keine ‚richtige‘ Prostituierte, sondern eine weitere Überlebende, die lernen musste, dass es besser ist, ihren Körper zu verkaufen, weil sie sich auf diese Weise wenigstens theoretisch eine gewisse Entscheidungsfreiheit bewahrt, wen sie in ihr Bett lässt, und sich ein Dach über dem Kopf und einen vollen Magen leisten kann: Noch im Vorjahr haben sich die Sieger gewaltsam genommen, was sie als ihr Vorrecht betrachteten.
Auf der Seite dieser Sieger herrscht das Chaos. Sie schaffen es nicht, das vollständig am Boden liegende Deutschland zu verwalten. So mancher Alliierte sabotiert sogar die entsprechenden Bemühungen: Der Sieg über die Nazis wurde nicht von Heiligen errungen. Kriegsgewinnler gibt es auf beiden Seiten. Boyd White und Colonel Fosko gehören zu denen, die ihre Schäfchen ins Trockene bringen wollen. Da sie das Recht formal vertreten, können sie es besonders leicht mit Füßen treten.
Pavel Richter scheint die einsame Ausnahme zu sein – ein Mann, der sich nicht korrumpieren lässt und auf diese Weise einer verlorenen Kriegswaise zum Vaterersatz, einer verzweifelten Frau zum aufrichtig Geliebten und einem brutalen Schläger zum Seelengefährten wird. Wer Richter wirklich ist, enthüllt Vyleta (ansatzweise) in einem Finale, das überrascht und es in sich hat!
|Inhalt mit Stil – und umgekehrt|
Dass dieser Knalleffekt selbst bei Lektüre-Veteranen zündet, verdankt „Pavel & ich“ der schon erwähnten Fabulierkunst des Verfassers, die über das Setzen wohlüberlegter Worte weit hinausgeht. Obwohl er mit diesen nie geizt, hält uns Vyleta kurz, was grundsätzliche Informationen angeht. Sie werden geschickt in den Text integriert bzw. dort versteckt. Vyleta verwischt Spuren zusätzlich durch Perspektivenwechsel. Meist schildert Peterson, der einäugige Handlager des Colonels, die Ereignisse, aber immer wieder übernimmt Vyleta, der der unsichtbar aber allwissend über der Handlung schwebt – und dies oft buchstäblich.
Auch den Zeitfluss manipuliert der Verfasser, wie es seiner Geschichte am besten zuträglich ist. Er springt im Zeitraum 18. Dezember 1946 bis 4. Januar 1947 hin und her, vergrößert das ohnehin allgegenwärtige Gefühl der Unsicherheit, mit dem auch die Protagonisten ihre Gegenwart verbinden, während sie die Vergangenheit verdrängt oder vergessen haben und an eine – bessere – Zukunft nicht glauben können. Wie der Epilog zeigt, der 1964 spielt, liegen sie damit in gewisser Weise richtig.
Aufgrund (oder trotz?) dieser harmonisch die Geschichte stützenden, nie übertriebenen stilistischen Kunstfertigkeit (die ‚literarisch zu nennen ich mich weigere, weil dieser Begriff eher Wertung als Definition geworden ist) zieht ‚Pavel & ich“ den Leser in jenen Bann, der das echte Lese-Erlebnis von der Alltags-Lektüre trennt. Kein durch die Bestsellerlisten tobender Psychopath kann vor dem Hintergrund dieser einfachen aber bedrückend überzeugenden Geschichte bestehen, die selbst im notwehrbedingt teflonbeschichteten Hirn eines Patterson/Johansen/Cornwell-geschädigten Lesers haften bleiben wird!
_Autor_
Dan Vyleta wurde 1974 in Gelsenkirchen geboren. In den 1960er Jahren waren seine regimefeindlichen Eltern durch den „Eisernen Vorhang“ in die Bundesrepublik Deutschland geflohen. Hier wuchs Vyleta auf, verließ aber das Land, um in England Geschichte zu studieren. Seinen Doktorgrad erwarb er am King’s College in Cambridge. Anschließend lektorierte er wissenschaftliche Veröffentlichungen. Er kehrte nach Deutschland zurück, wo er in Berlin lebte.
2008 veröffentlichte Vyleta, der nun im kanadischen Edmonton lebt und arbeitet, seinen ersten Roman. „Pavel & ich“ wurde von der Kritik freundlich aufgenommen. Vyleta blieb dem Historien-Roman – den er mit Elementen des Krimis erzählt – auch in seinem zweiten Werk treu, das im Wien des Jahres 1939 spielt; ein Umfeld, in dem der Verfasser sich durch seine historische Forschungsarbeit – seine Doktorarbeit trägt den Titel „Crimes, News, and Jews, Vienna 1895-1914“ – ausgezeichnet auskennt.
|Gebunden: 414 Seiten
Originalausgabe: Pavel & I (New York : Bloomsbury 2008)
Übersetzung: Werner Löcher-Lawrence
ISBN-13: 978-3-8270-0814-5|
[www.berlinverlage.de]http://www.berlinverlage.de
[danvyleta.com]http://danvyleta.com
Dmitry Glukhovsky – Sumerki