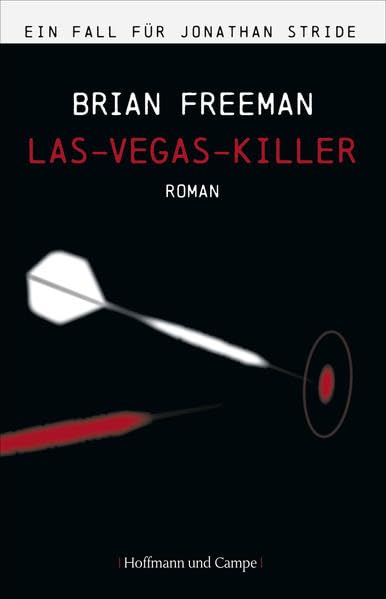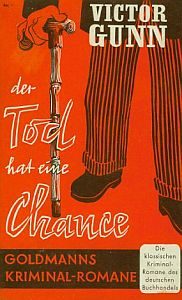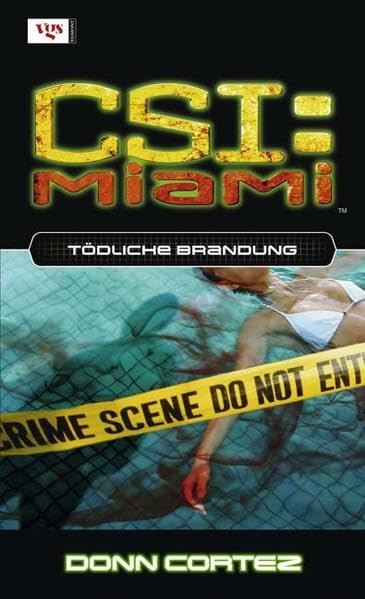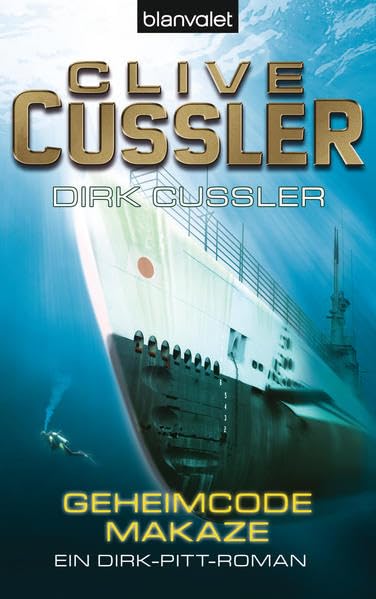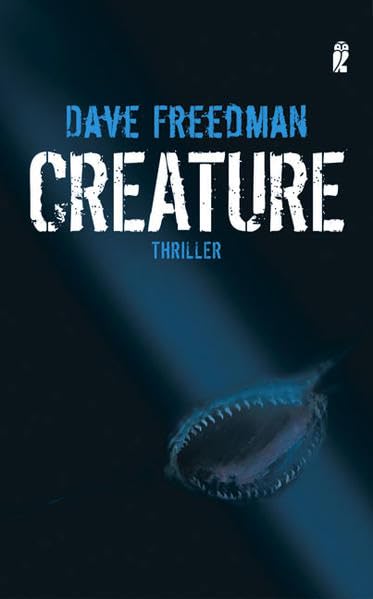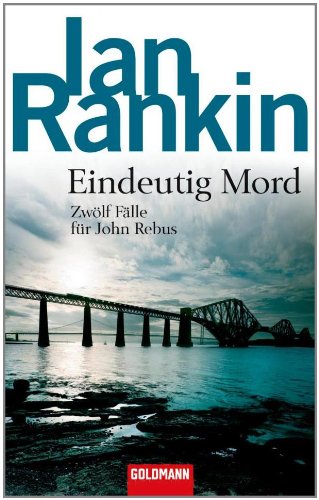_Das geschieht:_
Ein Mann verfolgt und erschießt ein Millionärssöhnchen; er hinterlässt seinen sorgfältig platzierten Fingerabdruck. In einem Vorort wird ein Kind überfahren; an der Scheibe des Unfallwagens prangt der bekannte Abdruck. Einer ehemaligen Lehrerin wird die Kehle durchgeschnitten; der Verdächtige ist erneut unser dreister Unbekannter.
Wer ist der Mann, der offenbar eine Fehde mit der Polizei vom Zaun brechen will, und wo ist die Gemeinsamkeit zwischen den brutalen Taten? Jonathan Stride, Ermittler bei der Mordkommission von Las Vegas, wird mit seinem ersten großen Fall gleich ein heißes Eisen zugeschoben. Dabei ist der ehemalige Star-Polizist aus dem kalten, weit entfernten Minnesota ein Außenseiter, den sogar sein Vorgesetzter gern kaltgestellt sähe, da Stride nicht gewillt ist, politische Rücksicht walten zu lassen, sondern diverse hochgestellte Persönlichkeiten mit unangenehmen Fragen behelligt.
Zu ihnen gehört Boni Fisso, einer der letzten großen Mafia-Bosse, die Las Vegas einst regierten. Im Penthouse-Pool seines „Sheherezade“-Casinos wurde 1967 die Leiche der schönen Tänzerin Amira Luz gefunden – ein Mord, der nie zufriedenstellend aufgeklärt werden konnte. Bis Stride, seine Partnerin Amanda Gillen und seine Kollegin und Lebensgefährtin Serena Dial entdecken, dass die Ermordeten der Gegenwart in das Geschehen der Vergangenheit verwickelt waren, hat der Killer die Liste seiner Opfer verlängert. Er befindet sich offensichtlich auf einem Rachefeldzug. Was ihn antreibt, ist Rache für Amira Luz. Um ihn zu entlarven, müssen Stride, Gillen und Dial das Geheimnis lüften. Doch die Verdächtigen hatten vierzig Jahre Zeit ihre einstigen Verbrechen zu vertuschen. Stück für Stück müssen die drei Polizisten ihnen die Wahrheit entreißen. Das kostet Zeit, die sie nicht haben, denn der Las-Vegas-Killer rüstet längst zum großen Finale, für dessen Verwirklichung er sich einen besonders teuflischen Plan einfallen lässt …
_Stadt ohne Geschichte und Gewissen_
Las Vegas im US-Staat Nevada: eine Stadt, die inmitten einer heißen Sandwüste errichtet wurde und schon deshalb eine Torheit ist, die jedoch blüht und gedeiht, weil sie dem ansonsten verpönten und verbotenen Glücksspiel eine Nische bietet. Gigantische Casinos schossen nach dem II. Weltkrieg wie Fabriken aus dem Boden. Sie verbanden den Kitzel des Spiels um hohe Summen mit einem Unterhaltungsangebot, das die größten Stars ihrer Zeit darboten. Hinter den Kulissen hatte viele Jahrzehnte das organisierte Verbrechen das Sagen. Las Vegas ist eine ‚Gründung‘ der Mafia, die bis in die 1970er Jahre Erträge abwarf, die sich mit den Bruttosozialprodukten gar nicht kleiner Ausländer vergleichen ließen.
In dieser ‚großen‘ Zeit der Glitzerstadt wurzelt der Plot von „Las-Vegas-Killer“. Längst hat die US-Regierung die Mafia vertrieben. Las Vegas ist zu einer Touristenattraktion und –falle geworden. Die Verbrechensrate blieb zwar hoch, doch sind kriminelle Aktivitäten, wie Brian Freeman sie zur Grundlage seiner Geschichte macht, heute wohl nicht mehr möglich.
Vierzig Jahre sind an sich keine lange Zeitspanne. Nicht wenige Männer und Frauen, die damals Täter oder Opfer waren, haben überlebt oder mischen noch heute – vorsichtig geworden – im Vegas-Business mit. Die Zeit läuft in der Wüstenstadt anders ab; eine Tatsache, die Freeman immer wieder thematisiert, weil sie einerseits schwer verständlich ist und andererseits begriffen werden muss, damit die Story sinnvoll wird.
_Thriller ohne Originalität und Überraschungen_
Der Mythos Las Vegas ist – egal ob vergangen oder aktuell – ein Stoff, aus dem unzählige Kriminalromane und –filme entstanden sind. Die dabei gelungenen Werke zu kennen, ist nur bedingt von Vorteil, weil dies die Erkenntnis fördert, dass Freeman sich stur an die Vorgaben hält. Jedes Vegas-Klischee feiert fröhliche Urständ, was der Leser weniger begeistert registriert.
Für „Las-Vegas-Killer“ hat sich der Autor zwar einen soliden und ablauftauglichen Plot einfallen lassen, den er jedoch allzu sorgfältig konstruiert und entwickelt. Faktisch treibt er seinem Thriller damit jede Überraschung aus. Brutale Mord- und drastische Bettszenen sollen für Ersatz sorgen, aber da die einen einfallsarm und die anderen US-amerikanisch, d. h. puritanisch verdruckst daherkommen, will die Rechnung nicht aufgehen.
So erbarmungslos wie der Las-Vegas-Killer lässt Freeman die Handlung in ebenfalls sattsam bekannten Klischees (ver-)enden. Selbstverständlich wird ihr ein Schluss-Twist aufgesattelt, der die bisher erzählte Story plötzlich in Frage stellt. Um gänzlich auf Nummer Sicher zu gehen, lässt der Verfasser diesem Twist noch ein Überraschungs-Twistchen folgen … „Las-Vegas-Killer“ gehört zu jenen Romanen, die einfach kein Ende finden wollen, sondern immer noch weiter gehen, selbst wenn der logische Schlusspunkt längst gesetzt ist. Da wundert es nicht, dass auf den nun wirklich letzten Seiten die Fortsetzung vorbereitet wird.
_Thriller-Traum mit Seifenschaum_
Das bringt uns zu einem weiteren Manko: „Las-Vegas-Killer“ erschöpft sich keineswegs in einer möglichst spannenden Geschichte. Unabhängig von der Frage, ob Freeman eine solche überhaupt geglückt ist, nimmt er selbst immer wieder das Tempo aus der Handlung, wenn er die Soap-Opera-Maschine anwirft. Die arbeitet manchmal im Leerlauf, aber viel zu oft auf Hochtouren:
– Jonathan Stride ist heimatlos unglücklich in Las Vegas UND wird als Polizeibeamter gemobbt UND muss sich mit einer transsexuellen Partnerin zusammenraufen UND wird von seiner Lebensgefährtin lesbisch betrogen …
– Serena Dial ist Alkoholikerin UND wurde als junges Mädchen von ihrer Mutter als Prostituierte verkauft UND hat ihre beste Freundin UND Ex-Geliebte im Elend sterben sehen UND ist in mittleren Jahren kinderlos UND wird, obwohl unsterblich in ihren Jonathan verliebt, lesbisch (s. o.) rückfällig …
– Amanda Gillen ist eigentlich nur transsexuell, wird aber deshalb von den bösen Kollegen ständig gehänselt und muss, was viel schlimmer ist, für Freeman politisch korrekte Zaunpfahl-Hiebe austeilen: Seht doch, ich bin ein Mensch wie ihr! Akzeptiert mich doch endlich!
Mafiosi sind pompös und großtuerisch, nur um im nächsten Moment die Maske fallen zu lassen und schurkisch zu tücken, Politiker verlogen und niederträchtig. Der „Las-Vegas-Killer“ wird als übermächtiger Bösewicht geschildert und im Finale via Küchenpsychologie als Muttersöhnchen mit Riss in der Hirnwaffel demontiert.
Nein, dieses Buch weist definitiv keine Scorsese-Qualitäten auf. Näher kommt ihm eine Szene aus der TV-Serie „CSI Las Vegas“: Mogul Sam Braun sitzt mit den tattrigen Schauspielern Frank Gorshin und Tony Curtis – sie spielen sich selbst und gehörten zu ihrer Zeit zur Vegas-Prominenz – in seinem Casino und schwelgt rührselig in Erinnerungen an die gute, alte, böse Zeit (Doppelfolge „Grabesstille“ von Quentin Tarantino). Genauso ‚authentisch‘ wirkt „Las-Vegas-Killer“ mit seinem Talmi-Thrill aus zweiter Hand.
_Der Autor_
Brian Freeman wurde 1963 in Chicago, Illinois, geboren. Die Familie siedelte nach San Mateo in Kalifornien um und zog später nordostwärts nach Minnesota. Am Carleton College in Northfield studierte Freeman Englisch. Nach dem Abschluss 1984 arbeitete er u. a. in der Marketing- und PR-Abteilung einer internationalen Anwaltskanzlei.
Schriftstellerische Ambitionen spürte Freeman nach eigener Auskunft schon in seinen Jugendjahren. Ein erster Romanentwurf entstand während des Studiums; weitere, stets unveröffentlichte Manuskripte folgten. Erst 2004 erschien „Immoral“ (dt. [„Unmoralisch“/“Doppelmord“), 2037 der erste Thriller um Ermittler Jonathan Stride, und wurde sogleich ein Bestseller, der für einen „Edgar“, einen „Dagger“, einen „Anthony“ und einen „Barry Award“ nominiert wurde und den „Macavity Award“ der „Mystery Readers International“ für das beste Romandebüt gewann.
Die Jonathan-Stride-Romane von Brian Freeman erscheinen in Deutschland im Verlag |Hoffmann und Campe| (gebunden) bzw. zuvor im |Club Bertelsmann|:
(2005) Immoral [(„Unmoralisch“/“Doppelmord“) 2037
(2006) Stripped („Las-Vegas-Killer“)
(2007) Stalked (noch nicht in Deutschland erschienen)
(2008) In the Dark (US-Titel) / The Watcher (GB-Titel) (noch nicht in Deutschland erschienen)
(2009) Unsolved (noch nicht erschienen)
_Impressum_
Originaltitel: Stripped (New York : St. Martin’s Press 2006)
Übersetzung: Imke Walsh-Araya
Deutsche Erstausgabe: 2006 (Bertelsmann Club / RM-Buch-und-Medien-Vertrieb, exklusive Buchgemeinschaftsausgabe)
Erstausgabe für den deutschen Buchhandel: August 2008 (Hoffmann und Campe Verlag)
490 Seiten
EUR 17,95
ISBN-13: 978-3-455-40136-3
http://www.hoca.de