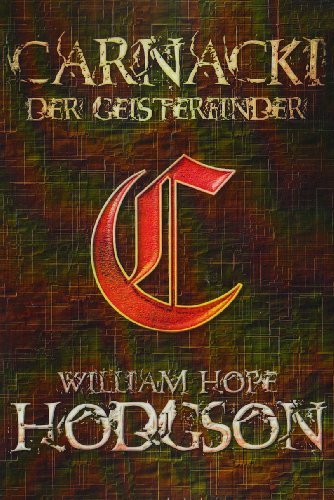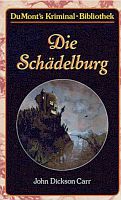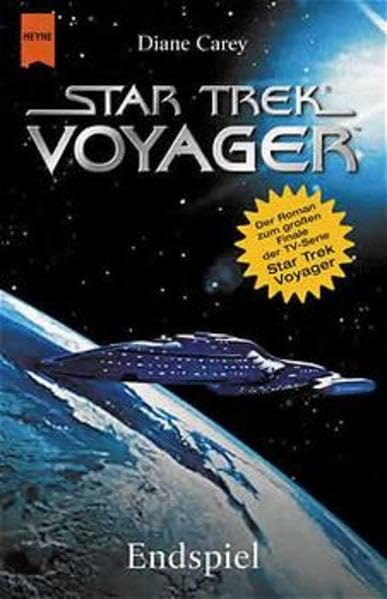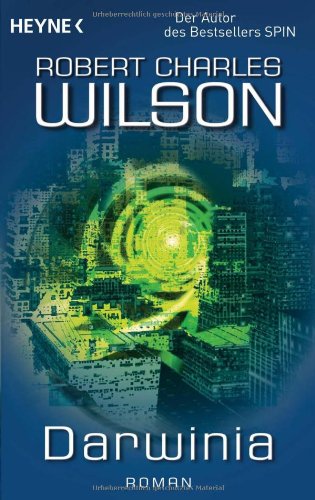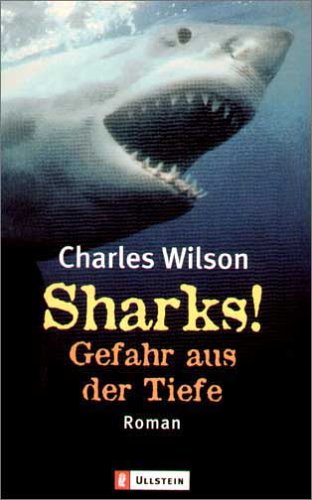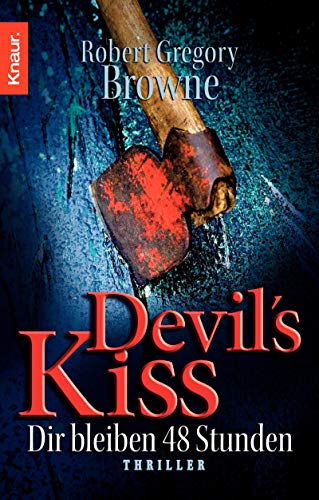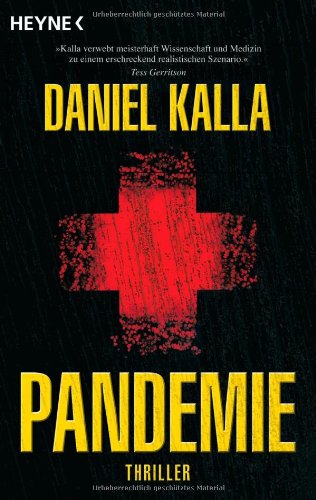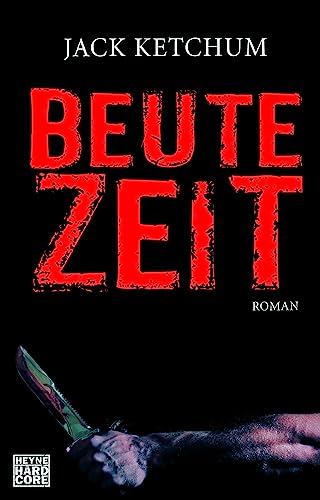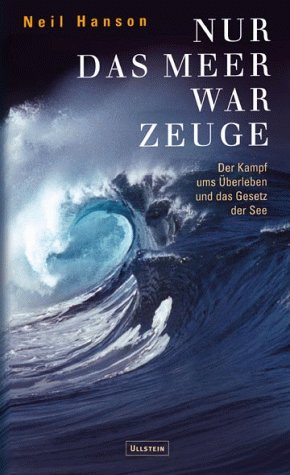Wes Craven – Identity weiterlesen
Alle Beiträge von Michael Drewniok
Hodgson, William Hope – Carnacki der Geisterfinder
Zum ersten Mal werden in deutscher Sprache alle neun Kurzgeschichten um den „Geisterfinder“ Carnacki gesammelt, mit dem William Hope Hodgson (1877-1918) einen der ersten der heute in der Phantastik so beliebten Erforscher übernatürlicher Phänomene schuf:
– _Das Tor des Monsters_ („The Gateway of the Monster“, 1910): Um ein verfluchtes Familienerbstück hat sich aus fremddimensionaler Essenz ein groteskes Ungeheuer geformt, das auf unvorsichtige Besucher lauert – aktuell ist dies Geisterfinder Carnacki, der im entscheidenden Moment seines Kampfes einen ganz dummen Fehler macht …
– _Das Haus in den Lorbeeren_ („The House Among the Laurels“, 1910): Blut tropft von den Decken und macht deutlich, dass es in diesem Haus umgeht. Mit einigen mutigen Männern und scharfen Hunden will Carnacki das Geheimnis lüften, was ihm nach vielen Gefahren mit unerwartetem Ergebnis gelingt …
– _Das pfeifende Zimmer_ („The Whistling Room“, 1910): In einer alten irischen Burg hat sich eine dämonische Macht eingenistet. Carnacki muss sein eindrucksvolles Instrumentarium altbewährter und hochmoderner Abwehrmittel einsetzen, um dem heimtückischen und gemeingefährlichen Spuk ein Ende zu bereiten …
– _Das Pferd aus dem Unsichtbaren_ („The Horse of the Invisible“, 1910): Mary Higgins wird vom Familienfluch heimgesucht – ein unsichtbares Gespensterpferd verfolgt und peinigt sie. Carnacki eilt zur Hilfe und deckt eine sehr irdische Verschwörung auf, doch dahinter kommt ein sehr echter Spuk zum Vorschein …
– _Das letzte Haus_ („The Searcher of the End House“, 1910): Dieses Mal sucht ein Spuk das Haus von Carnackis Mutter heim. Der Vermieter gibt ungern preis, dass hier einst der Schmuggler Captain Tobias logierte. In der Nacht entdeckt Carnacki allerdings die geisterhaften Gestalten einer Frau und eines nackten Kindes, was den Ereignissen eine neue Richtung gibt …
– _Das unsichtbare Ding_ („The Thing Invisible“, 1912): In der Kapelle eines alten Landhauses sorgt ein verfluchter Dolch für nächtlichen Schrecken. Carnacki wagt sich an den Ort des Grauens und deckt ein historisches Rätsel auf …
– _Spuk auf der Jarvee_ („The Haunted ‚Jarvee'“, 1929): Dieses Schiff ist verflucht. Selbst Carnacki, den sein Freund, Kapitän Thompson, an Bord bittet, kann sein schreckliches Ende nicht verhindern, aber immerhin erklären …
– _Das Schwein_ („The Hog“, 1947): Die Schutzschicht, die unsere Welt von wahrlich fremden Dimensionen trennt, ist um den unglücklichen Mr. Bains reichlich dünn geworden. Finstere Existenzen haben es auf seine Seele abgesehen, mit denen sich der zu Hilfe gerufene Carnacki einen heroischen Kampf auf Leben und Tod liefert …
– _Der Fund_ („The Find“, 1947): Auch als Fachmann für historische Geheimnisse weiß sich Carnacki zu bewähren, als in einem Londoner Museum die mysteriöse Kopie eines berüchtigten Manuskriptes auftaucht, das einst am Hofe der Königin Elizabeth I. für gewaltiges Aufsehen sorgte …
_Einige Anmerkungen zu dieser Sammlung_
|I.|
Der „Geisterfinder“ Thomas Carnacki, ein früher Anhänger Sigmund Freuds und C. G. Jungs, geht das Übernatürliche streng wissenschaftlich bzw. deduktiv an: Carnacki ist eine Art Sherlock Holmes des Übernatürlichen. Zwar verschmäht er die alten Meister der Magie nicht, die er indes eher als Repräsentanten inzwischen vergessenen Wissens denn als Zauberer oder Alchimisten betrachtet. Als Mann des 20. Jahrhunderts zieht Carnacki nicht mehr nur mit Bannsprüchen und Amuletten, sondern auch mit Mikrofon und Fotoapparat in die Geisterschlacht. Modernstes Geisterspür-Gerät, entwickelt auf der Basis aktueller Erkenntnisse der Physik und anderer Naturwissenschaften, trägt er im Gepäck. Besonders sein mit Elektrizität beleuchtetes Pentagramm bleibt dem Leser im Gedächtnis.
Wobei das nicht so lächerlich wirkt, wie es zunächst klingen mag. Carnacki bekommt es durchaus nicht mit den Gespenstern bekannter Machart zu tun. Rächende Leichen und andere Untote erledigt er zwar auch. Eigentlich jagt er jedoch größeres Wild. Neben der Welt, wie wir sie kennen, gibt es andere Welten. Damit ist nicht zwangsläufig das Jenseits als Reich der Toten gemeint. Carnacki weiß um die Mehrdimensionalität des Universums. Dort, wo die Grenzen manchmal brüchig werden, besuchen uns fremde Wesenheiten, die unter den Menschen partout nichts zu suchen haben und vertrieben werden müssen. Das ist Carnackis Job.
Hier wildert Hodgson eigentlich auf dem Feld der Science-Fiction. Es wirkt nicht so, weil er seine ‚Außerirdischen‘ im Ambiente der klassischen englischen Gruselliteratur auftreten lässt. Zwanzig Jahre später hätte Hodgson das vermutlich viel zugänglicher im Stil der „Pulp“-Magazine gestaltet; er war ein Schriftsteller, dem der Publikumserfolg am Herzen (und an der Geldbörse) lag.
Der recht kritische H. P. Lovecraft (1890-1937) rühmte jedenfalls Hodgsons Idee des „kosmischen Schreckens“ und ließ sich für die eigene Cthulhu-Saga inspirieren. Wäre Hodgson ein längeres Leben vergönnt gewesen, hätte er vielleicht wie Lovecraft Bezüge zwischen seinen literarischen Welten hergestellt und einen Kosmos mit eigenen Regeln geschaffen. Ansätze dazu finden wir z. B. in den mysteriösen Schweinewesen, die nicht nur Carnacki zu schaffen machen. In Hodgsons eindrucksvoller Novelle [„Das Haus an der Grenze“ 416 (1908) treten sie ebenfalls als zwar bösartige aber vor allem fremde Wesen in die Handlung. Der Idee von der ‚Durchlässigkeit‘ der Realität, die Carnacki in „Spuk auf der Jarvee“ entwickelt, bediente sich Hodgson schon 1909 in seiner bemerkenswerten Novelle „Ghost Pirates“ (dt. „Geisterpiraten“).
|II.|
Dem heutigen Leser mögen die Carnacki-Storys ereignisarm und umständlich geschrieben erscheinen. Vor hundert Jahren definierte man Spannung ein wenig anders als heute. Sie stellt sich ein, wenn man dies berücksichtigt und sich auf Zeit und Stil einlässt. Dabei hilft, dass die Atmosphäre nicht gelitten hat: Hodgson war sicherlich kein Autor, der ‚Action‘-Szenen schreiben konnte. Dafür hatte er einen ausgeprägten Sinn für das Unheimliche bzw. Fremdartige, das er außerordentlich stimmungsvoll heraufbeschwören konnte.
Carnacki ist zwar der „Geisterfinder“, doch er ist als Wissenschaftler offen für alle Erklärungsmöglichkeiten und geht nicht zwangsläufig von ‚übernatürlichen‘ Ursachen aus. Diese Objektivität gehört zu seinem Wesen, was zumindest den deutschen Lesern bisher vorenthalten blieb, da ausschließlich diejenigen Carnacki-Storys veröffentlicht wurden, die den Ermittler tatsächlich Geister finden ließen. Wie diese Sammlung nunmehr zeigt, beobachtet man Carnacki auch dann gern bei seiner Arbeit, wenn er scheinbar Irreales als menschliches Blendwerk entlarvt.
|III.|
W. H. Hodgson gehört zu den großen Klassikern der Phantastik. Auch in Deutschland wurden seine wichtigsten Werke zwischen 1970 und 1987 gut übersetzt in drei Bänden vom |Suhrkamp|-Verlag veröffentlicht. „Das Haus an der Grenze“ ist 2004 im |Festa|-Verlag neu erschienen. Hier sollte im April 2008 auch eine Sammlung aller Carnacki-Storys auf den Buchmarkt gebracht werden. Dieser Titel wurde inzwischen aus dem Programm gestrichen, denn Martin Clauß, der seine Sammlung sowohl herausgab als auch neu übersetzte, ist dem zuvorgekommen.
„Carnacki der Geisterfinder“ ist freilich nicht als ‚richtiges‘ Buch, sondern als „book on demand“ (bod) erhältlich. Dies schränkt die Zahl der potenziellen Leser – groß dürfte ihr Kreis ohnehin nicht sein, da Hodgson anders als z. B. H. P. Lovecraft hierzulande keinerlei Kultstatus besitzt – ein. Das „bod“ hat außerdem weiterhin keinen besonders guten Ruf. Bücher wie dieses könnten dies relativieren. Diverse Fehler im Schriftbild deuten auf die Abwesenheit einer fachmännischen Endredaktion, halten sich jedoch im Rahmen. Die Übersetzung liest sich flüssig, und die Ausgabe ist zudem vollständig: Auf absehbare Zeit ist keine „Carnacki“-Sammlung mehr zu erwarten, und diese schließt eine echte Lücke in den Sammlungen derer, die für die klassische Phantastik schwärmen.
_William Hope Hodgson_ wurde am 15. November 1877 in Blackmore End, Essex, England, als eines von zwölf Kindern geboren. Sein Elternhaus verließ er früh, um zur Handelsmarine zu gehen. Zwischen 1891 und 1904 fuhr er zur See, konnte sich aber nie an die Brutalitäten und Ungerechtigkeiten an Bord, den Schmutz oder die Gefahren gewöhnen. So musterte er ab und eröffnete in Blackburn nahe Liverpool ein Studio für Bodybuilder. Das Geschäft lief schlecht, aber Hodgson schrieb viele Artikel über seine Arbeit und begann über eine Karriere als Schriftsteller nachzudenken. Seine Jahre auf den Weltmeeren lieferten ihm genug Stoff für phantastische Seespukgeschichten. Mit „A Tropical Horror“ debütierte Hodgson 1905 in „The Grand Magazine“.
1907 folgte der Episodenroman „The Boats of the ‚Glen Carrig'“ (dt. in [„Stimme in der Nacht“, 255 |Suhrkamp| Taschenbuch Nr. 749/64, neu aufgelegt als Nr. 2709/340), ein erstes längeres Werk. 1908 erschien „The House on the Borderland“ (dt. „Das Haus an der Grenze“), mit dem Hodgson bewies, dass er auch auf dem trockenen Land Angst & Schrecken zu verbreiten wusste. „Carnacki, the Ghost Finder“ betrat die literarische Bühne 1910. Zwei Jahre später erschien Hodgsons episches Hauptwerk: „The Night Land“, eine Geschichte aus fernster Zukunft, die viele brillante Stimmungsbilder aus „The House on the Borderland“ aufgreift und vertieft.
Hodgson heiratete 1913 und zog mit seiner Gattin nach Südfrankreich. Er schrieb nur noch wenig. Bei Kriegsausbruch 1914 ging er nach England zurück und wurde als Offizier der Royal Field Artillery zugeteilt. Eine schwere Kopfverletzung auf dem Schlachtfeld überlebte er knapp und kehrte an die Front zurück. Hier traf ihn am 17. April 1918 ein deutsches Artilleriegeschoss. Er war sofort tot.
Eine ausführliche Beschreibung von Leben und Werk des William Hope Hodgson gibt: http://www.creative.net/~alang/lit/horror/hodgson.sht.
Einen großartige Sammlung relevanter Fakten speziell zu Hodgsons Carnacki-Storys sowie deren vollständige E-Text-Wiedergabe in englischer Sprache liefert Marcus L. Rowland: http://www.forgottenfutures.com/game/ff4/worldbk4.htm („Forgotten Futures IV: The Carnacki Cylinders. A Role Playing Sourcebook For William Hope Hodgson’s ‚Carnacki The Ghost-Finder'“).
Tess Gerritsen – In der Schwebe

Tess Gerritsen – In der Schwebe weiterlesen
Richard Dalby (Hg.) – O du grausame Weihnachtszeit. Schaurige Geschichten zum Fest

Richard Dalby (Hg.) – O du grausame Weihnachtszeit. Schaurige Geschichten zum Fest weiterlesen
Nick Stone – Voodoo

Nick Stone – Voodoo weiterlesen
John Dickson Carr – Die Schädelburg
Trutzig ragt Burg Schädel unweit von Koblenz hoch über dem Rhein auf, wo sie vor einem halben Jahrtausend ein gefürchteter Hexenmeister errichten ließ. Der verrufene Ort wurde zum idealen Heim für den großen Bühnenmagier Maleger, der privat ein Ekel und Sonderling. 1913 – vor 17 Jahren – ist er während der Anreise zur Burg angeblich in den Fluss gestürzt, aus dem man seine ebenso angebliche Leiche zog.
Burg Schädel ging an Myron Alison, den berühmten Schauspieler, und seinen Freund, den Finanzmagnaten Jérôme D’Aunay. Viel Freude bereitete ihnen das Erbe nicht. Alison fand man kürzlich unterhalb der Mauern; man hatte ihn angeschossen, mit Benzin übergossen und angesteckt. Als lebende Fackel taumelte er über die Zinnen, während ein gespenstischer Schatten dies beobachtet haben soll. John Dickson Carr – Die Schädelburg weiterlesen
Carey, Diane / Golden, Christie – Star Trek Voyager: Endspiel
Zum zehnten Mal jährt sich der Tag, an dem das Föderations-Raumschiff „Voyager“ unter dem Kommando von Captain Kathryn Janeway nach einer Irrfahrt, die 26 Jahre währte, aus dem Delta-Quadranten zur Erde zurückkehrte. Längst ist scheinbar der Alltag eingekehrt. Janeway ist zur Admiralin der Sternenflotte aufgestiegen. Harry Kim führt inzwischen ein eigenes Schiff. Der Holo-Doktor konnte seinen Status als ‚echte‘ Lebensform wahren und ist inzwischen sogar Ehemann geworden. Tom Paris hat seinen Abschied genommen und sich als Schriftsteller einen Namen gemacht. B’Elanna Torres, seine Gattin, ist ebenfalls aus dem aktiven Flottendienst ausgeschieden, während beider Tochter Miral in die Fußstapfen der Eltern trat.
Die junge Pilotin wird zur Schlüsselfigur in Janeways geheimen Privatkrieg gegen die Zeit und das Schicksal. Die Heimkehr der „Voyager“ musste bitter erkämpft werden; viele Mitglieder der Besatzung, darunter Commander Chakotay und Seven of Nine, verloren ihr Leben. Wissenschaftsoffizier Tuvok konnte von einer Nervenkrankheit nicht rechtzeitig geheilt werden und dämmert in einer Anstalt dem Tod entgegen.
Janeway beschließt, allen Direktiven der Föderation zum Trotz die Geschichte nach ihrem Willen umzuschreiben: Sie will eine Zeitreise unternehmen und ihrem jüngeren Ich mit Hilfe der inzwischen weit vorangeschrittenen Technik die Chance bieten, eine ‚Abkürzung‘ nach Hause zu finden und so der Zukunft ein neues und erfreulicheres Gesicht zu geben. Nach großen Anlaufschwierigkeiten glückt der Sprung zurück. Captain Janeway ist zwar entsetzt über ihr desillusioniertes und zynisches Alter Ego, erklärt sich aber doch bereit, die „Voyager“ umrüsten zu lassen für die Reise durch ein Wurmloch, das just im All entdeckt wurde.
Aber die Admiralin hat dem Captain verschwiegen, dass am Eingang des Wurmlochs alte, ungern gesehene Bekannte lauern: die Borg, die hier an einem Portal arbeiten, das endlich die Invasion des Alpha-Quadranten ermöglichen soll. Dies ist das größte Geheimnis der Borg, und so ist es kein Wunder, dass die prominenteste Vertreterin der assimilierfreudigen Gesellen die Arbeiten leitet: die Königin der Borg, Einzige ihrer Art, die sich ihre Individualität erhalten hat, was sie unberechenbar und damit doppelt gefährlich werden lässt. Die „Voyager“ könnte sich trotzdem durch das Wurmloch mogeln, doch Captain Janeway fragt sich, ob man die Chance verstreichen lassen darf, das Borg-Portal zu sabotieren. Die Admiralin ist strikt gegen diesen Plan und versucht, die Besatzung der „Voyager“ gegen den Captain aufzuwiegeln. Dieser Konflikt verschafft der Königin die Zeit, Gegenmaßnahmen einzuleiten, die sich borgtypisch als sehr wirkungsvoll erweisen …
Es ist so weit: Nach sieben Jahren in den Weiten des TV-Äthers kehrt die „Voyager“ heim. Die große Odyssee endet roddenberrysch, d. h. von Bord gehen durch Erfahrung geläuterte, klüger, sogar weise gewordene oder doch wenigstens miteinander verbandelte Männer und Frauen, die zuvor noch des dramaturgisches Verzögerungseffektes wegen ein zwar ziemlich unglaubwürdiges, aber leidlich spannendes Abenteuer erleben mussten.
Diane Carey ist keine von echtem Unterhaltungsgeschick beseelte Schriftstellerin, wie schreckliche „Star Trek“-Abenteuer belegen, die sie sich selbst aus dem Hirn gewrungen hat. Lässt man sie jedoch nach Drehbuch schreiben, drechselt sie termingerecht und wahrscheinlich nach Tariflohn leidlich lesbare „Romane zum Film“, die es dem „Star Trek“-Franchise ermöglichen, einen nicht exorbitanten, aber doch respektablen und vor allem schon vorab kalkulierbaren Gewinn einzustreichen. Die Summe könnte höher sein, wenn man z. B. einen wirklich talentierten Autoren beschäftigte, aber dieses Risiko ist in der Kosten-Nutzen-Planung nicht vorgesehen, und daher reicht es, Diane Carey anzuheuern.
Das Ergebnis entspricht solchem nüchternen Geschäftsdenken. „Endspiel“ ist formal wie inhaltlich jederzeit Mittelmaß; ohne Überraschung, ohne Feuer, lebendig höchstens durch die Vorgeschichte der hier nun zum vorerst letzten Mal agierenden Figuren und die (sich freilich auch in Grenzen haltende) Spannung durch die Frage, wie diese denn nun ins (TV-)Nirwana entlassen werden.
Nicht verantwortlich zu machen ist Carey indes für die gewaltigen Löcher, die durch das lieblos zusammengeschluderte Drehbuch in die Handlung geschlagen werden. Nun sind logische Bocksprünge seit jeher typisch für „Star Trek“, was einer Science-Fiction-Serie auch gut zu Gesichte steht. Das enthebt jene, die sich über die TV-Apokalypse der Woche den Kopf zermartern, jedoch nicht der Verantwortung, für eine gewisse Stimmigkeit der erfundenen Welten Sorge zu tragen. „Endspiel“ verkauft sein Publikum schlicht für dumm; was dem Zuschauer vor einem Wirbel eindrucksvoller Spezialeffekte im Fernsehen womöglich nicht so bewusst wird, bleibt dem (des Denkens zumindest in Ansätzen fähigen) Leser nicht lange verborgen. Hier nur eine Auswahl offener Fragen:
Was treibt eigentlich die „Abteilung für Temporale Ermittlungen“ der Sternenflotte, deren gestrenge Repräsentanten wir in früheren „Star Trek“-Episoden kennengelernt haben, während Admiralin Janeway offenbar nach Belieben im Zeitstrahl herummurkst?
Was würden wohl jene Besatzungsmitglieder zu Janeways ‚Korrektur‘ der Vergangenheit sagen, die nicht nur die Reise der „Voyager“ überlebt, sondern sich in den vergangenen zehn Jahren ein neues und offensichtlich glückliches Leben aufgebaut haben? Wohl weil sie die Antwort kennt, fragt die Admiralin lieber erst gar nicht …
In den alten „Frankenstein“-Filmen der 1930er Jahre gab es im Labor des guten Doktors stets einen Hebel, der, einmal umgelegt, das Labor samt Monster in Rauch und Flammen aufgehen ließ. Realistisch ist ein solcher Mechanismus nicht, aber im Film lässt er sich weiterhin prima einsetzen, um wie hier nach 90 Minuten ein spektakuläres Ende heraufzubeschwören. Drehbuch-Autoren spart besagter Hebel eine Menge Hirnschmalz. Das haben sie sich gut gemerkt und lassen ihn seither immer wieder auftauchen. In unserem Fall treffen wir also auf der einen Seite die Borg in ihrer ganzen Pracht und Übermacht, seit Jahr und Tag emsig damit beschäftigt, eine planetengroße Bosheit zusammenzuschrauben. Dann kommt von der anderen Seite die „Voyager“ mit den Janeways im Doppelpack, halst den Borg einen ‚Virus‘ auf, und siehe da: Die Wurmloch-Wundermaschine löst sich samt böser Königin binnen weniger Augenblicke (und gerade noch rechtzeitig vor dem großen Finale) in ihre Einzelteile auf.
Keine Kritik, sondern eher eine ketzerische Frage: Welches notorisch harmoniesüchtige Franchise-Seelchen hat sich bloß die Last-Minute-Romanze zwischen Chakotay und Seven of Nine einfallen lassen? Sie wirkt nicht nur an den Haaren herbeigezogen, sondern einfach lächerlich in ihrem Bemühen, auf Biegen und Brechen ein Happy-End aus dem Hut zu zaubern.
Fazit: Ein Kann, aber kein Muss, dieses nach Schema F weniger verfasste als konstruierte „Star Trek“-Abenteuer; für das Ende einer Ära ein schwacher Abgesang, aber für den Fan natürlich Pflichtlektüre, die immerhin eher langweilt als offen ärgert.
Robert Charles Wilson – Darwinia
Im März 1912 ereignet sich das „Wunder“: Der Kontinent Europa verliert sein bekanntes Gesicht. Während die Topografie erhalten bleibt und alle Flüsse oder Berge noch dort zu finden sind, wo man sie seit jeher kannte, verschwinden Tiere, Pflanzen und Menschen spurlos. Die Städte, Industrielandschaften oder Felder Europas werden ersetzt durch eine bizarre, außerirdische Wildnis, bevölkert von seltsamen, meist sechsbeinigen und in der Regel giftigen Kreaturen.
„Darwinia“ wird das neue Land genannt; ein halb spöttischer Versuch, jenes auf seine Weise völlig ausgewachsen aus dem Nichts entstandene Land zu begreifen, das Charles Darwins epochale, gerade erst halbwegs akzeptierte Lehre von der allmählichen Entstehung und evolutionären Veränderung der Arten Lügen zu strafen scheint. So ist denn auch der alte, halb wissenschaftliche, halb religiöse Streit zwischen den Darwinisten und den „Naochiten“, nach deren Überzeugung Darwinia wie einst die Welt überhaupt in einem einzigen Schöpfungsakt entstand und sich seither nicht mehr verändert hat, wieder aufgeflammt. Die Evolution wird bestritten, Fossilien gelten als göttliche Spielerei, und da die Naochiten nicht nur über eine kopfstarke Anhängerschar verfügen, sondern die Darwinisten fanatisch verfolgen, droht die Forschung auf ein totes Gleis zu geraten.
S. S. Van Dine – Der Mordfall Canary
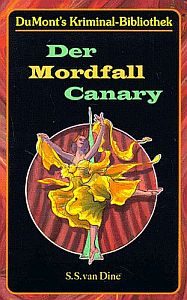
Connelly, Michael – L. A. Crime Report
In drei Großkapitel gliedert der Verfasser in den Jahren 1984 bis 1992 als Kriminalreporter veröffentlichte Berichte. Connelly arbeitete zunächst in Florida und ging später nach Los Angeles. „L. A. Crime Report“ berichtet im ersten Teil über „Die Cops“ (S. 23-150). Sie üben einen Beruf aus, der aufreibend und gefährlich ist, wobei die Gefahr nicht selten von ihnen selbst ausgeht. „Der Anruf“ informiert über einem ganz normalen Tag im Leben der Beamten des Morddezernats von Fort Lauderdale, die den 38. Mord des Jahres 1987 untersuchen, im ihn in mühsamer aber konzentrierter Polizeiarbeit klären.
„Open Territory“ wurde Broward County im Süden Floridas lange genannt. Hier siedelten sich viele Jahrzehnte hochrangige Mafiosi an, die in der Sommerfrische Abstand vom ‚Geschäft‘ suchten. Seit den 1980er Jahren behält sie jedoch die eigens gegründete „Metropolitan Organized Crime Intelligence Unit“ im Auge. Ihre Arbeit wird am Beispiel des Mafiabosses „Little Nicky“ Scarfo erläutert, der ihnen 1987 ins sorgfältig gespannte Netz ging. Einen Schritt weiter geht die US-Polizei im Kampf gegen Verbrecher, die ihr Heil in einer Flucht nach Mexiko suchen. „Grenzüberschreitungen“ garantieren Kriminellen längst nicht mehr die ersehnte Sicherheit vor den US-Behörden. An diversen Beispielen erläutert Connelly die mühsame Zusammenarbeit zweier recht unterschiedlicher Rechtssysteme, in die sich immer wieder nationale Befindlichkeiten mischen.
„Polizisten auf der Anklagebank“ und „Todesschwadron“ erinnern an die kapitale Krise, in die das Los Angeles Police Department Anfang der 1990er Jahre geriet. Rassistische Übergriffe und die unverhältnismäßige Anwendung von Gewalt, die offenbar die Hinrichtung von Verdächtigen ‚in Notwehr‘ einschloss, führten zu einer grundlegenden, längst überfälligen Umstrukturierung des Departments. Eine Erklärung für den nervösen Zeigefinger der Polizisten bietet Connelly in „Von einem Jungen getötet“. Hier rollt er die Geschichte eines 24-jährigen Beamten auf, dem ein minderjähriger Einbrecher die Dienstwaffe entwand, mit der er ihn anschließend erschoss.
Teil 2 – „Die Mörder“ (S. 151-276) – beginnt mit der Geschichte eines Vergewaltigers und Serienkillers, der nach Jahren geschickt vertuschter Untaten eine mörderische ‚Reise‘ durch die Vereinigten Staaten begann, die bis heute nicht in allen Details aufgeklärt werden konnte. Connelly kehrt ein Jahr nach dem Tod des Mörders zu denjenigen Familien seiner Opfer zurück, die damit fertig werden müssen, dass die Leichen ihrer Töchter und Schwestern auf ewig verschwunden bleiben.
„Verhängnisvolle Tarnung“ erzählt die unglaubliche Geschichte eines Hochstaplers, der sich nicht nur eine zweite Identität als CIA-Agent, sondern auch zwei Ehefrauen zulegte. Als nach Jahren das Lügengebäude einzustürzen beginnt, verliert der Mann die Nerven und wird zum Mörder. „Der Stalker“ ist ein Mann, der junge Frauen nicht nur beobachtete, sondern ihnen bald aufzulauern begann. Aufgrund der dünnen Beweislage gelingt es dem hochintelligenten Verdächtigen, der sich vor Gericht selbst verteidigt, Zweifel an der Tatsache seiner Schuld zu säen.
Dass auch gute Arbeit der Polizei nicht immer der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen kann, belegt der Fall eines Vatermörders, dem beinahe das perfekte Verbrechen gelang: Nachdem dieses doch ans Tageslicht kam, ergriff der Täter erfolgreich die Flucht; „Amerikas meistgesuchter Verbrecher“ konnte nie gefasst werden. Anders erging es dem „Ehefrauenmörder“, der fünf Jahre nach seiner Bluttat doch gefasst und verurteilt wurde.
„Wo Gangster um die Ecke knallen“ ist der (deutsche) Titel eines Films, der die komischen Taten einer Bande völlig unfähiger Verbrecher in Szene setzte. Connelly setzt ihn über ein Kapitel, in dem er die Verbrechen der wohl unfähigsten aber nichtsdestotrotz brutal vorgehenden Bande von Mietkillern der Neuzeit beschreibt. In „Böse, bis er stirbt“ zeichnet der Verfasser die fast fünf Jahrzehnte währende ‚Karriere‘ des Gewohnheitsverbrechers Roland Comtois nach, der sich vom Einbrecher zum Räuber, vom Spanner zum Vergewaltiger und schließlich zum Mörder ‚hocharbeitete‘.
Teil 3 (S. 277-395) beschreibt einige banale bis bizarre Mordfälle, mit denen Connelly sich als Journalist intensiv beschäftigte. „Das namenlose Grab“ birgt den Körper eines Mordopfers, das nie identifiziert werden konnte; nicht einmal der Mörder wusste, nach seiner Festnahme befragt, wen er umgebracht hatte. Ein „Doppelleben“ als freundlicher Nachbar und Kapitalverbrecher führte Francis Malinosky, der über Jahre geschickt mit vier Identitäten jonglierte. Der „Tod einer Erbin“ stellte sich erst nach langer Zeit und nur durch Zufall als Familientragödie heraus. In „The Family“ berichtet Connelly vom Aufstieg und Fall eines brutalen Verbrechersyndikats, das im gesamten US-Staat Kalifornien aktiv war. Ein „Leben auf der Überholspur“ führte Billy Schroeder, der jährlich in mindestens 350 Häuser einbrach, um seiner Drogensucht frönen zu können. Parallel dazu schildert Connelly die Leiden seiner Opfer, die sich in ihren Heimen nicht mehr sicher fühlen. „Lag der Täter auf der Lauer?“, fragt der Verfasser anlässlich des Mordes an einer Krankenschwester. „Der Tote im Kofferraum“ gehörte einerseits zur L.-A.-Prominenz, war jedoch andererseits in allerlei Machenschaften verwickelt und betrog die Mafia, die dies auf ihre typische Art quittierte. „Offen – ungelöst“ bleibt wohl auch der Fall eines Handwerkers, der sich allzu neugierig in Gefahr begab und darin umkam.
Einer der besten Autoren des modernen US-amerikanischen Kriminalromans war vor seiner Schriftstellerkarriere Kriminalreporter. Dies war durchaus bekannt, doch erst die Lektüre von „L. A. Crime Report“ lässt erkennen, dass da ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Michael Connelly schildert in einem langen Vorwort seinen Weg, wobei er großen Wert auf die Feststellung legt, dass es den Schriftsteller ohne den Journalisten nie gegeben hätte. Als Journalist sieht sich Connelly auch heute noch, denn nach wie vor bedient er sich der in vielen Jahren erlernten Methoden, was die Plots seiner Thriller aktuell, plausibel und aufregend werden lässt.
Die vielleicht wichtigste Lektion, die Connelly als Kriminalreporter lernte, ist seiner Meinung nach diese: Cops leben mit dem Grauen, aber gute Cops lässt diese Erfahrung nicht zynisch werden. So hat Connelly folgerichtig seine bekannteste Figur gestaltet: Hieronymus Bosch arbeitet in einer Welt der Korruption, der Ungerechtigkeit und der Gewalt, aber trotz aller Nackenschläge resigniert er nicht und macht weiter – „Die Welt ist schlecht“ ist für ihn eine zu banale Binsenweisheit, als dass man sich damit aus der Verantwortung stehlen dürfte.
„L. A. Crime Report“ wird durch ein hochinteressantes Essay des Connelly-Kenners Michael Carlson abgerundet. Präziser als der Schriftsteller selbst findet er die Nahtstelle zwischen dem Kriminalreporter und dem Thriller-Autor. In diesem Zusammenhang greift er auf Connellys Biografie zurück. Beispielhaft legt Carlson offen, wo und wie der Autor für seine Romane auf reale, einst journalistisch begleitete Kriminalfälle zurückgreift. Dies geschah vor allem im frühen Werk, doch auch heute hält Connelly den Kontakt zur Polizei.
Im Zeitalter der DVD werden inzwischen auch Bücher mit diversen Features aufgewertet. Das mag einerseits albern, kann andererseits jedoch von Vorteil sein. „L. A. Crime Report“ wurde in der deutschen Ausgabe durch einen (separat paginierten) Anhang ergänzt. In „Das schwarze Herz“ geht Jochen Stremmel ein weiteres Mal auf das Werk des Michael Connelly ein (und ‚leiht‘ sich dafür den Titel eines Thrillers aus, der von dessen ebenfalls mit Kritikerlob & Publikumsinteresse überschütteten Schriftsteller-‚Kollegen‘ John Connolly verfasst wurde), wobei er manche Informationen ausgräbt, die Michael Carlsons Beitrag ergänzen. Sehr hilfreich ist außerdem eine detaillierte Connelly-Bibliografie, die auch die in Deutschland unbekannten Kurzgeschichten – es sind nur wenige – einschließt.
Vor- und Nachwort sowie ‚Bonusmaterial‘ tragen viel zum besseren Verständnis der in „L. A. Crime Report“ gesammelten Texte bei. Sie beantworten die Frage, wieso diese Beiträge gesammelt und veröffentlicht werden, die doch für die aktuelle Tagespresse geschrieben wurden und deshalb eine relativ geringe Halbwertszeit besitzen. Aber schlauer gemacht durch Connelly, Carlson & Stremmel erkennen wir, dass die meisten Artikel durchaus zeitlos sind. Der ‚Wert‘ eines guten Kriminalreporters misst sich u. a. daran, dass er knapp aber präzise alle Aspekte eines Verbrechens in seine Story einarbeitet. Connelly beschränkt sich nicht darauf, den Cops über die Schultern zu schauen. Er berücksichtigt auch die Seite des Kriminellen, wobei er keineswegs nach dem Motto „Die Gesellschaft ist schuld“ dessen Partei ergreift. Er geht noch einen wichtigen Schritt weiter und befragt die Familienangehörigen und Freunde von Tätern und Opfern. Ein Verbrechen – es muss nicht einmal ein kapitales sein – ist kein isoliertes Geschehen. Es zieht eine Kettenreaktion von Schicksalen nach sich, die aus Behördensicht für den eigentlichen Fall nicht relevant sind. Connelly hat begriffen, dass dies falsch ist bzw. berichtet werden muss, um das Gesamtbild darzustellen. Wie ihm das gelingt, ist über die Brisanz der berichteten Kriminalfälle hinaus eine spannende und lehrreiche Lektüre, die endlich auch den deutschen Lesern ermöglicht wird – ein Indiz für den Bekanntheitsgrad, dessen sich Connelly endlich auch hierzulande erfreut.
Michael Connelly wurde 1956 in Philadelphia geboren. Der „Entdeckung“ der Bücher von Raymond Chandler verdankte der Journalismus-Student der University of Florida den Entschluss, sich selbst als Schriftsteller zu versuchen. Zunächst arbeitete Connelly nach seinem Abschluss 1980 für diverse Zeitungen in Florida. Er profilierte sich als Polizeireporter. Seine Arbeit gefiel und fiel auf. (2006 erschien eine Auswahl in Buchform unter dem Titel „Crime Beat. A Decade of Covering Cops and Killers“ – ein Werk, das übersetzt hoffentlich ebenfalls seinen Weg nach Deutschland findet.) Nach einigen Jahren heuerte die „Los Angeles Times“, eines der größten Blätter des Landes, Connelly an.
Nach drei Jahren in Los Angeles verfasste Connelly „The Black Echo“ (dt. „Schwarzes Echo“), den ersten Harry-Bosch-Roman, der teilweise auf Fakten beruht. Der Neuling gewann den „Edgar Award“ der „Mystery Writers of America“ und hatte es geschafft.
Michael Connelly arbeitet auch für das Fernsehen, hier u. a. als Mitschöpfer, Drehbuchautor und Berater der kurzlebigen Cybercrime-Serie „Level 9“ (2000). Mit seiner Familie lebt der Schriftsteller in Florida. Über das Connellyversum informiert stets aktuell die Website http://www.michaelconnelly.com.
http://www.heyne.de
|Michael Connelly auf Buchwurm.info:|
|Harry Bosch:|
[„Vergessene Stimmen“ 2897
[„Die Rückkehr des Poeten“ 1703
[„Die Frau im Beton“ 3950
[„Kein Engel so rein“ 334
[„Schwarze Engel“ 1192
[„Dunkler als die Nacht“ 4086
[„Das Comeback“ 2637
[„Schwarzes Eis“ 2572
[„Schwarzes Echo“ 958
[„Der Mandant“ 4068
[„Unbekannt verzogen“ 803
[„Im Schatten des Mondes“ 1448
[„Der Poet“ 2642
Keillor, Garrison – Nichts wie weg!
Garrison Keillor kehrt zurück nach Lake Wobegon, der Kleinstadt irgendwo im US-Staat Minnesota, die es leider aufgrund gewisser historischer Fehlentscheidungen nicht auf die Landkarte geschafft hat. So bleiben die Bürger meist unter sich, was ihnen nur lieb ist, je weiter die Schere zwischen Gegenwart und Fortschritt schließt.
Viel zu rasch schreitet das Leben nämlich nach Ansicht vor allem der älteren Einwohner voran. Das kann nichts Gutes bringen, denn Sicherheit bietet allein das Festhalten am Bewährten. Gibt es darüber hinaus Fragen, so stehen für die Lutheraner Pastor Ingquist und für die Katholiker Pater Emil bereit, denn die Bibel kennt Rat für alle Lebensprobleme, auch wenn die Konfessionen die Kenntnis der eigentlichen Wahrheit für sich beanspruchen; besonders Pater Emil hat viel von einem frühchristlichen Missionar an sich.
Aber so wird es gewünscht in Lake Wobegon: Man unterwirft sich den Autoritäten, die deshalb gefälligst Respektspersonen zu bleiben haben. Der Mensch ist schwach, der Versuchungen gibt es viele. Lebensfreude gilt daher als verdächtig. Spaß ist gestattet, wenn die Arbeit getan ist und er von besagten Autoritäten geprüft und freigegeben wurde. Dem echten Bürger von Lake Wobegon ist er trotzdem unheimlich, zumal er oder sie in dieser Stadt niemals ohne Aufsicht bleibt.
Lake Wobegon ist ein Aquarium, dessen Fische die vertraute Umgebung höchst ungern verlassen. Die Krebsbachs, Thorvaldsons, Lundbergs oder Bunsens sind nicht einfach nur Familien, sondern Dynastien, die auf eine anderthalb Jahrhunderte alte Geschichte zurückblicken – eine Zeit, die sie gemeinsam verbracht haben, was zu endlos verflochtenen Stammbäumen geführt hat, die freilich von den älteren Angehörigen problemlos hinuntergebetet werden können.
So geschieht für Außenstehende quasi rein gar nichts in Lake Wobegon, was von den Bürgern freilich gänzlich anders beurteilt wird. Aus diesem Kontrast entsteht die aus dem ersten „Lake Wobegon“-Band (Goldmann-TB Nr. 42234) bekannte und beliebte Komik, in die sich Wiedersehensfreude mischt, treffen wir doch alle lieb gewonnenen, weil skurrilen und verschrobenen Gestalten wieder und lernen sogar einige neu kennen.
„Es war eine stille Woche in Lake Wobegon“ – So beginnt jede der 36 in diesem Band versammelten Erzählungen. Sie tragen zunächst abschreckende Titel wie „Ein Glas Wendy-Bier“, „Hühner“ oder „Das Hochhaus“, die von Banalitäten künden und rührseligen ‚Auf-dem-Land-ist-alles-besser-‚Kitsch androhen. Einerseits zutreffend, andererseits weit gefehlt. Jawohl, es geht um Kleinigkeiten wie den Genuss eines sehr speziellen Biers, das Problem, ein geköpftes Huhn einzufangen, die Wahl eines neuen Wohnsitzes bzw. die trickreiche Verhinderung derselben. Für die Bürger von Lake Wobegon sind dies aber lebenswichtige Fragen. Verfasser Keillor weiß dies. Er nimmt seine Figuren ernst und stellt sie niemals bloß – eine angenehme Abwechslung in einer Gegenwart, die zunehmend Humor mit Klamauk und Schadenfreude gleichsetzt.
Doch hier haben wir es mit echtem Humor zu tun – leise schleicht er sich heran, um den Leser umso heftiger ins Zwerchfell zu springen. Fast sachlich – als echter Chronist eben – beschreibt der Verfasser sein Städtchen und dessen Bewohner. Der Witz entsteht aus dem Widerspruch, der daraus entsteht, dass die Menschen in Lake Wobegon eine sehr exotische Weltsicht haben. Reizvoll ist dabei, dass sie zwar Hinterwäldler, aber keine Rednecks sind, sondern eigenwillige Querdenker. Sie finden für Probleme, die im Grunde keine sind, Lösungen, mit denen man so nie gerechnet hätte.
Wobei hinter dem scheinbar Banalen immer wieder die Realität durchschimmert. Selbstverständlich kann man sich das Lachen nicht verbeißen, wenn Pater Emil wieder einmal seine sündhaften Schäfchen strammstehen lässt. Doch man erkennt auch die Tricks, derer er sich in Vertretung seiner Kirche dabei bedient: Religion à la Lake Wobegon ist auch ein Produkt taktisch eingesetzter Manipulation – natürlich nur zum Besten der Betroffenen, was freilich das Perfide des Systems um so deutlicher werden lässt.
Solche Regeln, die meist Einschränkungen sind, prägen generell das Leben in Lake Wobegon und machen es erst zu dem seltsamen Ort, über den wir, die wir dort nicht leben (müssen), uns so amüsieren. Da ist es nur gut und gerecht, dass auch jene, die an den Strippen ziehen, von der Lex Lake Wobegon nicht ausgenommen sind. Ob Pater, Polizist oder Schuldirektor – sie fangen sich ebenso häufig in den Fallstricken. Das Dorfleben ist da unerbittlich.
Dieser Humor ist still aber stets gegenwärtig. Man kann den Verfasser nur aus tiefem Herzen bewundern, mit welcher Kunst er Wort an Wort, Satz an Satz setzt, ohne die Lake-Wobegon-Atmosphäre jemals zu zerstreuen. Stattdessen macht er sein Publikum süchtig. Man möchte immer weiter und neue Geschichten lesen. Kein Wunder, dass Garrison Keillor sie – glückliches Amerika! – in seiner schon klassischen Radioshow „A Prairie Home Companion“ (s. u.) immer wieder erzählen muss.
Garrison Keillor wurde 1942 im Städtchen Anoka geboren. Es dauerte lange, bis er seinem geliebten und verhassten Heimatstaat entkam. Zunächst schaffte er es jedenfalls nur bis zur Universität von Minnesota, wo er auch seinen Abschluss im Fach Journalismus machte. Hier war es auch, wo er seine lebenslange Liebe zum Radio entdeckte und erste Features über den Äther schickte.
1969 wurde Keillor Journalist und arbeitete für den „New Yorker“. Fünf Jahre später schrieb er einen Artikel über die dortige Oper. Dies inspirierte ihn dazu, zum Radio zu wechseln, wo er eine Liveshow ins Leben rief: „A Prairie Home Companion“ wurde vor Publikum aus einem Theatersaal ausgestrahlt. 13 Jahre lief die Show, dann wechselte Keillor nach New York und startete „The American Radio Company“. Nach vier höchst erfolgreichen Jahren nannte er das Programm wieder „A Prairie Home Companion“. 2006 setzte Regisseur Robert Altman ihm im gleichnamigen Film – seinem letzten – (dt. „Robert Altman’s Last Radio Show“) ein würdiges Denkmal. Allerdings läuft die Show in Wirklichkeit weiter. (Dazu gibt es eine fabelhafte Website: http://prairiehome.publicradio.org.)
Als Schriftsteller hat Keillor bisher Bücher mit geistreichen und amüsanten Geschichten gefüllt, die längst nicht nur um Lake Wobegan, sondern um die generellen Höhen und Tiefen des Lebens kreisen. Dazu kommen drei Kinderbücher, Gedichte und Hörbücher. Garrison Keillor lebt in New York. Er ist verheiratet mit der Violinistin Jenny Lind Nilsson, mit der er eine Tochter hat.
Garrison Keillor findet man im Internet u. a. unter http://www.mindspring.com/~celestia/keillor.
David Moody – Herbst: Beginn (Autumn 1)

Wilson, Charles – Sharks! Gefahr aus der Tiefe
An der Küste des US-Staates Mississippi, dort, wo der gleichnamige Fluss sein riesiges Delta bildet, bevor er in den Golf von Mexiko und damit ins offene Meer mündet, treibt ein Untier sein Unwesen. Die ersten beiden Opfer sind zwei Kinder, und dann erwischt es zwei Fischer, bevor die Behörden aufmerksam werden.
Matt Rhiner von der Küstenwache beschäftigt seit einiger Zeit eine Reihe eigentümlicher Wrackfunde vor der Küste; die Schiffskörper sehen aus, als seien sie auf offener See in eine Schrottpresse geraten. Admiral Vandiver, der Direktor des US- Marinenachrichtendienstes, liebäugelt dagegen mit einer abenteuerlichen Theorie: Was wäre, wenn der sagenhafte Megalodon, eine Haifischart, von der die Wissenschaft vermutet, dass sie mehr als 30 Meter Länge erreichte, nicht wie bisher vermutet vor Millionen von Jahren ausgestorben ist, sondern in der unerforschten Tiefsee überleben konnte und nun durch eine Laune der Natur in die flachen Küstengewässer vertrieben wurde?
Leider hält sich Vandiver, der nicht ohne Grund um seinen Ruf bangen müsste, wenn die Marine von seinem Steckenpferd (bzw. Monsterhai) erführe, sehr bedeckt. Trotzdem ordnet er eine Untersuchung an, weiht aber nur seinen Neffen, den Leutnant zur See Douglas Williams, in seine Theorie ein und schickt ihn an die Küste, um sich dort quasi inkognito umzusehen. So bleibt die Bevölkerung ungewarnt und ahnungslos, während sich einige wahrlich ungeheuerliche Gäste aus der Urzeit der Küste nähern …
Willkommen im Haifischbecken des Fast-Food-Unterhaltungsromans, wo es gilt, möglichst viele Leser zu schnappen, bevor sie merken, dass sie einem Raubfisch in die Falle gegangen sind, der es auf ihr Geld abgesehen hat. Dann ist es meist zu spät, und das Opfer bleibt belämmert und um eine trübe Erfahrung reicher mit einem Buch in der Hand zurück, das es zu Hause verschämt in eine möglichst dunkle Ecke des Regals schiebt.
Dies ist das Biotop, in dem Geschöpfe wie der Autor Charles Wilson prächtig gedeihen. Er hat noch niemals in seiner offensichtlich recht erfolgreichen Karriere einen eigenen Gedanken gehabt und ist stets prächtig damit gefahren, erfolgreiche Vorbilder einfach abzukupfern. Auf seiner Veröffentlichungsliste finden sich außer den \“Sharks\“ das obligatorischen Garn vom dämonischen Serienkiller (\“Ein stiller Zeuge\“) sowie gleich zwei dreiste Rip-offs des Preston/Child-Bestsellers \“Relic – Museum der Angst\“ (\“Ahnherr des Bösen\“ und \“Expedition ins Grauen\“), wobei sich der Autor auch großzügig bei Philip Kerr (\“Esau\“) und selbstverständlich Michael Crichton (\“Congo\“) bedient.
Für \“Sharks!\“ plündert Wilson nun einen anerkannten Klassiker (natürlich ist Peter Benchleys \“Der weiße Hai\“/\“Jaws\“ von 1974 gemeint) und eine echte Gurke (Steve Altens \“Meg – Die Angst aus der Tiefe\“/\“Meg\“, 1997; zwei Jahre später kongenial schundig fortgesetzt mit \“Höllenschlund\“/\“The Trench\“). Man muss ihn schon wieder bewundern, denn wer außer einem wahrlich unerschrockenen Geist würde es wagen, dieses ausgefahrene Gleis anzusteuern? Die Geschichte vom bösen Hai, dem Monster, das aus der Tiefe kommt, den Menschen dort angreift, wo er fremd ist und daher verletzlich, und dadurch beinahe instinktive Urängste weckt, lässt sich nur geringfügig variieren: Hai taucht auf – frisst Schwimmer, Angler, Taucher – wird entdeckt und gejagt – frisst mindestens einen der Häscher – wird gestellt & nach hartem Kampf erlegt. Welche Abweichungen sind von diesem Plot schon möglich? Peter Benchley hat es selbst einmal versucht und dabei den eigenen Klassiker anscheinend auf die Schippe genommen, als er in \“Shark\“ (\“White Shark\“, auch \“Peter Benchley\’s Creature\“, 1995) einen Nazi-\’Wissenschaftler\‘ Menschen- und Haifisch-Gene mischen und ein Ungeheuer erschaffen ließ, das sogar auf dem festen Land umhergeistern konnte.
Wilson ist freilich nicht so souverän. Er geht auf Nummer sicher, und das heißt: mehr Haie, und größer werden sie auch. Nur kennen wir auch die Geschichte vom Baby-Monster, das in die Enge getrieben wird, was seine ungleich größeren Eltern auf den Plan ruft, ebenfalls nur zu gut. Seien wir außerdem ehrlich: Was ist erschreckend an einem 60 (!) Meter langen Hai? Das ist ein derartig übertriebenes Angstbild, dass es sich sofort in sein Gegenteil und damit ins Lächerliche verkehrt.
Der Leser, der vom \“Weißen Hai\“ noch nie gehört haben sollte, wird sich freilich recht gut unterhalten fühlen. Die zusammengeklau(b)ten Versatzstücke montiert Wilson zu einem routiniert geschriebenen Abenteuergarn. Die obligatorische Liebesgeschichte und die Kind-in-Gefahr-Szene fehlen ebenso wenig wie allerlei pseudowissenschaftliche \’Erklärungen\‘ dafür, wieso plötzlich ausgerechnet vor der Mündung des Mississippi luftschiffgroße Urzeithaie auftauchen.
Den schwachsinnigen \’deutschen\‘ Titel hat \“Sharks!\“ freilich nicht verdient. Hier ist Charles Wilson mit \“Extinct\“ (= \“Auslöschung\“) eine viel schönere und dem Rummelplatzcharakter der Geschichte angemessene Kopfzeile eingefallen.
Michel Parry (Hg.) – Die Hunde der Hölle
Browne, Robert Gregory – Devil\\\’s Kiss. Dir bleiben 48 Stunden
Mit einem größenwahnsinnigen Psychopathen sollte man sich besser nicht anlegen. Doch Jack Donovan, Spezialagent beim Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms & Explosives (AFT), nimmt die Jagd auf Alexander Gunderson, den charismatischen Führer der paramilitärisch-terroristischen „Socialist Amerikan Reconstruction Army“ nach langen Monaten längst persönlich. Stets ist ihm Gunderson, der das Spiel mit den Medien perfekt beherrscht und sich geschickt zum Volkshelden stilisiert, durch die Finger geschlüpft. Viel Blut hat die S.A.R.A. – die sogar über eine eigene Website verfügt – inzwischen vergossen, und zwischen Politik und Öffentlichkeit ist das AFT unter Druck geraten.
Endlich scheint Gunderson in der Falle zu sitzen. Mit einigen ‚Kampfgefährten“ sowie seiner hochschwangeren Gattin Sara hat er eine Bank überfallen. Die Gruppe ist umzingelt, doch das hat der Bandenchef vorausgesehen. Man sprengt sich den Weg zum Fluchtwagen frei. Donovan nimmt die Verfolgung auf und kann das Vehikel von der Straße drängen. Wieder entkommt Gunderson, doch Sara bleibt tot auf der Strecke. Der rasende Witwer schwört Donovan schreckliche Rache.
Wochen später ist Gunderson immer noch frei. Donovan nutzt die Kampfpause, um seine ihm seit der Scheidung entfremdete Tochter Jessie besser kennen zu lernen. Der Teeny ist seine einzige Schwachstelle – und genau hier setzt Gunderson an. Er kidnappt Jessie und sperrt sie in ein Erdgrab, das von außen mit Sauerstoff versorgt wird. Anschließend informiert er den Vater und weidet sich an dessen hilfloser Wut. Gunderson stellt keine Lösegeldforderung – er will Donovan quälen. Der Cop setzt Himmel und Hölle in Bewegung. Es gelingt tatsächlich, Gundersons geheimes Versteck zu finden und ihn zu stellen. Die Verhaftung endet als Desaster – Gunderson fängt sich eine Kugel ein und stirbt, ohne zu verraten, wo er Jessie begraben hat.
Knapp 48 Stunden reicht der Sauerstoff, der Jessie am Leben hält. Verzweifelt sichten Donovan und seine Kollegen die wenigen Hinweise, die auf das Erdgrab deuten. Spur für Spur verläuft im Nichts, während die Zeit erbarmungslos abläuft …
Tempo ist sicherlich das Wort, mit dem sich „Devil’s Kiss“ am besten charakterisieren lässt. Es beginnt mit einem furios geschilderten Bankraub und einer spektakulären Flucht mit katastrophalem Ende – und damit geht die Geschichte erst los. 48 Stunden Zeit zur Rettung des hilflosen Opfers, auf das der Autor zur Förderung des leserlichen Nägelbeißens immer wieder ‚umschaltet‘, und keine Hinweise, die dem ermittelnden Beamten – der auch noch der Vater besagten Opfers ist; Browne schreckt vor keinem Klischee zurück, wenn es der Spannung dienlich ist – auf die richtige Spur bringen können.
Natürlich gibt es doch einige Hinweise, die mit manchmal schwer nachvollziehbarer Logik entdeckt und ausgewertet werden. Verbrecher sind keine Supermänner, so Brownes Prämisse, und in diesem Punkt weiß er zu überzeugen, verknüpft die Professionalität der Polizei mit der Tücke des Objekts, die den Vorteil des Kriminellen, der sich an keine Vorschriften halten muss, negieren kann.
Geschwindigkeit ist für Browne auch deshalb wichtig, weil sie den Leser über diverse und oft gewaltige Plotlücken trägt; es bleibt kaum die Chance, diese zu registrieren, denn sofort geht es turbulent weiter. Das ist nur gut so, denn weicht der Verfasser von seinem Patentrezept ab, stellen sich Stirnrunzeln und Langeweile ein. Leider traut sich Browne nicht, Rasanz zum Programm zu erheben. Zwischendurch lässt er es ‚menscheln‘, lässt die komplizierte Vater-Tochter-Beziehung zwischen Donovan und Jessie Revue passieren und stellt damit vor allem unter Beweis, dass er solchen emotionalen Verwicklungen nicht gewachsen ist. Stattdessen schlägt er Opernseife auf TV-Niveau und lässt des Lesers Auge schnell zum nächsten aufregenden Zwischenfall springen, der glücklicherweise garantiert folgt.
Eine echte Überraschung erlebt der Leser nach dem ersten Drittel: Gerade hatte man sich auf ein erbittertes Duell zwischen Donovan und Gunderson eingestellt, da trifft Letzteren eine tödliche Kugel. Damit stirbt die wichtigste und womöglich einzige Spur zur irgendwo begrabenen Jessie. Der verzweifelte Vater muss den Fall völlig neu organisieren und sich auf die Jagd nach Gundersons Komplizen begeben.
Leider verlässt sich Browne nicht auf die Spannung, die aus der Suche nach dem sprichwörtlichen Strohhalm erwächst. Stattdessen schiebt er ein bizarres Kapitel ein, das Donovan nach einem Verkehrsunfall in ein fegefeuerähnliches Reich zwischen Leben und Tod führt. Dort trifft er zunächst einen verstorbenen Cop-Kumpel, der ihm bedeutet, dass seine Zeit noch nicht gekommen ist, und dann Gunderson, der vermutlich auf sein Shuttle gen Hölle wartet; jedenfalls hat er die Gestalt eines Dämons angenommen. Bis ihn der Teufel endgültig holt, kündigt der geisterhafte Terrorist die Fortsetzung seiner Rache an. Als Donovan in die Realität zurückkehrt, hat er das Zweite Gesicht und sieht immer wieder Gunderson teuflisch aus dunklen Ecken grinsen: Der Finsterling hat sich als Geist in seinem Hirn eingenistet! Dieser Weg, die Handlung auf neue Geleise zu bringen, ist zugegebenermaßen extraordinär, doch es kommt ihr nicht zugute. Im Finale geht’s zurück ins kitschige Fantasy-Fegefeuer, wo Donovan buchstäblich mit seinem Dämonen ringt und der Leser um seine Fassung, denn jetzt wird es endgültig lächerlich. Da überrascht es nicht, dass Browne sein krudes Opus mit einem langbärtigen Schlussgag krönt, der zudem eine Fortsetzung androht.
Diese Welt ist schlecht, und wer sie bevölkert, hat allemal Dreck am Stecken. „Gut“ und „Böse“ gibt es nicht, die Menschen bewegen sich juristisch oft und moralisch immer in einer Grauzone. Das ist kein Grund zum Jammern, sondern die Realität, die man gefälligst zu akzeptieren hat. Lässt man sich darauf ein, stellt sich der Alltag als Dasein dar, das weniger Gesetzen als Regeln folgt: Willkommen in Brownes sehr modernem Universum, das elegant die Klischees einer ungemütlichen Gegenwart in den Dienst möglichst spannender Unterhaltung stellt. Politiker sind stets verlogen und sorgen sich ausschließlich um ihre Macht sowie ihren Einfluss, aber keine Sorge: Konzerne oder die Medien denken und handeln ebenso, und das Volk ist so dumm, dass es völlig zu Recht belogen und betrogen wird.
Idealisten werden zu Zynikern, um nicht emotional vor die Hunde zu gehen. Spuren hinterlässt die moralische Camouflage dennoch: Jack Donovan ist als Ehemann und als Vater privat gescheitert. Als ihm die Tochter entführt wird, reagiert er eher manisch als sich auf jene Fähigkeiten zu stützen, die ihn zu einem guten Cop machen. Wie ein wütender Stier walzt er durch die Stadt und hinterlässt eine Schneise der Verwüstung. Will er auf diese Weise wettmachen, was er als Vater versaubeutelt hat? Browne scheint der Ansicht zu sein, dies steigere den emotionalen Druck in dem Kessel namens „Kiss Her Goodbye“. Stattdessen wirkt Donovans Hyperaktivität lächerlich und übertrieben.
Aber Realismus ist Brownes Anliegen ohnehin nicht. Jeder Figur hat er aus bewährten Klischees sorgfältig eine stromlinienförmige Persönlichkeit konstruiert – ein Vorgehen, das er während seiner Tätigkeit als Drehbuchautor in Hollywood erlernt und perfektioniert hat. Also treten weiterhin auf: karrieregeile Schlipsträger, treue Kumpel, eine still vor sich hin schmachtende Donovan-Verehrerin, die pubertierende Tochter von einem fremden Planeten – und natürlich Lumpen, die es offenbar ausschließlich um des Effekts willen finster treiben. Alex Gunderson könnte sich als Schurke für einen „Stirb langsam“-Streifen casten lassen, denn er spielt das kriminelle Superhirn mit Wonne, ohne sich echte Gedanken über den Sinn seiner Streiche zu machen. An seiner Seite stehen Schießbudenfiguren, die aus Leibeskräften so ‚böse‘ sind, dass es die reine Wonne ist, sie unschöne, aber detailfreudig beschriebene Tode sterben zu ’sehen‘.
Lässt man sich auf die ebenso dreisten wie offensichtlichen Manipulationen eines Verfassers ein, der sich seinen Job möglichst einfach macht, indem er den Faktor Originalität vollständig ausklammert, macht die Lektüre freilich auf einer anderen Ebene Spaß. „Devil’s Kiss“ ist Trash der gut gemachten Art. Brownes Stil ist simpel, sein Wortschatz begrenzt. Gleichzeitig verfügt er über einen manchmal zynischen, in der Regel aber trockenen Witz und ein Gespür für die Inszenierung absurder Zwischenfälle. (Obwohl die deutsche Übersetzung offenbar unter Zeitdruck entstand – gleich zwei Übersetzer brachten das Werk ins Deutsche -, liest sie sich flüssig und weiß den leichten Ton zu wahren.) Ohne Brownes Willen zum buchstäblich außerirdischen Plotknaller wäre „Devil’s Kiss“ feines Lesefutter für müde Leserhirne. So reicht der Spaß nur bis zum Hirnriss.
Bevor Robert Gregory Browne (geb. 1955 in Baltimore) sich als ‚richtiger‘ Schriftsteller versuchte, verbrachte er einige Jahre in Hollywood. Ein Stipendium der „Academy of Motion Picture Arts & Sciences“ sicherte ihm den Start in eine verheißungsvolle Zukunft als Drehbuchautor.
Die Wirklichkeit sah anders aus. Brownes Drehbücher wurden ausgiebig durch die Mahlwerke der Hollywood-Maschine gedreht und in der berüchtigten „development hell“ geröstet, ohne dass sie je zur filmischen Umsetzung kamen. Was schließlich nach seinen Büchern gedreht wurde, waren diverse Folgen der TV-Zeichentrickserien „Diabolik“ und „Spider-Man Unlimited“ – für den ehrgeizigen Browne kein Ausgleich für viele Jahre der Frustration.
Browne kehrte der Filmmetropole schließlich den Rücken und setzte sein Wissen um den Aufbau einer vor allem spannenden und rasant erzählten Geschichte in seinem ersten Roman „Kiss Her Goodbye“ um, der vom Verlag |St. Martin’s Press| angekauft und veröffentlicht wurde. Dieser wurde umgehend so erfolgreich, dass Browne sogleich einen weiteren Buchvertrag erhielt.
Robert Gregory Browne hat eine Website (www.robertgregorybrowne.com). Auf http://murderati.typepad.com/murderati/paul__guyot/index.html („Murderati – Mysteries, Murder and Marketing“) führt er (neben vielen anderen Krimi-Kollegen) einen Blog, in dem er sich informativ und humorvoll über Gott & die Welt und seine noch junge Schriftstellerkarriere (sowie ihre Tücken) äußert.
http://www.knaur.de/
|Siehe ergänzend dazu die [Rezension 4083 von Maren Strauß zum Buch.|
Kalla, Daniel – Pandemie
In der chinesischen Provinz Gansu entwickelt sich eine neue Supergrippe, die sich womöglich als Pandemie über die ganze Welt ausbreiten wird. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schickt Dr. Noah Haldane, Spezialist für Infektionskrankheiten, und weitere Spezialisten als medizinische Verstärkung in den Osten, welche dies in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden verhindern sollen und können.
Doch inzwischen haben sich islamische Terroristen in China reichlich mit virenverseuchtem Rotz eingedeckt. Vom fanatischen Scheich Hassan angestachelt, organisiert der ägyptische Zeitungszar Hazzir Al Kabaal im Auftrag der „Bruderschaft der einen Nation“ eine biologische Attacke gegen die verhassten Ungläubigen aus dem Westen. In Somalia haben er und seine skrupellosen Schergen, unter denen sich der irre Mörder-Major Abdul Sabri besonders unrühmlich hervortut, ihre Attentatszentrale und Virenfabrik eingerichtet. Von dort aus schicken sie absichtlich infizierte ‚Märtyrer‘ in ausgewählte europäische und nordamerikanische Großstädte, wo sie sich als Virenschleudern tummeln und brave Bürger anstecken, die planmäßig wie die Fliegen umfallen und für Massenpanik sorgen.
Als die Lumpen ihre schmutzigen Klauen auch gen USA ausstrecken, wird der stets wachsame Geheimdienst CIA aufmerksam. Letzte Klarheit schafft ein Ultimatum der „Bruderschaft“, die einen vollständigen Rückzug der westlichen Truppen aus dem arabischen Raum fordert. Natürlich gedenkt sich die letzte Supermacht auf Erden nicht von dreisten Schurkenstaaten auf der Nase herumtanzen zu lassen. In Zusammenarbeit mit der Bioterrorismus-Abwehr in der Abteilung für Zivilschutz denkt man über einen Militärschlag in Somalia nach. Mit von der Partie ist wiederum Dr. Haldane, der vor Ort nach Hinweisen auf das weitere Vorgehen der Terroristen fahnden soll, was nur gut ist, denn inzwischen hat der endgültig übergeschnappte Major Sabri die Macht übernommen. Seine Virenschmiede haben einen neuen Erreger gebastelt, der noch wesentlich gefährlich ist als der Vorgänger. Mit diesem Virus will die „Bruderschaft“ den Westen endgültig in die Knie zwingen …
Spannender Thriller vor realistischer Kulisse und lachhafte Spukgeschichte auf Privatfernsehniveau – „Pandemie“ ist beides und in dieser Kombination ein Idealbeispiel für jene Instant-Bestseller, die heutzutage als leicht verdauliches Lesefutter palettenweise in die Filialen der Buchhandelsketten geschoben werden. Zur Abwechslung geht es nicht um den heiligen Gral, die Tempelritter oder vatikanische Munkeleien, sondern um das ebenfalls aktuelle Thema Vogelgrippe. Wenn man den Medien Glauben schenken möchte, sitzt diese als moderne Weltpest in den Startlöchern und ist schon längst überfällig. Daniel Kalla gehört zu denjenigen medizinischen Spezialisten, die ebenfalls dieser Meinung sind. Außerdem hat er offensichtlich bemerkt, dass viele unterbeschäftigte und/oder schlecht bezahlte Wissenschaftler und Journalisten sich ein hübsches Zubrot damit verdienen, ihr Fachwissen in Romanform einem zahlenden Publikum zu vermitteln.
Für den schriftstellernden Anfänger ergibt sich das Problem, dass ein Roman etwas ganz anderes als ein Sachbuch oder Aufsatz für eine Fachpublikation ist. Kalla, der hier sein Debütwerk vorlegt, muss erst noch lernen, seinen Hang zum Dozieren in den Griff zu bekommen bzw. in den Dienst der Handlung zu stellen. Es ist lobenswert, dass er an den medizinischen Laien denkt und die Mechanismen einer Epidemie allgemeinverständlich darlegt. Wer viel weiß, dem wohnt freilich in der Regel auch der Drang inne, seine Mitmenschen zu belehren – und es dabei zu übertreiben. (Wer sich ohne literarische Klimmzüge über Epidemien und Pandemien informieren möchte, greife zum modernen Seuchen-Sachbuchklassiker [„Influenza. Die Jagd nach dem Virus“ 2594 von Gina Kollata, erschienen im |Fischer|-Taschenbuchverlag; es ist übrigens das besser geschriebene Buch.)
Mit mehr Hirnschmalz hätte Kalla die eigentliche Story schmieren sollen. Statt eines Plots erdachte er sich eine Plotte. Auch hier gibt die Unerfahrenheit des Verfassers den Ausschlag für diese Negativkritik. Sogar die guten Thriller glänzen selten durch Originalität, die Kreuzung von Katastrophen- und Terroristenmär war schon oft da, sie wird auch noch oft zurückkehren, da sie eingängig und aktuell ist und wohl auch bleiben wird. Ein bisschen Logik darf trotzdem sein. Wie schaffen es beispielsweise Al Kabaals Virenschmuggler, zum richtigen Zeitpunkt exakt dort zu sein, wo die Gansu-Grippe entsteht? Halten sich Terroristen überall bereit, wo eine pandemietaugliche Krankheit auftauchen könnte? Außerdem scheint sich die „Bruderschaft“ über die Bedeutung des Wortes Pandemie nicht klar zu sein: Eine weltweit wütende Seuche würde natürlich auch die islamischen Länder nicht aussparen, was kaum im Sinn der Glaubenskrieger sein dürfte.
So gelingt Kalla nur ein Szenario auf Kasperletheater-Niveau. Die Welt des internationalen Terrors schildert er so, wie sie von der US-Regierung Bush gesehen wird: als Verschwörung menschenverachtender Schurkengruppen, deren Mitglieder entweder Fanatiker oder Irre oder beides sind. Zwar bemüht er sich sichtlich um Objektivität, doch letztlich läuft alles auf ein finales Simpelduell zwischen Gut & Böse hinaus.
Ständig arbeitet Kalla mit billigen Tricks. Der Haupthandlung fügt er einen Nebenstrang ein, der die Recherchen eines ägyptischen Polizisten gegen die Terroristen schildert. Diese Geschichte ist ohne Belang, Kalla erzählt sie, weil er unbedingt zeigen möchte, dass es in der muslimischen Welt neben verrückten Fundamental-Islamisten auch ’normale‘ Menschen gibt. Deshalb muss der arme Sergeant Achmed Eleish im Namen der guten Indianer – halt: Araber sind es hier ja – dem schäumenden Terror-Scheich Hassan eine flammende Anklage ob seiner kriminellen Aktivitäten in die zahnfaulige Fratze schleudern, bevor er, der seinen Dienst damit getan hat, von einem weiteren Burnus-Unhold dramatisch zu Tode gebracht wird.
Ziemlich aufdringlich sind ebenfalls die Anbiederungen an ein möglichst großes US-Publikum. Kalla ist Kanadier, wünscht sich für seinen Erstling jedoch verständlicherweise zahlreiche Käufer. Also schildert er einen Einsatz von US-Rangern in Somalia, der so abläuft, wie es Dabbeljuh Bush sicherlich gern seinen Enkeln als Gute-Nacht-Geschichte erzählen würde: Schneidig hinein geht’s in den Schurkenstaat, das Terrornest wird besetzt und ausgehoben, mit chirurgischer Präzision der Feind ausgeschaltet und ansonsten kein Grashalm gekrümmt. Damit noch der Dümmste begreift, was diese absurde, zudem unbeholfen in Szene gesetzte Episode (bei deren Lektüre sich ein Tom Clancy wahrscheinlich vor Lachen gekrümmt hat) bewirken soll, setzt Kalla auf Seite 406 noch eins drauf:
|“‚Mr. President‘, sagte Gwen, die auf halber Höhe des Tisches saß, und alle Köpfe drehten sich nach ihr um, „Ich habe einem Kameraden der Gefallenen versprochen, Ihnen zu sagen, dass die US-Ranger, die in Somalia gestorben sind, große Amerikaner waren. Jeder Einzelne von ihnen.‘ Er starrte sie mehrere Augenblicke an, bevor ein väterliches Lächeln auf seinem Gesicht erschien. ‚Und ich verspreche Ihnen, dass ich sie als solche ehren werde. Jeden Einzelnen von ihnen.'“| (Im Film hier weihevolle Musik inklusive Trommelwirbel einspielen!)
Dem holzschnittartigen Handlungsverlauf entspricht die Figurenzeichnung. Da haben wir beispielsweise Dr. Haldane, Ende 30, aber immer noch „jungenhaft aussehend“; ein Idealist und Vollblutmediziner, der in Sachen Gesundheit unermüdlich um den Globus jettet und in seiner knappen Freizeit Ehefrau und Töchterlein vergöttert. Aber, ach, die Gattin versteht das nicht, fordert Vollzeit-Balz, betrügt ihn gar – und das auch noch mit einer Frau! Wie gut, dass es Kollegin Gwen Savard gibt, die ebenso idealistisch und gleichaltrig ist, sich jedoch sogar noch besser gehalten hat. Seite an Seite jagt man Viren und Terroristen und kommt sich stetig näher dabei, bis die Neu-Geliebte im Finale klischeegerecht dem Ober-Unhold in die würgenden Hände fällt und vom plötzlich zum Nahkämpfer mutierenden Haldane gerettet werden muss.
Wenn man die Schar der Bösewichte mustert, so scheint Kalla ursprünglich eine gewisse Ausgewogenheit im Sinn gehabt zu haben. Sein Hazzir Al Kabaal ist kein Bin-Laden-Double, sondern wirkt durchaus hin- und hergerissen zwischen tiefer Frömmigkeit und weltlichen Genüssen, zwischen Terrorismus und Schrecken, da Gewalt – so begreift Al Kabaal schließlich – nie die gewünschten Paradiesfrüchte eines Gottesstaats auf Erden hervorbringen wird. Gleichzeitig bleibt er ein Weißkragen-Terrorist, der den Schrecken nur befiehlt und gar nicht wissen will, was er damit in Gang setzt.
Bald beschleicht Kalla Furcht vor der eigenen Courage. Ein Terrorist mit Selbstzweifeln? Das könnte sein Publikum ihm übelnehmen! Also rückt Major Abdul Sabri an die Spitze der Virenschurken. Er ist endlich von jener glasklaren Bösartigkeit, die von den braven Zeitgenossen verstanden wird, welche einfache Freund-Feindbilder favorisieren und sich vor den Fremden aus Nahost fürchten, denen ein grausames Schicksal die ertragreichsten Ölquellen zugespielt hat. Sabri ist nicht nur ein Mörder, sondern – viel schlimmer – ein Heuchler und als solcher eine Schande für seine abscheuliche Zunft: Er terrorisiert nicht, um den Glauben zu verteidigen, sondern weil man ihn einst nicht befördern wollte. Schnöde Rache und andere niedere Beweggründe treiben ihn folglich um. Übergeschnappt ist er außerdem, so dass es völlig legitim ist, ihn wie einen tollen Hund abzuknallen.
Ähnlich gepolte Handlager wuseln um die beiden Zentralschurken herum. Auch sie entgehen ihrem gerechten Urteil nicht. Bis es so weit ist, ergehen sie sich in Hasstiraden gegen die unmoralischen Christenhunde, lassen sich zum Wohl ihrer Sache jede Scheußlichkeit antun, fiebern einem Ende als Märtyrer entgegen und treiben auch sonst viel von jenem stereotypen Unfug, für den der islamische Modellfanatiker in Funk & Fernsehen, Weißem Haus & Hollywood bekannt ist.
Über solche Simplifizierungen und Unterstellungen könnte man lachen oder sie als unvermeidbar für ein Stück Remmidemmi-Literatur wie „Pandemie“ hinnehmen, würde nicht so offenbar, dass es Verfasser Kalla ernst meint. Das ist schade, denn unter allen Dämlichkeiten geht fast verloren, dass ihm eines zu vermitteln gelingt: Eine Seuche wird heute schneller denn je zur Pandemie, weil es auf dieser Welt keine Grenzen mehr gibt, die einem Virus Einhalt gebieten könnten. Prinzipiell jeder Punkt des Erdballs ist per Flugzeug erreichbar, der interkontinentale Fernverkehr längst so intensiv geworden, dass sich die Ausbreitung von Epidemien auf diesem Weg womöglich nicht mehr kontrollieren lässt. Es gibt keine Inseln oder anderen Orte mehr, auf oder an denen man sich in Sicherheit wiegen kann.
Solche Passagen versöhnen zwischenzeitlich mit einem Roman, der ansonsten herzlich wenig bzw. meist das Falsche aus seiner Ausgangsidee macht. Da braucht es keine Terroristen, doch leider traut Kalla seinem eigenen Stoff nicht wirklich. (Haftbar machen sollte man übrigens die zum Teil recht prominenten Schützenhelfer, die „Pandemie“ auf den Umschlagseiten allen Ernstes zum Meisterwerk hochstilisieren; sie sind entweder skrupellos und wurden für ihre Lobhudeleien gut bezahlt oder haben dieses Buch nie gelesen.)
_Autor_
Viel ist nicht über Daniel Kalla bekannt; es lohnt nach der Lektüre von „Pandemie“ ehrlich gesagt auch nicht, im Internet nach Informationsbrocken zu sieben. Also beschränken wir uns auf die kargen Angaben des Verlags. Kalla wurde demnach 1966 geboren und arbeitet als Notarzt im kanadischen Vancouver. Als dort 2003 eine SARS-Epidemie drohte, gehörte er zum Team der Mediziner, die vor Ort für eine Eindämmung der Krankheit sorgen sollten. Die gewonnenen Erfahrungen setzte Kalla 2005 in seinem Romanerstling „Pandemic“ um.
http://www.heyne.de
Martin Edwards – Tote schlafen nicht

Martin Edwards – Tote schlafen nicht weiterlesen
Ketchum, Jack – Beutezeit
Privat und beruflich arg gestresst, beschließt die Lektorin Carla eine Auszeit und mietet sich in Dead River – einem kleinen Ferienort an der Ostküste des US-Staates Maine – eine ruhig und abseits gelegene Holzhütte. Damit die Eingewöhnung nicht so schwerfällt, lädt sie ihre Schwester Marjie, ihren Freund Jim und ihren Ex-Freund Nick ein. Marjie bringt ihren momentanen Lebensgefährten Dan mit, während Nick mit Laura zusammen ist.
Des Nachts kommt sich Carla manchmal beobachtet vor, doch sie schiebt dies auf die Nervosität der ehemaligen Großstädterin. Das wird sich rächen, denn an anderer Stelle erkennt Sheriff Peters, dass Ungutes in Dead River umgeht. Eine Touristin wird halbtot aus dem Meer gezogen. Sie gibt zu Protokoll, von einer Gruppe verwilderter, in Tierfelle gehüllter Kinder und Jugendlicher überfallen worden zu sein, die sie buchstäblich gejagt und über eine Klippe getrieben haben.
Sollte etwas dran sein am Fluch von Catbird Island, einer vor der Küste gelegenen Insel, auf der im 19. Jahrhundert einige Menschen spurlos verschwunden sind? Haben diese etwa eine von Zeit, Zivilisation und Gesetz vergessene Kolonie gegründet, auf deren Speiseplan nicht nur die Wildtiere des Waldes, sondern auch die Touristen von Dead River stehen? Peters recherchiert und muss feststellen, dass in seinem Revier schon lange mehr Menschen verschwinden, als die Statistik es gestattet. So beschließt er, der Sache auf den Grund zu gehen.
Für Carla und ihre Gäste ist es da leider schon zu spät. Sie müssen feststellen, dass ihre Hütte inmitten des ‚Jagdreviers‘ der Wilden steht, die sich hocherfreut über die frische Beute hermachen …
Im Zeitalter brachialer Horrorfilme wie „Saw“, „Wrong Turn“ oder „Seed“ ist es kaum zu glauben, aber dennoch wahr: Als Jack Ketchum 1980 seinen Roman „Off Season“ vorlegte, erhob sich ein Sturm der Entrüstung. Viel zu explizit sei seine Geschichte vom Überlebenskampf einer in der Wildnis gefangenen Touristengruppe mit einer Rotte vertierter Menschenfresser, mahnte bereits der Verlag, der das Manuskript immerhin angekauft hatte. (Die Irrfahrt des Manuskripts beschreiben Horror-Experte Douglas E. Winter in einem Vorwort und Autor Ketchum in einem Nachwort zur Ausgabe von 1999.)
Diese Reaktion überrascht, markieren die Jahre um 1980 doch eine Ära, in der wahrlich schonungslose Filme wie „The Texas Chainsaw Massacre“ (1974; Regie: Tobe Hooper), „The Hills Have Eyes“ (1977; Regie: Wes Craven) oder „Mother’s Day“ (1980; Regie: Charles Kaufman) entstanden, die auf ähnlichen Plots basierten. Aber Ketchum beging eine Sünde, die ihm nicht verziehen wurde: Er lotete nicht nur allzu schonungslos die Abgründe aus, die sich in der menschlichen Seele auftun können, sondern verweigerte seinen Lesern ein Happy-End. Das ist nach Ansicht politisch korrekter Vordenker und selbsternannter Tugendbolde freilich zu meiden; das reale Grauen muss nach ihrer Auffassung symbolhaft durch Umschreibungen getarnt werden, hinter denen sich empfindsame Leser verschanzen können, und im Finale hat ‚das Gute‘ zu siegen (wobei das Niedermetzeln der ‚Bösen‘ dazu keinesfalls im Widerspruch steht).
Vor einem Vierteljahrhundert war ein Verstoß gegen diesen Kodex dem Debütanten Ketchum unmöglich. Also erschien eine zusammengestrichene und entschärfte Fassung, die nichtsdestotrotz für Aufsehen sorgte, obwohl sie der Verlag rasch und unauffällig aus dem Verkehr zog. Die Story ließ sich zum Verdruss der „moral majority“ einfach nicht ihrer Widerhaken berauben, während liberal denkende Zeitgenossen auch im kastrierten Text noch die moralische Sprengkraft erkannten.
„Off Season“ wurde zum Mythos, und 1999 war die Zeit endlich für eine „Unexpurgated Edition“ gekommen. Allerdings hatte der Verfasser das Original zwei Jahrzehnte zuvor frustriert in den Abfall geworfen. Jack Ketchum musste sein Buch quasi aus dem Gedächtnis rekonstruieren. „Off Season“ von 1999 ist deshalb nicht identisch mit dem ursprünglichen Text, zumal der Verfasser die Gelegenheit nutzte, die Geschichte zu überarbeiten.
Bissig ist sie nun wieder. Im 21. Jahrhundert kann „Off Season“ freilich keine Offenbarungen mehr bieten. Die Zeit hat diesen Roman eingeholt. Wer begreifen möchte, welchen Schock er den Lesern von 1980 zumuten sollte, muss entweder die Existenz von Filmen wie „Wrong Turn (1 u. 2)“, „The Hills Have Eyes“ (gemeint sind die Neuverfilmungen, Teil 1 u. 2) oder „Texas Chainsaw Massacre“ bzw. „TCM: The Beginning“ vergessen oder sich bewusst machen, dass „Beutezeit“ eine der Hauptquellen ist, aus denen die jungen Wilden des aktuellen Horrorfilms ihre Inspiration schöpfen.
Dennoch geht es knochenknackend hart und blutspritzend eklig zu. Ketchum redet nie um die Dinge herum – er schildert sie detailgetreu und weigert sich abzublenden. Er lässt uns keine Möglichkeit zum Entkommen, wir müssen mit ihm und den gequälten Figuren den blutigen Weg bis zu seinem Ende gehen.
Dabei schwelgt Ketchum nicht in Metzeleien um der Metzeleien willen, sondern verfolgt einen Zweck mit der Darstellung expliziter Scheußlichkeiten. Das erkennt der Leser schon an einem Gefühl, das sich in den oben genannten Filmen nur selten oder gar nicht einstellt: Unbehagen. In „Beutezeit“ wird nicht zur gruselvergnüglichen Unterhaltung gemordet. Der Tod und vor allem das Sterben sind bei Ketchum schmutzig, ekelhaft, erschreckend. Nicht einmal die im Horrorfilm beliebte ‚Erlösung‘ – das Monster tötet, deshalb ‚dürfen‘ seine Opfer noch gewaltsamer zurückschlagen – gönnt er uns. Der Verweigerung des Happy-Ends geht das Rühren an grundsätzlichen Tabus voran: Nachdem sie ausgiebig von ihren Peinigern geschunden wurde, entdeckt Marjie die eigene, bisher tief in ihrer Seele begrabene Ader für Grausamkeiten. Sie wehrt sich nicht nur, sondern gibt diesem Drang nach, verwandelt sich letztlich selbst in eine Wilde.
Diese Volte, die Ketchum zudem meisterlich in knappe aber eindringliche Worte zu fassen vermag, ist harter Tobak. „Beutezeit“ endet nach dem obligatorischen Gemetzel an den Außenseitern wie gesagt nicht mit einem Happy-End. Der Schrecken lebt in den Überlebenden fort, und niemand weiß, ob oder in welcher Gestalt er erneut ausbrechen wird: ein starkes Ende.
In drei Gruppen gliedert Ketchum seine Figuren, und die ihnen innewohnende Dynamik stellt er trotz der Kürze des Romans sorgfältig dar. Der Blickwinkel wechselt, die Gruppen bleiben bis zum Finale getrennt. Bis dahin machen ihre Mitglieder Erfahrungen, die sie physisch und psychisch zeichnen werden.
Beides trifft natürlich in erster Linie auf die bedauernswerten sechs Urlauber zu, die sich genau dort einquartieren, wo sie fehl am Platze sind. Carla und Marjie, Jim und Nick, Laura und Nick repräsentieren durchschnittliche Männer und Frauen um die 30. Die ersten großen Stürme des Lebens liegen hinter ihnen, sie haben in der Gesellschaft ihre Plätze gefunden. Der Trip in den Wald bereitet ihnen nur insofern Sorgen, als sie die Fortsetzung alter Streitigkeiten fürchten.
Die Attacke der Kannibalen zerstört sämtliche Lebensregeln, die sie erlernt zu haben glauben. Sicherheit ist eine Fiktion, der Zufall dagegen ein mächtiger Faktor. Die starke Carla stirbt, ihre ‚kleine‘, als ’schwach‘ charakterisierte Schwester überlebt nicht nur, sondern entwickelt einen Selbsterhaltungstrieb, der nahtlos in Mordlust übergeht.
Die drei Männer dieser Gruppe ‚versagen‘ in ihrem ‚Auftrag‘, die Frauen zu ‚beschützen‘ – ein weiterer Affront gegen Leser, die eine traditionelle Rollenverteilung schätzen. Nick kommt ihm zwar nach, doch die ‚Belohnung‘ bleibt aus – er findet ein absurd überflüssiges Ende (das Ketchum aus Romeros Filmklassiker „Night of the Living Dead“ ‚übernommen‘ hat, wie er offen zugibt).
Die Gruppe der Polizisten wird dominiert vom Veteranen Peters. Er kennt und liebt seinen Job, obwohl ihm bewusst ist, dass er ihm zumindest körperlich nicht mehr gewachsen ist. ‚Seine‘ jungen Beamten sind noch nicht so weit, sagt er sich, und ahnt dabei nicht, dass auch er überfordert ist, als er das wahre Grauen trifft. Am Ende haben Peters und seine Leute voller Wut und Angst und nackter Mordlust unter den Kannibalen gewütet wie 1968 US-Soldaten im südvietnamesischen My-Lai – eine Anspielung, die Ketchums Leser 1980 sehr wohl registriert haben dürften. Peters bleibt seelisch zerstört zurück und gibt seinen Job auf.
Kannibalen sind es, die „off season“, d. h. außerhalb der offiziellen Urlaubs- oder Jagdsaison, Angst und Schrecken verbreiten. Ketchum gelingt es, sie gleichzeitig abstoßend und – es mag absurd klingen – ‚unschuldig‘ zu zeichnen. In ihrer isolierten Welt haben die Kannibalen nicht nur ihre Nische gefunden, sondern sich dort gemäß ihren Vorstellungen recht behaglich eingerichtet. Sie waren niemals Teil der menschlichen Gemeinschaft und kennen deshalb deren Gesetze und Regeln nicht. Sie haben eigene entwickelt, die wie eine Mischung aus Steinzeit und Ghetto anmuten. Was ihre Opfer als grausam empfinden, ist für sie normal. Das Leben in der Wildnis ist hart und kurz, und es hat diese Gruppe geprägt. Touristen sind für sie nur eine weitere Jagdbeute, die in ihrem Gepäck zusätzlich willkommene Gaben tragen. ‚Zeitvertreib‘ bedeutet Folter und Mord, doch würde man einer Katze solche Motive unterstellen, weil sie mit einer Maus spielt?
Kompromisslos bis in den Tod wehren sich die Kannibalen gegen ihre Angreifer. Sie können gar nicht anders, haben es nie anders gelernt. Schon die Kinder haben den alltäglichen Kampf ums Überleben verinnerlicht. (Übrigens begegnete man „Off Season“ auch deshalb so feindselig, weil Ketchum Kinder als Killer darstellte und sie bestialische Tode sterben ließ.) Deshalb fliehen selbst im Angesicht der finalen Übermacht nicht, obwohl sie die Möglichkeit haben, sondern greifen an. (Gleichwohl ist Jack Ketchum auch nur ein Mensch: Gegen gute Bezahlung wrang er sich 1991 mit „Offspring“ eine Fortsetzung zu „Off Season“ aus dem Hirn: Einige gefräßige Kannibalen-Kinder haben überlebt und terrorisieren eine neue Generation von Touristen …)
Letztlich ist es die Normalität des monströsen Geschehens, die beeindruckt: Das Aufeinandertreffen der drei Gruppen fällt so aus, wie es außerhalb Hollywoods ausfallen musste. Tod und Verderben trifft sie alle, die Grenzen zwischen Tätern und Opfern verschwimmen. Das wollte Jack Ketchum seinen Lesern begreiflich machen, und das ist ihm – zuverlässig unterstützt von Übersetzer Friedrich Mader – wahrhaftig gelungen! Dass womöglich ein schaler Geschmack zurückbleibt, ist gewollt: Manche Medizin schmeckt bitter, aber sie wirkt.
Dass „Jack Ketchum“ ein Pseudonym ist, daraus machte Dallas William Mayr (geb. 1946) nie ein Geheimnis. Er wählte es nach eigener Auskunft nach dem Vorbild des Wildwest-Outlaws Thomas „Black Jack“ Ketchum, der es Ende des 19. Jahrhunderts sogar zum Anführer einer eigenen Bande – der „Black Jack Ketchum Gang“ brachte, letztlich jedoch gefangen und aufgehängt wurde.
Im Vorwort zur deutschen Erstausgabe von „The Girl Next Door“ (dt. [„Evil“) 2151 weist Stephen King außerdem darauf hin, dass „Jack Ketch“ in England der Spitzname für den Henker war und sich als Pseudonym für Mayr wesentlich besser anbietet, denn: „Immer klappt die Falltür auf, immer zieht sich die Schlinge zusammen, und auch die Unschuldigen müssen baumeln.“
Als Jack Ketchum durchlief Mayr diverse ‚Karrieren‘ als Schauspieler, Sänger, Lehrer, Literaturagent, Handlungsvertreter usw. – die typische Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Laufbahn à la USA, nur dass Mayr nie wirklich seinen Durchbruch schaffte, da er sich als reichlich sperriger Schriftsteller erwies, der lieber im Taschenbuch-Ghetto verharrte als der Bestsellerszene Mainstream-Zugeständnisse zu machen – kein Wunder für „ein früheres Blumenkind und früheren Babyboomer, der erkannte, dass 1956 Elvis [Presley], Dinosaurier und Horror sein Leben retteten“. (So liest es sich jedenfalls in Mayrs ‚Biografie‘ auf seiner Website http://www.jackketchum.net.) Noch heute ist der Autor stolz auf eine Kritik der „Village Voice“, die sein Romandebüt „Off Season“ 1980 als „Gewaltpornografie“ verdammte.
Die Literaturkritik musste Mayr alias Ketchum inzwischen als unkonventionellen, aber fähigen Schriftsteller zur Kenntnis nehmen. 1994 gewann seine Story „The Box“ einen „Bram Stoker Award“, was Ketchum 2000 mit „Gone“ wiederholen konnte. Zudem wurde Ketchum mehrfach nominiert. Längst wurde auch Hollywood aufmerksam auf sein Roman- und Kurzgeschichtenwerk, das indes ob seiner Kompromisslosigkeit vor allem im plakativ Sexuellen prüden US-Amerika vor Problemen steht. Nach „The Girl Next Door“ entstand 2007 unter der Regie von Gregory Wilson und nach einem Drehbuch von Phil Nutman und Daniel Farrands ein eindrucksvoller, nicht leicht zu goutierender Spielfilm.
http://www.heyne-hardcore.de
Paulus Schotte – Ein Mann verfolgt sich selbst

Paulus Schotte – Ein Mann verfolgt sich selbst weiterlesen
Hanson, Neil – Nur das Meer war Zeuge
Tollesbury ist eine kleine Hafenstadt an der Nordseeküste der englischen Grafschaft Essex und im 19. Jahrhundert als Heimat besonders fähiger Seeleute bekannt. Trotzdem ist Arbeit rar, die Konkurrenz groß. Der junge Navigator Tom Dudley ist daher nach einem für ihn und seine Familie harten Winter im Frühjahr 1884 geneigt, auf ein verlockendes aber riskantes Angebot einzugehen: Als Kapitän soll er die Rennjacht „Mignonette“ von Tollesbury nach Sidney zu ihrem neuen Eigner überführen – eine Seereise von 10.000 Seemeilen! Dudley ist ein guter Seemann, aber die „Mignonette“ ist zwanzig Jahre alt und wurde für die Küstenschifffahrt, nicht jedoch für die hohe See gebaut. Doch der gute Lohn lockt, und so stellt Dudley nach einigen Schwierigkeiten eine kleine Crew zusammen, mit der er im Mai in See sticht. Mit ihm reisen Edmund „Ned“ Brooks als Vollmatrose und Schiffskoch, der Maat Edwin Stephens und der 17-jährige Richard Parker, der als Leichtmatrose auf seine erste große Fahrt geht.
Kapitän Dudley ist als Hochseeschiffer ein Neuling. Die Sicherheit von Schiff und Mannschaft steht für ihn an erster Stelle. Er steckt einen Kurs ab, der die „Mignonette“ fern bekannter Sturmzonen halten soll. Doch ihm entgeht, dass ihn seine Route weitab der befahrenen Segel- und Dampfschiffrouten führt. Das rächt sich bitter, als am 5. Juli 1884 die „Mignonette“ in einem gewaltigen Sturm binnen weniger Minuten sinkt. Die vier Männer können sich retten, doch als sich die Wogen glätten, finden sie sich auf der halben Strecke zwischen Afrika und Südamerika ohne Lebensmittel und Wasser in einem halb lecken Dingi von gerade einmal vier Meter Länge und 1,20 Meter Breite wieder. Fast drei Wochen halten die Schiffbrüchigen trotz unglaublicher Strapazen und Entbehrungen aus. Am Ende ihrer Kräfte, den Tod unmittelbar vor Augen, berufen sich Kapitän Dudley, Stephens und Brooks auf den „Brauch des Meeres“: Sie töten Richard Parker, den Schwächsten ihrer Crew, und verzehren ihn. Das rettet ihnen das Leben, bis sie Tage später vom deutschen Dreimaster „Moctezuma“ gefunden und aufgenommen werden.
Der „Brauch des Meeres“ ist eine in Seemannskreisen wohlbekannte, doch naturgemäß niemals schriftlich fixierte Regel, rührt sie doch an ein uraltes Tabu. Das soll Kapitän Dudley und seinen beiden Begleitern zum Verhängnis werden. Während sie sich in dem Bewusstsein, etwas Furchtbares, aber letztlich Unvermeidbares getan zu haben, an Bord der „Moctezuma“ allmählich erholen, braut sich über ihren Köpfen ein Sturm ganz anderer Natur zusammen: Kannibalismus passt gar nicht in das Selbstbild der stolzen Seefahrernation England, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Weltmacht aufsteigt. Der brave britische Seemann hat gefälligst gefasst und entschlossen und wenn möglich mit einem Hoch auf die Königin in den Tod zu gehen.
Das Unglück der „Mignonette“ wird zum Politikum, als das Innenministerium beschließt, an Dudley und seinen Begleitern ein Exempel zu statuieren, um auf diese Weise den verhassten „Brauch des Meeres“ endgültig auszurotten. Das unglückliche und völlig überraschte Trio, das aus seiner Tat keinen Hehl macht, wird des Mordes angeklagt. Es entspinnt sich ein Rechtskampf durch alle Instanzen, in dem die Angeklagten niemals eine Chance haben. Sie werden zum willkommenen Bauernopfer in einem politischen Schachspiel, das sie weder verstehen noch fassen können, als sie es endlich durchschauen. Dudley, Stephens und Brooks verlieren alles – ihre Freiheit, ihren Ruf, ihre Würde und schließlich ihre Selbstachtung, als sie in ihrer Not beginnen, einander zu verraten. Nach einem in den Annalen der Justizgeschichte einmaligen und beschämenden Schauprozess, der sich über Monate hinzieht, werden die drei Angeklagten zum Tode verurteilt – und sogleich zu einer sechsmonatigen Haftstrafe begnadigt.
Die Resonanz der Öffentlichkeit und vor allem der Presse hält sich anschließend in Grenzen, und so haben es die Drahtzieher auch geplant. Als die Überlebenden der „Mignonette“ dann freigelassen werden, geschieht dies in aller Stille. Ihr Leben ist zerstört. Verbittert bemühen sie sich um einen Neuanfang, doch die Ereignisse des Jahres 1884 werden sie bis zu ihrem Tode verfolgen.
Als die unglücklichen Überlebenden der „Mignonette“ gerettet werden, hat der Leser gerade die Hälfte des Buches erreicht. Das sorgt für Verblüffung, bis sich herausstellt, dass die Geschichte nun richtig beginnt. Manches Mal werden sich Kapitän Dudley und seine Gefährten wohl gewünscht haben, auf See umgekommen zu sein, während sie durch die unerbittlichen Mühlen der britischen Justiz gedreht wurden. Dem Mord als letztem Ausweg für ein Überleben folgte der ungleich verdammenswertere Mord durch eine unheilige Allianz von Politikern, Richtern und Anwälten und selbsternannten Streitern für den ‚britischen‘ Geist.
Entschlossen ist der Journalist und Historiker Neil Hanson in die mehr als ein Jahrhundert tiefe Schicht von Prozessakten, Zeitungsartikeln und Büchern zum Fall „Mignonette“ abgetaucht, um bis auf den Grund der Geschichte vorzudringen. Das eigentlich Unglaubliche ist ja die Tatsache, dass die Beteiligten des Justizskandals von 1884 ihr Tun kaum verbargen. Deprimierend ist die Erkenntnis, dass dazu auch kein Grund bestand: In den Augen des Gesetzes waren diejenigen, die über Kapitän Dudley und seine Männer ihr Urteil sprachen, durchaus im Recht – jedenfalls aus juristischer Sicht.
Die Urteil stand von vornherein fest. Den Weg dorthin zu verfolgen, ist dank Neil Hanson fesselnd, und die Fakten können wahrlich für sich selbst sprechen Auch die letzte Fahrt der „Mignonette“ und die Leiden der Schiffbrüchigen rekonstruiert der Autor mit großer Meisterschaft. Auffällig ist die kunstvolle Verschränkung der einzelnen Kapitel; im Erzählfluss tauchen immer wieder Brüche in Gestalt interessanter, doch eigentlich nicht zum Thema gehörender Exkurse auf, die jedoch an anderer Stelle plötzlich ihren wahren Sinngehalt offenbaren. Wie nebenbei erhält der Leser auf diese Weise Informationen nicht nur über den Kannibalismus in der Geschichte, sondern auch über die Handelsschifffahrt nach 1850, das Gesellschaftsleben, die Politik und die Justiz im England an der Schwelle zur modernen Industrienation.
Und die haben es durchaus in sich. Allgemein bekannt ist die rohe Grausamkeit, die auf den Schiffen der britischen Kriegsmarine an der Tagesordnung war. Hanson deckt nunmehr auf, dass es auf den Handelsschiffen keineswegs gesitteter zuging. Die perfide Geldgier skrupelloser Geschäftsmänner, die das Recht nach ihrem Gusto beugten, machte es möglich, unschuldige Seeleute auf halb wracken, überladenen und hoch versicherten Frachtschiffen – den berüchtigten „Seelenverkäufern“ – hinaus aufs Meer zu schicken, wo auf diese Weise Zehntausende ein elendes Ende fanden.
Aber auch mit der Solidarität der Seeleute untereinander war es nicht besonders weit her. In Literatur und Film weit verbreitet ist jene Szene, in der die im Ozean treibenden Überlebenden eines Untergangs in der Ferne das Segel eines anderen Schiffes sehen. Jubel angesichts der nahen Rettung bricht aus, und das zu Recht, denn später sehen wir die Geborgenen in Decken gehüllt an Bord des Retters in die Heimat zurückkehren. So selbstverständlich war dies allerdings gar nicht. Hanson legt dar, dass Schiffbrüchige weitaus öfter von anderen Schiffen entdeckt als gerettet wurden. Die Gründe reichten von eigener Lebensmittelknappheit über Furcht vor ansteckenden Krankheiten bis zu blanker Gleichgültigkeit.
Wenn es etwas einzuwenden gibt gegen die traurige, aber fesselnde Geschichte vom „Gesetz der See“, dann ist es der verhängnisvolle Drang des Verfassers, das tatsächliche Geschehen in eine solche zu verwandeln: Dieses Buch ist keine Dokumentation, sondern ein Tatsachenroman. Was Hanson zu dieser Form veranlasste, bleibt unklar; eventuell fürchtete er, seine Leser durch das allzu ausführliche Zitieren zeitgenössischer Quellen zu langweilen. Doch sein Drang, um jeden Preis zu unterhalten, geht auf Kosten der Glaubwürdigkeit. Dafür ist nicht einmal die offenkundige Unbeholfenheit des ehrgeizigen Romanciers verantwortlich, die allerdings auch der arg hölzernen deutschen Übersetzung anzulasten sein mag. (Dies wird unterstrichen durch den deutlichen Bruch zwischen der Geschichte der „Mignonette“ und dem Prozess gegen ihre Besatzung: Beide Teile wurden von verschiedenen – und unterschiedlich begabten! – Übersetzern ins Deutsche übertragen.)
Schlimmer ist Hansons Spiel mit der Realität. Schon früh schwant dem Leser wenig Gutes, wenn er Kapitän Dudley und seine Crew ausführliche und geradezu prophetische, scheinbar im Wortlaut zitierte Gespräche mit dem jungen Parker, dem späteren unglückseligen Menschenopfer, über das „Gesetz der See“ und jene, die ihm folgen mussten, führen sieht. Ans Herz gehen weiterhin zwei Begegnungen der Schiffbrüchigen mit möglichen Rettern, von denen sie jedoch schmählich im Stich gelassen werden. Erst im Nachwort muss man dann lesen, dass Hanson diese Episoden frei erfunden hat – der Melodramatik wegen und weil sich dieses traurige Geschehen so hätte ereignen können. Tatsächlich war die „Moctezuma“ das erste und einzige Schiff, das dem Dingi in den dreieinhalb Wochen seiner Irrfahrt begegnet ist.
Ein solcher ‚Kunstgriff‘ ist unredlich. Was nützt die sorgfältige Recherche, wenn der Leser ständig damit rechnen muss, manipuliert zu werden? Der Verdruss über diese überflüssige Effekthascherei sowie die hausbackene Übersetzung sind denn gewichtige Argumente gegen dieses ansonsten trotz (oder gerade wegen) seines düsteren Themas faszinierende und knapp, aber sorgfältig bebilderte Werk.