
Conrad Anker/David Roberts – Verschollen am Mount Everest weiterlesen
Alle Beiträge von Michael Drewniok
Schreiber, Joe – Untot
Sue Young beginnt sich beruflich wie privat endlich in ihr neues Leben einzufinden. In Boston, US-Staat Massachusetts, lebt sie allein mit ihrer einjährigen Tochter Veda, nachdem Phillip, Ehemann und Vater, den sie schon seit ihrer Kindheit in dem kleinen Flecken Gray Haven kennt, sie vor 18 Monaten verlassen hat.
An einem unfreundlichen Winterabend stürzt Sues kleine Welt neuerlich in sich zusammen. Am Telefon meldet sich ein unbekannter Mann, der sie mit der Nachricht schockiert, Veda und ihr Kindermädchen Marilyn gekidnappt zu haben. Er will kein Geld, sondern fordert Sue auf, sich unverzüglich auf den Weg nach Gray Haven zu machen. Sollte sie sich weigern oder die Polizei verständigen, wird er Veda umbringen.
Sue geht kein Risiko ein. Obwohl in Panik, befolgt sie die Anweisungen des Entführers, der drakonische Strafen für jede Verzögerung oder Abweichung von seinen Befehlen androht. Dass er meint, was er sagt, weiß Sue spätestens dann, als der Mann ihr bei einem Zwischenstopp die Leiche von Marilyn ins Auto setzt.
Zu diesem Zeitpunkt ist Sue allerdings längst zu einem noch tieferen Grauen zurückgekehrt. Sie hatte einen guten Grund, Gray Haven den Rücken zu kehren. Im Sommer 1983 haben sie und Philipp, damals noch Kinder, einen berüchtigten Kindermörder gestellt, umgebracht und die Leiche unter einer Brücke begraben. Sie wurde nie gefunden, bis mehr als zwei Jahrzehnte später der Kidnapper Sue zwingt, die sterblichen Überreste zu bergen und in ihren Wagen zu schaffen, woraufhin die Irrfahrt durch die Nacht weitergeht bis zu einem kleinen Ort an der neuenglischen Atlantikküste.
Zwar versucht Jeff Tatum, ein Teenager aus Gray Haven, die Pläne des Mörders zu durchkreuzen. Er kennt ihn als Isaac Hamilton, einen Serienkiller aus dem Totenreich, und er will dessen Treiben endlich beenden. Sue soll ihm dabei helfen, aber Hamilton ist allgegenwärtig, und er & seine toten Schergen reisen nicht nur schnell, sondern sind auch unerbittlich …
Wo ist er geblieben, der echte, blanke Horror, der kein subtiles Grauen durch Andeutungen und huschende Spukgestalten verbreitet, sondern hart und deutlich die Mächte der Finsternis bei ihrer blutigen Arbeit zeigt? Im Film ist er so präsent wie nie, doch in der phantastischen Literatur fristet er ein Mauerblümchendasein. Unfreundliche Kritiker hassen ihn und haben ihn sofort im Visier, wenn er sein hübsch-hässliches Haupt erhebt. Die Phantastik soll ihr Genre-Ghetto verlassen, gefälligst ‚erwachsen‘ und präsentabel werden, und da stört er gewaltig, denn das wird und will er nie.
Leider sind die meisten Autoren, die sich dem eigentlichen Horror widmen, höchstens Zeilenschinder, die sich und ihre Geschichte durch pure Unfähigkeit nicht nur der Kritik, sondern auch der Lächerlichkeit preisgeben. Nicht viele fähige Schriftsteller lassen es krachen, ohne um ihren Ruf zu bangen, und diejenigen, die es dennoch wagen, zahlen ihren Preis dafür. Dabei kann es ungemein unterhaltsam sein, wenn das Böse sich brachial seinen Weg bahnt. Wieso haben Schlagetots wie Jason Vorhees, Michael Myers oder Freddy Krueger wohl so viele Fans? In diese Runde reiht sich Isaac Hamilton mit seiner Flinte und seiner Vorliebe für zerschossene Augäpfel würdig ein.
Buchstäblich geradlinig erzählt Schreiber seine Geschichte: Sie folgt einem Kurs, der von der Landkarte vorgegeben wird. Die Idee, dass sich Tote wecken lassen, indem ihr ‚Erwecker‘ – in unserem Fall weiblichen Geschlechts – einer bestimmten Fahrtroute folgt, ist fast originell. Vor allem funktioniert sie, denn von Ort zu Ort steigert Schreiber die Intensität, mit der die Toten sich melden.
Dass die unfreiwillige ‚Assistentin‘ des Bösewichts nicht aus der Reihe tanzt, garantiert die Entführung ihrer Tochter. Die Platzierung in der Schublade „Muttertier“ (s. u.) sichert diesen Teil der Handlung und sorgt für zusätzliche Spannung: Wird der grässliche Unhold dem armen Baby wehtun?
Die Antwort soll hier ausbleiben, doch vermutlich genügt die Andeutung, dass Schreiber im Finale seiner Horrorgeschichte einerseits die Munition ausgeht, während er andererseits gewaltigen Pulverdampf verbreitet: Dosierte er den Schrecken bisher sorgfältig, so lässt er ihm nunmehr sämtliche Zügel schießen. Er übertreibt es maßlos, lässt Zombiehorden umhertorkeln, den bitterbösen Hamilton spuken und den Wintersturm rasen. Trotz der geballten übernatürlichen Übermacht kann Sue obsiegen, doch wie sie das schafft, wirkt keineswegs überzeugend.
Selbstverständlich – so muss man heute leider sagen – folgt im letzten Absatz der unlogisch aus der Luft gegriffene, aber gern benutzte Ätsch-Bätsch-Twist, der suggeriert, dass der Schurke gar nicht ausgeschaltet ist, sondern sein übles Spiel umgehend fortsetzen wird: Ring frei für Runde zwei bzw. eine Fortsetzung. Schade, dass Schreiber diesen flauen Trick anwendet.
„Untot“ ist das literarische Gegenstück zu einem Zwei-Personen-Stück. Die schauspielerische Herausforderung wird bei einer eventuellen Verfilmung darin liegen, dass die weibliche Hauptperson beinahe die gesamte Handlung allein bestreiten und auf die zunächst nur per Telefon eingespielten Attacken ihres Gegenspielers reagieren muss.
Einer jungen Mutter wird ihr Kind entführt, um sie zu Handlungen zu zwingen, auf die sie sich sonst niemals einlassen würde; damit sie spurt, droht der Kidnapper immer wieder, dem Kind etwas anzutun: Das funktioniert als Treibriemen für eine eher brachiale als raffinierte Geschichte, denn der Verfasser kann sich auf uralte Klischees stützen: Selbstverständlich wird Susan ihrem Peiniger wortgetreu Folge leisten, denn schließlich ist sie eine Mutter, und als solche – so suggeriert Schreiber – kann sie gar nicht anders. Also bemüht er sich erst gar nicht, der Geschichte eine zweite Ebene zu schaffen, die z. B. Susan beim ernsthaften Versuch zeigt, dem Kidnapper ihrerseits eine Falle zu stellen. Als unfreiwillige Heldin, die dem Hamilton-Spuk endlich ein Ende setzt, wirkt sie deshalb nicht gerade authentisch.
Angst und Not eines unter Druck gesetzten Menschen weiß Schreiber dagegen gut darzustellen. Wie so oft ist die Reise deshalb interessanter als das Ziel. Das schließt Isaac Hamilton ein. Als überlebensgroßer und (scheinbar) unüberwindlicher Gegner leistet er solange einen guten Job, bis Schreiber ihn reden lässt. Als Hamilton damit erst einmal begonnen hat, kann er gar nicht mehr aufhören. Er quatscht und quatscht, bis er sein Geheimnis gelüftet hat. Anschließend stellt er sich in der finalen Schlacht zwischen Gut (Sue) und Böse für ein Gespenst mit mehrhundertjähriger Erfahrung im Schurken & Tücken auch noch denkbar tölpelhaft an. Leider ist Hamilton außerdem nur böse und überhaupt nicht originell, was seine Unzulänglichkeiten umso deutlicher offenbart.
Selbstverständlich ist solche Kritik zu streng und eigentlich fehl am Platz. „Untot“ ist Lesefutter, womöglich Trash. Dennoch fängt die Geschichte vielversprechend an und bleibt auch im Hauptteil spannend. Deshalb mischt sich in die Nachsicht des Rezensenten – der schließlich auch Leser ist – ein wenig Frustration und Zorn: Das mit dem Finale müssen Sie noch lernen, Mr. Schreiber. Ansonsten vielen Dank für ein paar rasante Lesestunden – und Hut ab vor der Entscheidung, diese Geschichte auf nicht einmal 300 Seiten zu erzählen, statt sie wie heute üblich auf das Doppelte oder Dreifache auszuwalzen!
Joe Schreiber wurde in Michigan geboren. In seinen jungen Jahren war er überaus reiselustig, lebte in Alaska, Wyoming und Nordkalifornien, bevor ihn das Familienleben sesshaft werden ließ. Nunmehr arbeitet Schreiber hauptberuflich als Mathematiklehrer an einer Schule in Palmyra (US-Staat Pennsylvania), ist verheiratet und Vater zweier Söhne. „Chasing the Dead“, seinem Romandebüt von 2006, folgte inzwischen „Eat the Dark“.
Selbstverständlich hat Schreiber eine [Website,]http://chasingthedead.blogspot.com die er mit einem Blog kreuzt. Dies zu durchschauen, ist ein wenig kompliziert, denn originellerweise schreibt nicht „Joe Schreiber“ die Einträge, sondern ein (fiktiver und) reichlich unheimlicher Zeitgenosse namens „Jeff“.
http://www.bastei-luebbe.de
Ann Benson – Die siebte Geißel [Plague Tales 1]

Mignon G. Eberhart – Der dunkle Garten

Mignon G. Eberhart – Der dunkle Garten weiterlesen
Pearson, Ridley – einsamste Stunde, Die
Sechs Jahre ist es her, dass Roland Larson, zu diesem Zeitpunkt noch US-Marshall im Dienst des Zeugenschutzprogramms der Staatsanwaltschaft, die Zeugin Hope Stevens bewachte – und sich in sie verliebte. Die junge Frau arbeitete als Beraterin bei einer Untersuchung betrügerischer Versicherungspraktiken im Pflegewesen und hatte festgestellt, dass diese von der Mafia-Familie Romero gesteuert wurden. Auch Auftragsmorde waren im Angebot, wie Hope aufdecken konnte. Die dünne Indizienlage erforderte ihre Aussage vor Gericht, was die Romeros sehr wohl wussten. Sie schickten Paolo, ihren besten Killer, der mit seinem geliebten Rasiermesser ein Blutbad unter Hopes Beschützern anrichtete, von Larson aber vertrieben werden konnte, bevor er sein Opfer erwischte.
Heute arbeitet Larson als Deputy Marshall für die eine Sondereinheit, die überall in den USA nach flüchtigen Kriminellen fahndet. ‚Nebenbei‘ sucht Larson verzweifelt nach Hope, die nach dem missglückten Mordanschlag ins Zeugenschutzprogramm gegangen und später untergetaucht ist, ohne je ihre Aussage zu machen. Sein aktueller Fall führt ihn zurück in die Vergangenheit: Das Justizministerium fordert ihn an, nachdem der Computerspezialist Leopold Markowitz entführt und sein Assistent ermordet zurückgelassen wurde. An dessen Hals finden sich die typischen Rasiermesserwunden des Romero-Killers. Markowitz ist der Autor einer geheimen Datenbank, in der die Hauptzeugen gelistet sind, denen das Justizministerium eine neue Identität verschaffte. Offenbar soll Markowitz diese Datenbank entschlüsseln, für die das organisierte Verbrechen viel Geld zahlen würde.
Auch Hope Stevens steht auf dieser Liste, und tatsächlich ist ihr Paolo schon wieder auf den Fersen. Bisher hat Hope ihre Spuren gut verwischen können. Ihre Achillesferse ist Penny, die fünfjährige Tochter, die Paolo findet und entführt. Das Wiedersehen zwischen Larson und Hope geht daher nahtlos in ein Psychoduell zwischen dem Marshall, der Mutter und dem Mörder über. Wie kann Larson Penny retten, ohne dafür Hope zu opfern? Trickreich umkreist man einander, doch die Vorteile scheinen auf Paolos Seite zu liegen, der ohne Skrupel foltert und tötet, um seinen Auftrag zu erfüllen. Unterschätzt hat er freilich die Entschlossenheit einer Mutter sowie den Trickreichtum eines erfahrenen Marshalls, was die Handlung in den thrillertypischen Final-Showdown münden lässt …
Psychoduelle und wilde Verfolgungsjagden, sauber recherchierte und anschaulich dargestellte Methoden der modernen Verbrechensbekämpfung, Kompetenzrangeleien und Einsatzschwierigkeiten aufgrund gesetzlicher Einschränkungen, im Kontrast dazu das selbstsichere Auftreten des organisierten Verbrechens, das wie ein globalisierter Großkonzern agiert, dazwischen der normale Bürger, der lernen muss, wie dünn die Barriere zwischen Alltag und Chaos ist: Nicht nur Ridley Pearson bedient sich dieser für den Thriller zum Standard gewordenen Elemente, aber er gehört zu den wenigen Autoren, die aus Stroh Gold zu spinnen verstehen.
Auch „Die einsamste Stunde“ – was soll uns dieser völlig sinnfreie deutsche Titel bloß sagen? – ist die Variation des üblichen Pearson-Garns und dennoch ein Pageturner der durchweg gelungenen Art. Der Verfasser startet sofort durch und wirft uns in ein Geschehen, das rasant und brutal ist, ohne sich mit detailfreudig beschriebenen Scheußlichkeiten aufzuhalten. Schon zu diesem frühen Zeitpunkt fällt ein Faktor ins Gewicht, der die Handlung noch oft in unerwartete Richtungen treiben wird: Murphy’s Law ist integraler Bestandteil des Alltags. Jeder Plan kann und wird scheitern, denn die Tücke des Objekts entzieht sich auch dem Profi – und das gilt für Kriminale und Kriminelle gleichermaßen.
Diese Abwesenheit von Perfektion sorgt für ein besonderes Element der Spannung. Stets darf sich der Leser auf eine Überraschung freuen. Helden und Schurken sind ständig zur Improvisation gezwungen, was die Schere zwischen Theorie und Praxis natürlich noch weiter auseinanderklaffen lässt – nicht selten mit spektakulären Folgen.
Um wenigstens den Anschein von Originalität zu erwecken, sind dieses Mal nicht die üblichen Kriminalpolizisten oder FBIler auf Gangsterjagd. Der Titel „Deputy Marshall“ hat seinen Klang aus der Zeit des Wilden Westens in die Neuzeit gerettet. Es gibt dieses Amt in der Tat noch, und Pearson sorgt dafür, dass die Assoziationen noch deutlicher werden, indem er Larson und seine Leute wie einst durch die Lande reiten bzw. reisen lässt, bis das ins Auge gefasste ‚Wild‘ gefunden und gestellt ist.
Deputy Marshall Roland Larson ist der ideale Held für einen Highspeed-Thriller der hier zelebrierten Art. Er wirkt als harter, professionellen Umgang mit dem Verbrechen gewohnter Mann ebenso überzeugend wie als unglücklich Liebender und zu allem entschlossener Vater. Zwischen diesen drei Zuständen lässt ihn der Autor ausgiebig pendeln, was ebenso für Spannung wie für seifenoperliche Menschlichkeit sorgt, wobei Pearson Profi genug ist, für den notwendigen Ausgleich zwischen den Ebenen zu sorgen.
Natürlich muss er mit dem üblichen Problem kämpfen: Wie junge Hunde reißen Kinder die Aufmerksamkeit des Lesers unwillkürlich an sich. Sogar unter Pearsons kundiger Feder macht sich Penny selbstständig und sorgt für zunehmendes Stirnrunzeln, wenn sie dem angeblich perfekten, gefühlskalten, unbarmherzigen Killer Paolo immer wieder Paroli bietet. Letztlich wirkt Penny wie ein Instrument – das „Kind in Not“, mit dem die Spannung billig zusätzlich gesteigert werden soll.
Für Hope Stevens bleibt die undankbare Rolle des meist tränenüberströmten Muttertiers, das nichtsdestotrotz unbeirrt die Rettung der verschleppten Tochter vorantreibt und dafür zu allen Schandtaten bereit ist. Mehrfach hat sie Paolo fast schon am Schlafittchen, aber dann wirft sich wieder ein treuer Kumpel von Marshall Larson in die Schusslinie (bzw. in die Bahn seines sausenden Rasiermessers), und die Jagd kann weitergehen. Zwischendurch darf Hope ihr computerliches Fachwissen ausmotten, was Larson auf die Spur der grauen Schurken-Eminenz im Hintergrund bringt, denn Paolo ist längst nicht der einzige Unhold, der sich auf Hopes Spur gesetzt hat.
Paolo, der Profi-Killer mit dem Rasiermesser, gehört zu den kunstvollen, aber völlig unrealistischen Mordgestalten, die eigentlich nur in Hollywood und im Thriller ihr Unwesen treiben, während sie in der Realität aufgrund ihres theatralischen Auftretens und ihrer alltagsuntauglichen Angewohnheiten rasch Schiffbruch erleiden würden. Einerseits ist Paolo ein wahrer Übermensch, der sich nach Belieben durch die Maschen des Gesetzes windet, ohne dass ihm dessen Vertreter Einhalt gebieten können. Andererseits hat er einen gewaltigen Riss in der Hirnwaffel, pflegt ein ungesund intimes Verhältnis zu seiner bevorzugtem Mordwaffe – dem Rasiermesser -, mit dem er nicht nur seine Opfer umbringt, sondern sich auch selbst verstümmelt. Das eine passt nicht zum anderen, aber es macht Paolo zu einer Figur, die unberechenbar bleibt, Schrecken verbreitet und den Helden mit einem (scheinbar) ebenbürtigen Gegner konfrontiert.
Die wie gestanzt wirkende Figurenzeichnung erinnert uns daran, dass Ridley Pearson mit allem ihm zur Verfügung stehenden Talent und allen Mitteln primär den Zweck verfolgt, uns, seine Leser, zu unterhalten. Dabei geht er ökonomisch vor, d. h. er gibt niemals vor, das Rad neu zu erfinden, sondern bedient sich der bekannten Plots und Figuren des Thrillers. Sein Geschick besteht darin, das eigentlich Bekannte so gut & spannend zu variieren, dass wir ihm, dessen Tricks wir durchaus durchschauen, dennoch freiwillig und gern auf den Leim gehen. Silber vergeht, Leder besteht – Ridley Pearson stellt abermals auf höchst unterhaltsame Art klar, wie wahr dieses alte Sprichwort ist.
Ridley Pearson (geb. 1953 und aufgewachsen in Riverside, US-Staat Connecticut) gehört zur nicht gerade kopfstarken Gruppe der Kriminal-Schriftsteller, die den Zuspruch des Publikums ebenso wie das Wohlwollen der Kritik für sich in Anspruch nehmen können. Im Vordergrund steht die Krimiserie um das Polizistenduo Lou Boldt und Daphne Matthews, die seit vielen Jahren ihr hohes Niveau halten kann.
Dabei hat Pearson eigentlich recht lärmend mit rasanten Spionage- („Never Look Back“, 1985, „Blood of the Albatross“, 1986) und Katastrophen-Thrillern wie „The Seizing of Yankee Green Mall“ (1987, dt. „Ultimatum“) begonnen. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurden seine Fähigkeiten auf dem Gebiet des Unterhaltungsromans deutlich: Gründliche Recherche, Ideenreichtum und glaubhafte Figuren verbinden sich bei ihm mit einem schnellen, spannenden, ‚filmisch‘ anmutenden Handlungsablauf zu selten origineller, aber stets kurzweiliger Unterhaltung.
Das wurde sogar im fernen England zur Kenntnis genommen, wo Pearson 1991 als erster US-Amerikaner überhaupt ein „Raymond Chandler Fulbright“-Stipendium an der Universität zu Oxford erhielt; zwei „Lou Boldt / Daphne Matthews“-Romane entstanden hier.
Pearson ist ein talentierter Musiker, dessen Repertoire von Folk Rock bis Filmmusik reicht. Bekannt ist er als Bassgitarrist der Band „Rock Bottom Remainders“, in der hauptsächlich Schriftsteller spielen, darunter Stephen King, Dave Barry, Amy Tan und Mitch Albom.
http://www.bastei-luebbe.de
|Siehe ergänzend dazu auch unsere Rezension zu [„Die letzte Lüge“. 1602 |
Dan Simmons – Terror

Jed Rubenfeld – Morddeutung
Im August des Jahres 1909 empfangen die Psychoanalytiker Stratham Younger und Abraham Brill im Auftrag der Clark University in New York die europäischen Väter ihrer noch jungen Wissenschaft: Aus Wien besucht sie Sigmund Freud in Begleitung seiner Schüler Sándor Ferenczi und C. G. Jung. Der berühmte Analytiker wird von den wissenschaftlichen Kollegen, die ihn für einen Scharlatan halten, stark angefeindet. Die Einladung in die USA gab Freud die Gelegenheit, dem Streit für einige Zeit aus dem Weg zu gehen und sich unter freundliche Kollegen zu begeben.
Die gelehrte Männerrunde wird durch ein aktuelles Verbrechen herausgefordert. Ein brutaler Serienmörder überfällt junge Frauen hohen gesellschaftlichen Standes, foltert und erdrosselt sie mit einer Seidenkrawatte. Sein letztes Opfer, die 17-jährige Nora Acton, konnte durch Schreie rechtzeitig auf sich aufmerksam machen und wurde gerettet. Der Schock hat allerdings die Erinnerung an die Untat gelöscht. Younger, der selbst zur Highsociety gehört, kann dem Bürgermeister von New York, der persönlich die Ermittlungen in diesem delikaten Fall leitet, die Idee schmackhaft machen, Nora psychoanalytisch zu behandeln und so die Gedächtnisblockade zu lösen. Freud steht ihm beratend zur Seite. Jed Rubenfeld – Morddeutung weiterlesen
Kenn Harper – Die Seele meines Vaters. Minik: Der Eskimo von New York
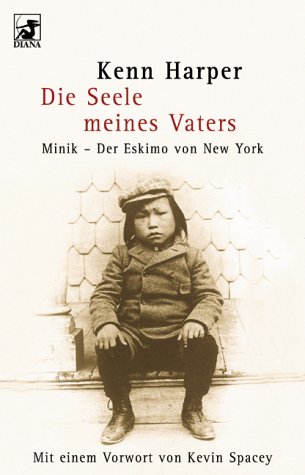
Kenn Harper – Die Seele meines Vaters. Minik: Der Eskimo von New York weiterlesen
Maples, William R. / Browning, Michael – Knochengeflüster. Mysteriösen Kriminal- und Todesfällen auf der Spur
So mancher Berufszweig wird sich insgeheim glücklich schätzen über den weltweiten Siegeszug des Privatfernsehens, beschert ihm dieses doch die Aufmerksamkeit eines Publikums, das sich noch vor wenigen Jahren eher vor Lachen gewunden hätte oder vor Grauen geflohen wäre. Mit „Quincy“ (über den sich Maples amüsant zu beklagen weiß) und Gideon Oliver fing es schon vor Jahren sacht an, mit Patricia Cornwells Detektiv-Pathologin Kay Scarpetta oder Kathy Reichs‘ Temperance „Bones“ Brennan explodierte die Thriller- und „True Crime“-Szene förmlich vor Knochendetektiven. Seitdem giert die Welt nach Nachrichten und Bildern aus dem Leichenschauhaus, und sie bekommt reichlich, was sie begeht: wahrlich realen Horror und die Bekanntschaft mit jenen Menschen, die sich von Berufs wegen mit Leichen beschäftigen.
Zu ihnen gehört das exotische Völkchen der forensischen Anthropologen, das sich streng wissenschaftlich bemüht, aus den knöchernen Überresten meist übel geendeter Zeitgenossen deren Schicksal zu rekonstruieren. William R. Maples vom „Human Identification Laboratory“ des Florida-Museums für Naturgeschichte (das wiederum der örtlichen Universität angeschlossen ist), gilt seit Jahrzehnten als einer der Meister seines Faches.
Maples (unauffällig unterstützt von Co-Autor Michael Browning) schildert zunächst seine abenteuerlichen Jugend- und Wanderjahre – die offenbar zu allen Zeiten drückende Akademiker-Arbeitslosigkeit trieb ihn sogar zum Pavianfang nach Afrika -, welche – so ist das typisch für Biografien wie diese – schon die spätere Berufswahl anzukündigen schienen. Einen ersten Vorgeschmack erfuhr der junge William sogar bereits im zarten Alter von elf Jahren, als sich ihm die Möglichkeit bot, gemeinsam mit dem Vater und einem befreundeten Polizeibeamten die Autopsiefotos des berühmt-berüchtigten Verbrechenpärchens Bonnie & Clyde anzuschauen. Welches Kind könnte dieser Verlockung widerstehen …?
Schon wenige Jahre später verbrachte Maples glückliche Zeiten in der Gesellschaft malerisch verwester und zuvor erschossener, erschlagener, verbrannter, zersägter, zermahlener oder sonstwie einfallsreich zugerichteter Leichen. Darunter befanden sich so illustre Gestalten wie Francisco Pizarro (1478-1541), die koloniale Geißel Mittelamerikas, Zachary Taylor (1784-1850), Präsident der Vereinigten Staaten, den ein Imbiss aus rohem Gemüse, frischen Kirschen und eisgekühlter Buttermilch (kaum verwunderlich) auf das Sterbebett warf (oder war es doch eine Prise Arsen …?), Joseph Merrick, der „Elefantenmensch“ (dessen Skelett einst Michael Jackson käuflich erwerben wollte) oder die 1918 dilettantisch niedergemetzelte russische Zarenfamilie.
Aber auch über die ganz ’normalen‘ Toten weiß Maples grausige Geschichten zu erzählen. Mit Details (teilweise unerfreulich, wenn auch relativ dezent durch Fotos verdeutlicht) geizt er nicht, aber man muss ihm zugute halten, dass er nie wirklich spekulativ wird. Jawohl, die forensische Anthropologie weist als Wissenschaft bizarre Züge auf, und es ist schon eine besondere Sorte Mensch, die sich hier um die Wahrheitsfindung verdient macht. (Ich empfehle die ebenso beispielhafte wie bemerkenswerte Episode mit dem Leichentransport im nagelneuen Familienauto an einem heißen Sommertag …) Es ist durchaus faszinierend zu lesen, wie schwierig es heutzutage ist, eine unerwünschte Leiche tatsächlich verschwinden zu lassen. Der modernen Wissenschaft kann es gelingen, aus 10.000 (Maples hat nachgezählt …) Knochensplittern eines verbrannten Skeletts die Identität eines Menschen zu rekonstruieren. Schlechte Zeiten für Mörder also – wenn sie nicht darauf zählen könnten, dass Experten vom Schlage eines William Maples eher rar auf dieser Erde sind.
So kann man sich denn über „Knochengeflüster“ wohl ob des dämlichen deutschen Titels grämen (den amerikanischen Kollegen ist allerdings auch nichts wirklich Originelles eingefallen), doch dem Werk insgesamt Informationsgehalt und Unterhaltungswert keinesfalls absprechen. Sich über das Berufsbild eines Forensikers informieren zu wollen, ist keine Schande und verrät auch nicht den zukünftigen irren Serienmörder. Interesse und selbst sachte Neugier sind nur menschlich; bedenklich wird es erst, wo beides in kruden Ekeltourismus übergeht. (Das Internet wartet in dieser Beziehung mit einigen Überraschungen auf!)
Aber das muss sich Maples hier nicht vorwerfen lassen. Wer kann es ihm verdenken, dass er, der so viel weiß und zu erzählen hat, die Chance nutzen möchte, das Bild seines Berufsstandes ein wenig aus dem fahlen Dunkel des Seziersaals ins rechte Tageslicht zu rücken? Wie man mit dem Tabu-Thema Leichenforschung am besten umgeht, schildert der Autor an passender Stelle in der Einleitung: nämlich nüchtern und ohne vorgefasste Ressentiments.
Der normalsterbliche Zeitgenosse wird zwar auch nach der Lektüre einen weiten Bogen um jene Stätten schlagen, in denen die Kunst Dr. Maples und seiner Kolleginnen und Kollegen blüht, aber er hat aus der Flut einschlägiger und in der Regel wesentlich effekthascherischer ‚Sachbücher‘ einen Titel gefischt, der sich des Themas recht seriös annimmt, sehr gut geschrieben ist und auch noch sorgfältig übersetzt wurde!
http://www.springer.com/dal/home/birkhauser
http://www.heyne.de
Preston, Robert / Child, Lincoln – Maniac – Fluch der Vergangenheit
Von seinem ebenso bösartigen wie verrückten und genialen Bruder Diogenes als Mörder, Verschwörer und Verräter gebrandmarkt, wurde Aloysius Pendergast in das gefürchtete Bundesgefängnis von Herkmoor im US-Staat New York eingeliefert. Von missgünstigen FBI-Kollegen, die den unkonventionell vorgehenden Spezialagenten stets hassten, unter Ignorierung diverser Menschenrechte übel in die Zange genommen, gedenkt Pendergast den Kampf gegen Diogenes keineswegs aufzugeben, zumal ihm dessen bedrohliche Ankündigungen weiterer Verbrechen noch in den Ohren klingen. Der Gefangene kann sich auf seine Freunde ‚draußen‘ verlassen. Lieutenant Vincent D’Agosta, Pendergasts ‚Chauffeur‘ Proctor und der brillante Profiler Eli Glinn arbeiten fieberhaft an einem Plan zur Befreiung.
Derweil geht im „New York Museum of Natural History“ zum wiederholten Male ein Monster um. Wie üblich ist das Haus in Geldnöten, soll eine spektakuläre Ausstellung Besucherströme anlocken. In einem seit 1935 sorgfältig vermauerten Kellerraum der riesigen Anlage findet sich das Grabmal des altägyptischen Wesirs Senef, der um 1400 vor Christus regierte. Um seine letzte Ruhestätte ranken sich allerlei unerfreuliche Legenden von einem Fluch, die von denen, die besagtes Grab für die Ausstellung vorbereiten sollen, selbstverständlich abgetan werden.
Doch dann beginnt der Tod umzugehen. Techniker und Wächter gehören zu den ersten Opfern, die entweder schrecklich verstümmelt oder gar nicht aufgefunden werden. Wie üblich mauert die Museumsleitung, die schlechte Publicity mehr fürchtet als das grausige Ende unwichtigen Personals. Laura Hayward, Leiterin der Mordkommission, sieht das naturgemäß anders. Auch Reporter Bill Smithback ist wie immer am Ball. Die Naturwissenschaftlerin Margo Green könnte ein wenig Licht in die Sache bringen, doch sie liegt nach einem Mordanschlag noch im Krankenhaus und wurde gerade von ihrem Vorgesetzten Hugo Menzies, dem Chef der Ethnologischen Abteilung des Museums, durch eine Injektion ins Koma versetzt.
Hinter all dem könnte nur Pendergast die Hand seines Bruders erkennen, aber als er endlich wieder in Freiheit ist, muss er erkennen, dass Diogenes seine Ränken noch viel weiter als befürchtet getrieben und Zweifel im innersten Kreis seiner Feinde gesät hat. Und falls doch etwas schieflaufen sollte, hütet Diogenes ein Geheimnis, das den guten Aloysius in einem neuen, recht düsteren Licht erscheinen ließe …
In zahlreichen Tonlagen hat Ihr Rezensent sich in den vergangenen Jahren über Freud‘ und Leid verbreitet, die von den Pendergast-Romanen des bienenfleißigen Autorengespanns Preston & Child ausgehen. Eine weitere Strophe hinzuzufügen, ist ehrlich gesagt ermüdend, denn auch dieses Mal weichen Handlung oder Figurenzeichnung kein Jota vom Bewährten, aber leider auch Bekannten ab.
Das hauptsächliche Publikum der Fließband-Thriller von Preston & Child rekrutiert sich aus den jüngeren Generationen, wenn man sich die heutzutage leicht zugänglichen Kommentare der überwiegend zufriedenen Leserschaft anschaut. Noch leicht zu begeistern und ohne Wissen um die klassischen und trivialen Vorbilder, die von den Autoren geplündert wird, fehlen ihm außerdem Wunsch oder Willen, das leicht gestrickte Garn einer näheren Prüfung zu unterziehen.
So betrachtet, hat „Maniac“ durchaus seine Meriten. Wieder einmal rollt schnell und spannend ein durchgestyltes Geschehen ab. Während „Dark Secret“ als Mittelteil der Aloysius-und-Diogenes-Trilogie quasi ‚offen‘ beginnen und ausgehen musste, werden im dritten Teil endlich die zahlreichen offenen Enden zu einem festen Knoten zusammengeführt.
Wem reine und – wir werden gleich mehr darüber erfahren – kühl konstruierte Unterhaltung genügt, der wird sich erfreut durch das Endprodukt lesen (was ein überaus luftig gestaltetes Druckbild mit nicht allzu vielen und augenfreundlich groß gedruckten Buchstaben zusätzlich erleichtert). Die so gestimmten Konsumenten mögen getrost die nächsten Absätze überspringen. Sie interessiert es sicherlich nicht, wie geschickt (oder dreist – das hängt vom Standpunkt des Betrachters ab) sie von Preston & Child aufs Kreuz gelegt werden.
„Maniac“ präsentiert sich mehr noch als die ohnehin zunehmend zum Selbstplagiat neigenden früheren Bände der Pendergast-Serie als „Best-of“ schon mehrfach in Anspruch genommener Situationen und Schauplätze. Wieder einmal muss das „New York Museum of Natural History“ als Ort des Geschehens herhalten. Die dunklen, tüchtig eingestaubten und mit obskuren Präparaten und vergessenen Ausstellungsobjekten vollgerümpelten Katakomben dieses Hauses gaben für „Das Relikt“ eine Kulisse ab, die so grandios einschlug, dass die Autoren sich seither denkfaul allzu gern wieder hier einnisten, obwohl der daraus resultierende Überraschungseffekt längst dahin ist.
Bisher haben sich Preston & Child ausgleichend mit der Variation ihrer vorgestanzten Story-Elemente einige Mühe gegeben. Das ersparen sie sich dieses Mal ebenfalls: Der Höhepunkt des Romans – Diogenes sperrt die High Society von New York in ein unzugängliches Grabgewölbe ein und lässt sie mit einer Mischung aus High Tech und Mumbo Jumbo effektvoll das Zeitliche segnen, während sich die Guten verzweifelt Einlass zu schaffen versuchen – ist eine schamlose Eins-zu-eins-Kopie des „Relikt“-Finales. (Geht’s noch schlimmer? Aber immer! Wie weiland Sherlock Holmes mit Dr. Moriarty an den Reichenbachfällen, ringt auch Diogenes schließlich am Rande eines Abgrunds mit einem Todfeind.)
Bis es so weit ist, müssen wir uns durch einen erschreckend langweiligen Mittelteil quälen. Er ist der Vorbereitung von Pendergasts „Prison Break“ aus einem B-Movie-Gefängnis gewidmet, das von psychotischen Irren bewohnt und von Butzemann-Sadisten geleitet wird. Währenddessen scharwenzelt Diogenes zwischen diversen Schurkentaten um die blasse Constance herum, ringt Knurr-Cop D’Agosta um seine Ehe, die in dieser Geschichte völlig überflüssige Margo Green um ihr Leben und ein ebenso nebensächlicher Smithback um die Wahrheit, die wie üblich von einer intriganten Museumsleitung im Verbund mit skrupelloser Polit-Prominenz verschleiert werden soll. Niemand hat aus den Museumsmorden der Vergangenheit etwas gelernt; exakt dieselben Fehler werden begangen, endlose Streitgespräche geführt und sogar die Langmut hirngedimmter Leser über Gebühr strapaziert. Derweil springt die Handlung ständig von einem Schauplatz zum nächsten; sie bricht nach dem Cliffhanger-Prinzip dort ab, wo es spannend wird, und kehrt erst später dorthin zurück: ein klassischer Kniff, der freilich zum billigen Trick degeneriert, wenn er so inflationär wie hier zum Einsatz kommt.
Schade, denn es begann eigentlich recht vielversprechend. Der Fluch der Pharaonen zieht als Aufhänger einer auf Turbulenz gebürsteten Geschichte auch heute noch. Preston & Child verstehen zudem die handwerkliche Seite ihrer Arbeit. Sie belegen in einzelnen Passagen, wie spannend sie zu schreiben vermögen. Leider ignorieren sie zunehmend die Verpflichtung, ihren Romanen wenigstens einige Tropfen Inspiration hinzuzufügen und so aus Reißbrett-Mysterien richtige Thriller zu machen.
Die Wiederholung des sattsam Bekannten setzt sich selbstverständlich in der Figurenzeichnung fort. Aus „Relic“/“Das Relikt“ und „Attic“ treten Anthropologin Margo Green und Reporter Bill Smithback auf, der zusammen mit einer weiteren alten Bekannten, der Archäologin Nora Kelly, auch in „Thunderhead“ oder „Ice Ship“ Abenteuer erlebt; Profiler Eli Glinn kommt gleichfalls vom „Ice Ship“. Längst gibt es einen eigenen Preston-und-Child-Mikrokosmos, dessen Bewohner immer wieder im Rampenlicht tanzen müssen. (Unter www.prestonchild.com/faq/pangea stellen ihn die Verfasser übrigens en detail vor.) Wie sinnvoll das jeweils ist, bleibt Nebensache. Bill Smithback und vor allem Margo Green bleiben in „Maniac“ jedenfalls, wie schon erwähnt, höchstens Statisten, die ihren anscheinend obligatorischen Gastauftritt geben.
Pendergast bleibt Pendergast. Dieses Mal muss er Farbe bekennen und Gefühle zeigen, was ihm schlecht steht. Superhelden mit Schwächen wirken menschlicher, was allerdings geschickter in Szene gesetzt werden muss als hier. Schlimmer als Aloysius muss jedoch Diogenes Federn lassen. Sein monumentaler, 15 Jahre (!) vorbereiteter, unfassbar komplizierter Masterplan entpuppt sich als Rache eines Kindes, das vom eifersüchtigen Brüderlein hereingelegt wurde, welches sich dafür nie entschuldigt hat … Drei dicke Buchbände haben Lincoln & Child uns nicht nur ein kriminelles Superhirn suggeriert, das letztlich nicht nur mit heißer Luft gefüllt ist, sondern auch ein lächerliches Ende findet.
Ähnlich unglaubhaft – und damit angemessen – schildert das Autorenduo das weitere Schicksal von Constance, deren schon oft mit dem Zaunpfahl herbeigewunkenes ‚Geheimnis‘ endlich enthüllt wird. Sie muss aktiv werden und sich von der grauen Maus zur globetrotternden Rachegöttin mausern, damit sie im (bereits geschriebenen) Folgeband gemeinsam mit Pendergast den Mysterien dieser Welt nachforschen kann.
Ebenso flach geraten erwartungsgemäß alle in „Maniac“ auftretenden Figuren, an deren oft schlimmen Schicksal wir deshalb keinen Anteil nehmen. Ein Roman ist auch im 21. Jahrhundert etwas anderes als ein Drehbuch, ein Comic-Book oder ein Computerspiel. Dies wird das Autorenduo selbstverständlich für zukünftige Werke nicht berücksichtigen – wieso auch? Sie haben sich ihr Publikum entweder herangezogen oder sich ihm angepasst und liefern zuverlässig und regelmäßig, wonach es giert. Ist dagegen etwas einzuwenden, sind doch alle (oder die Mehrheit) damit glücklich? Natürlich nicht. Insofern ist eine Kritik wie diese, die andere – nennen wir sie ‚klassische‘ – Qualitätsmaßstäbe anlegt, vielleicht nur der sprichwörtliche und übertriebene Kanonenschuss auf ein Spatzenhirn …
Douglas Preston wurde 1956 in Cambridge, Massachusetts geboren. Er studierte ausgiebig, nämlich Mathematik, Physik, Anthropologie, Biologie, Chemie, Geologie, Astronomie und Englische Literatur. Erstaunlicherweise immer noch jung an Jahren, nahm er anschließend einen Job am American Museum of Natural History in New York an. Während der Recherchen zu einem Sachbuch über „Dinosaurier in der Dachkammer“ – gemeint sind die über das ganze Riesenhaus verteilten, oft ungehobenen Schätze dieses Museums – arbeitete Preston bei St. Martin’s Press mit einem jungen Lektor namens Lincoln Child zusammen. Thema und Ort inspirierten das Duo zur Niederschrift eines ersten Romans: „Relic“ (1994; dt. „Das Relikt – Museum der Angst“).
Wenn Preston das Hirn ist, muss man Lincoln Child, geboren 1957 in Westport, Connecticut, als Herz des Duos bezeichnen. Er begann schon früh zu schreiben, entdeckte sein Faible für das Phantastische und bald darauf die Tatsache, dass sich davon schlecht leben ließ. So ging Child – auch er studierte übrigens Englische Literatur – nach New York und wurde bei St. Martins Press angestellt. Er betreute Autoren des Hauses und gab selbst mehrere Anthologien mit Geistergeschichten heraus. 1987 wechselte Child in die Software-Entwicklung. Mehrere Jahre war er dort tätig, während er nach Feierabend mit Douglas Preston an „Relic“ schrieb. Erst seit dem Durchbruch mit diesem Werk ist Child hauptberuflicher Schriftsteller. (Douglas Preston ist übrigens nicht mit seinem ebenfalls schriftstellernden Bruder Richard zu verwechseln, aus dessen Feder Bestseller wie „The Cobra Event“ und „The Hot Zone“ stammen.)
Selbstverständlich haben die beiden Autoren eine eigene Website ins Netz gestellt. Unter http://www.prestonchild.com wird man großzügig mit Neuigkeiten versorgt (und mit verkaufsförderlichen Ankündigungen gelockt).
Die Pendergast-Serie …
… erscheint in Deutschland gebunden sowie als Taschenbuch im |Droemer Knaur|-Verlag:
(1994) „Relic“ (dt. Relic – Museum der Angst / Das Relikt – Museum der Angst)
(1997) „Reliquary“ (dt. Attic – Gefahr aus der Tiefe)
(2002) „The Cabinet of Curiosities“ (dt. [Formula – Tunnel des Grauens) 192
(2003) „Still Life with Crows“ (dt. [Ritual – Höhle des Schreckens) 656
(2004) „Brimstone“ (dt. [Burn Case – Geruch des Teufels) 1725
(2005) „Dance of Death“ (dt. [Dark Secret – Mörderische Jagd) 2809
(2006) „The Book of the Dead“ (dt. Maniac – Fluch der Vergangenheit)
(2007) „The Wheel of Darkness“ (noch kein dt. Titel)
http://www.droemer.de
Murray Engleheart/Arnaud Durieux – AC/DC: Maximum Rock’n‘ Roll
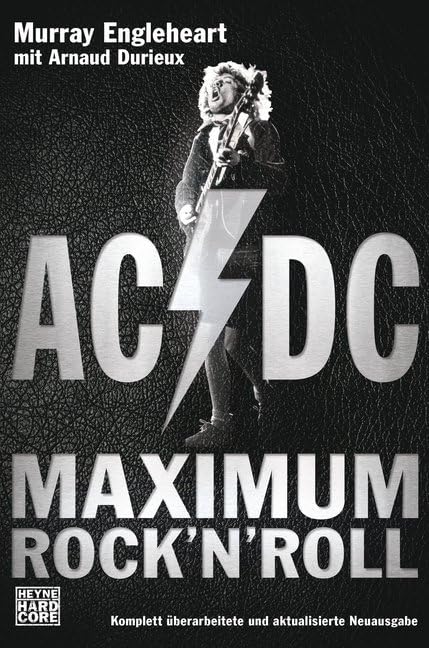
Murray Engleheart/Arnaud Durieux – AC/DC: Maximum Rock’n‘ Roll weiterlesen
Isaac Asimov – Die phantastische Reise

Isaac Asimov – Die phantastische Reise weiterlesen
Dolittle, Dolly (Hg.) – Noch mehr Gespenster
18 Kurzgeschichten zeugen von der Präsenz der Gespenstergeschichte in der ganzen Welt, wobei der außereuropäische Raum nur punktuell und exemplarisch Berücksichtigung findet; trotzdem bietet diese primär dem 19. Jahrhundert verhaftete Sammlung eine gute Übersicht, die dem am Genre interessierten Gruselfreund eine spannende Lesereise durch die Spuknächte diverser Kontinente und Länder beschert.
_Inhalt_
|Statt eines Vorworts:|
_Heinrich Heine (1797-1856): Doktor Ascher und die Vernunft_ (1826), S. 11-15 – Ein verstorbener Gelehrter erläutert um Mitternacht dem entsetzten Freund, wieso es keine Gespenster geben kann …
_Washington Irving (1783-1859): Der Student und die fremde Dame_ („The Adventure of the German Student“, 1824), S. 16-24 – Im Paris der Revolutionszeit verliert ein junger Mann sein Herz an eine schöne Frau, die freilich schon eines anderen Körperteils verlustig ging …
_Alexander Puschkin (1799-1837): Der Sargmacher_ („Grobovshchik“, 1830), S. 25-37 – Im Suff lädt der Sargmacher seine ‚Kunden‘ ein, die ihm gern um Mitternacht ihre Aufwartung machen …
_Heinrich von Kleist (1777-1811): Das Bettelweib von Locarno_ (1810), S. 38-42: Ein hartherziger Adelsmann wird vom Gespenst einer misshandelten Frau ins Verderben gestürzt …
_Ignaz Franz Castelli (1781-1862)*: Tobias Guarnerius_ (1839), S. 43-68 – Perfekt klingt eine Geige erst, wenn ihr eine menschliche Seele eingepflanzt wird, was den genialen Instrumentenbauer jedoch schon bald reut …
_Edgar Allan Poe (1809-1849): Die Tatsachen im Falle Waldemar_ („The Facts in the Case of M. Valdemar“, 1845), S. 69-82 – Spektakulär verläuft ein wissenschaftliches Experiment, in dessen Verlauf ein Sterbender in Trance versetzt wird …
_Nikolai Gogol (1809-1852): Der verhexte Platz_ („Zakoldovannoe mesto“, 1832), S. 83-96 – Ein russischer Bauer will dem Teufel einen Schatz abringen, was sich als höchst schwierige Herausforderung erweist …
_Pu Sung Ling (1640-1715): Das Wandbild_ (?, 17. Jh.), S. 97-100 – Ein verliebter Mann findet die Frau seines Lebens ausgerechnet als Motiv auf einem verzauberten Wandbild, was wie zu erwarten ernste Schwierigkeiten heraufbeschwört …
_Yakumo Koizumi (d. i. Lafcadio Hearn, 1850-1904): Die Päonienlaterne_ („The Peony Lantern“, 1899), S. 101-128 – Als sich der Geliebte dem Gespenst seiner verstorbenen Braut nicht freiwillig im Jenseits anschließen will, zieht diese andere, unangenehm klingende Saiten auf …
_Gottfried Keller (1819-1890): Die Geisterseher_ (1881), S. 129-163 – Eine ratlose Jungfrau zwischen zwei heftig werbenden Galanen überlässt einem Gespenst die Entscheidung, wen sie heiraten wird …
_Iwan Turgenjew (1818-1883): Gespenster_ (?, 1864), S. 164-202 – Eine kurze, aber heftige und sehr gesundheitsschädliche Liebe entbrennt zwischen einem reichen Gutsbesitzer und einer schönen Gespensterfrau …
_Ambrose Bierce (1842-1913/14): Eine Sommernacht_ („One Summer Night“, 1906), S. 203-205 – Was macht ein Grabräuber, der nachts auf dem Friedhof einen irrtümlich lebendig begrabenen Zeitgenossen entdeckt …?
_O. Henry (d. i. William Sydney Porter, 1862-1910): Das möblierte Zimmer_ („The Furnished Room“, 1906), S. 206-216 – Es übt aus überzeugenden Gründen einen selbstmörderischen Einfluss auf seinen Mieter aus, was ihm die geldgierige Hausherrin freilich verschwiegen hat …
_Guy de Maupassant (1850-1893): Der Horla_ („Le Horla“, 1887), S. 217-261 – Eine unsichtbare Kreatur nistet sich erst im Haus und dann im Geist eines Mannes ein, der den Kampf um seine Freiheit mit drastischen Mitteln aufnimmt …
_Amadou Hampate Ba (1900/01-1991): Der Peulh und der Bozo_ (?, 1949), S. 262-273 – Ein schlauer Dieb raubt in der Maske eines Gespenstes die tumben Bewohner eines Dorfes aus und narrt anschließend noch einen etwas klügeren Verfolger …
_Anton Tschechow (1860-1904): Der schwarze Mönch_ („Chernyi monakh“, 1894), S. 274-325 – Ein Philosoph schöpft intellektuell und persönlich Kraft aus der Begegnung mit einem Gespenst, das sich als Ausgeburt seiner Fantasie zu erkennen gibt …
_Tania Blixen [d. i. Karen Dinesen, 1885-1962): Die Geschichte eines Schiffsjungen_ („The Sailor Boy’s Tale“, 1942), S. 326-343 – Als er auf hoher See einen Falken rettet, ahnt der Schiffsjunge nicht, dass ihm dies einst das Leben retten wird …
_Walter de la Mare (1873-1956): Die Prinzessin_ („The Princess“, 1955), S. 344-362 – Ein Knabe verliebt sich in eine Frau, die er tot wähnt, bis er einer uralten Vettel begegnet, die ihm eine unvergessene Lektion über das Leben erteilt …
Nachweis – S. 363/64
* Diese Kurzgeschichte wird hier fälschlich Honoré de Balzac zugeschrieben.
_Einige Anmerkungen zu dieser Sammlung_
Nachdem Mary Hottinger in den ersten beiden Teilen der „Gespenster“-Trilogie die Geisterwelt der britischen Inseln Revue passieren ließ, wirft Dolly Dolittle, die ihr als Herausgeberin folgte (Hottinger starb 1978), diverse Schlaglichter auf das überirdische Treiben der übrigen Welt.
Selbstverständlich blieb die Freude an der guten, d. h. gruseligen Gespenstergeschichte nicht auf den angelsächsischen Sprachraum beschränkt. Wo Menschen leben, waren und sind Geister niemals fern. Hat man sich zunächst vor ihnen gefürchtet, lässt man sich später von ihnen unterhalten. „Noch mehr Gespenster“ verdeutlicht, dass es dabei je nach Ländern und Leuten Unterschiede gibt. Während die Motive, die den Menschen sich fürchten lassen, sich erwartungsgemäß ähneln, kann die Form (für deutsche Leser) oft erstaunlich fremd wirken. Das kann zum einen an der zeitlichen Differenz liegen. Pu Sung Ling schrieb „Das Wandbild“ im Japan des späten 17. oder 18. Jahrhunderts, d. h. in einer nicht nur kulturell überaus fremdartigen Welt. Schon die Art der Darstellung ist ganz anders als in der Gespenstergeschichte, die wir kennen und für die offensiv inszenierte Spannung ein integrales Element ist. (Yakumo Koizumis‘ „Päonienlaterne“ ist dagegen die zwar geschickt realisierte und gut übersetzte, aber eben doch pseudo-historische ‚Imitation‘ eines englischen Schriftstellers.)
Fremd wirkt auch Amadou Hampate Bas Geschichte vom Peulh und dem Bozo, obwohl sie zu den jüngeren Erzählungen dieser Sammlung zählt und im 20. Jahrhundert entstand. Aber es irritiert, wie vertraut Menschen und Geister hier miteinander umgehen. Auch im modernen Afrika ist die Zeit noch präsent, als Diesseits und Jenseits wie selbstverständlich nebeneinander existierten und ihre Bewohner Kontakt pflegten. (Leider spart Doolittle die südamerikanische Phantastik völlig aus, die in dieser Hinsicht interessante Variationen bzw. Ergänzungen liefern könnte.)
In Europa hat die eng mit dem Fortschritt der Naturwissenschaften verwobene geistig-kulturelle „Aufklärung“ dem deutlich früher ein Ende gesetzt. Heinrich von Kleist und Ignaz Franz Castelli bedienen ein Publikum, das nicht mehr an ‚echte‘ Gespenster glaubt. Jene, die in dieser Frage unentschlossen sind, verspottet Heinrich Heine herrlich boshaft und voller Witz in „Doktor Ascher und die Vernunft“. Ende des 19. Jahrhunderts ist die Gespenstergeschichte zum literarischen Genre und ‚reif‘ genug geworden, sich parodieren oder mit anderen Genres mischen zu lassen. Gottfried Keller schickt seine beiden „Geisterseher“ durch eine durchaus spannend und gruselig geschilderte Spuknacht, deren Ereignisse anschließend als sehr irdisch aufgeklärt werden. Tania Blixen greift auf den Sagenschatz ihrer skandinavischen Heimat zurück und erzählt eher lyrisch als erschreckend. Jenseits des Atlantiks findet Edgar Allan Poe eine Möglichkeit, die altehrwürdige Gespenstergeschichte mit der aufgeklärten Moderne zu kombinieren.
Nikolai Gogol bettet in „Der verhexte Platz“ eine turbulente und urkomische Geistergeschichte meisterlich in den reichen Kosmos russischer Volkssagen ein, in denen Religion und Aberglaube eine die Gespenstergeschichte inspirierende Verbindung eingehen. Alexander Puschkin legt mit „Der Sargmacher“ eine wunderschöne Gruselfarce vor, die das Genre niemals lächerlich macht.
Beeindruckend modern und in ihrer beängstigenden Wirkung trotz ihres Alters ungeschmälert sind Geschichten wie O. Henrys „Das möblierte Zimmer“ oder Iwan Turgenjews „Gespenster“. Das Grauen wird hier nicht mehr ‚erklärt‘, die Figuren, die hier von Phantomen heimgesucht werden, haben sich keines Vergehens oder Verbrechens schuldig gemacht, das eine solche Strafe verdiente. Das Übernatürliche besitzt ein Eigenleben – und es ist unberechenbar, was es noch exotischer und natürlich erschreckender wirken lässt.
[„Der Horla“ 584 von Guy de Maupassant belegt eine weitere Entwicklungsstufe der Gespenstergeschichte. Das Grauen kommt nicht mehr aus einem imaginären, jenseitigen Totenreich, sondern wurzelt in der Psyche des Menschen selbst. Der namenlose Protagonist erlebt eine der schlimmsten Erfahrungen überhaupt: Sein eigenes Hirn lässt ihn im Stich, liefert ihm Eindrücke, die mit der Realität nicht übereinstimmen. Der Horla mag ein Geist sein, doch ebenso schlüssig ist seine Deutung als Ausfluss einer Geisteskrankheit. Die nachhaltige Wirkung dieser Geschichte wird verstärkt durch das Wissen, dass de Maupassant sehr genau wusste, worüber er schrieb. Er erlebte und beschrieb, wie er buchstäblich den Verstand verlor. Sechs Jahre später starb er im Wahnsinn; sein persönlicher Horla hatte ihn erwischt!
Weniger grimmig schlägt Anton Tschechow in dieselbe Kerbe. Auch seine Figur ‚erschafft‘ ein Gespenst, das ihm jedoch nicht schadet, sondern ihn zu künstlerischer Kreativität ermuntert und ihm Zufriedenheit schenkt. Erst als der so ‚Besessene‘ den Beschwörungen seiner Mitmenschen folgt, seinen „Schwarzen Mönch“ verleugnet und ein in jeder Hinsicht ’normaler‘ aber langweiliger Zeitgenosse wird, beginnt sein Niedergang.
Ambrose Bierce geht wie üblich einen Schritt weiter. In seiner Story gibt es nie einen Zweifel an der Abwesenheit übernatürlicher Wesenheiten. Nur Menschen treten auf, und sie schaffen es ohne jede geistige Nabelschau, sondern allein durch ihr Handeln, die Leser frösteln zu lassen. Ähnlich ergeht es den beiden Figuren in Walter de la Mares Story. Das ‚Gespenst‘ ist lebendig und doch ein Phantom, das die verlorene Jugend verkörpert.
Abschließend ein offenes Wort an die Leser dieser Zeilen, das auch als Warnung verstanden werden darf: „Noch mehr Gespenster“ ist inhaltlich wie formal ‚anders‘ als „Gespenster“ und „Mehr Gespenster“. Der Horror kommt hier auf Katzenpfoten, und oft bleibt er sogar gänzlich aus. Rächende, hässliche, drastisch herumspukende Nachtmahre der vordergründigen Art trifft man höchstens in den Storys von Irving, Poe und vielleicht Henry. Ansonsten ist Spuk für die Verfasser etwas Allegorisches, das für sehr menschliche Wesenszüge und Konflikte steht. Das ist oft harte Kost, die den Freunden des Heul-und-Rumpel-Horrors à la Koontz oder Lumley zu beißen geben dürfte.
Freilich sind manche der vorgestellten Geschichten objektiv langatmig, weil nicht zeitlos, sondern einfach nur altmodisch, abschweifend oder aus heutiger Sicht schlecht getimt. Das Risiko muss man eingehen, verlässt man allzu ausgetretene Pfade, um – hier in der Phantastik – neue Wege zu beschreiten. Nicht jede dort gemachte Entdeckung ist sensationell, doch interessant und anregend ist so eine Tour allemal!
_Die „Gespenster“-Trilogie des |Diogenes|-Verlags:_
(1956) „Gespenster: Die besten Gespenstergeschichten aus England“ (hg. von Mary Hottinger)
(1978) [„Mehr Gespenster: Gespenstergeschichten aus England, Schottland und Irland“ 3833 (hg. von Mary Hottinger)
(1981) „Noch mehr Gespenster: Die besten Gespenstergeschichten aus aller Welt“ (hg. von Dolly Dolittle)
http://www.diogenes.de/
Bernie Chowdhury – Der letzte Tauchgang. Drama im Atlantik
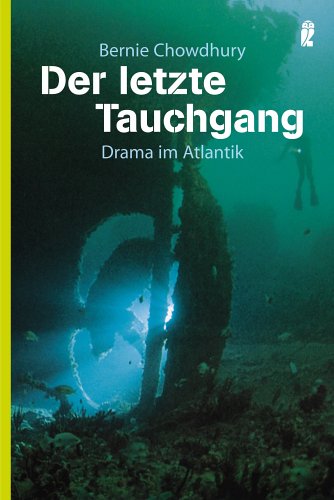
Simon Beckett – Kalte Asche
Dr. Simon Hunter, forensischer Anthropologe der Universität London, freut sich nach einer anstrengenden Dienstreise auf die Heimreise, als ihn ein Hilfegesuch der Polizei nach Runa, eine kleine Insel der Äußeren Hebriden vor der Nordwestküste Schottlands, führt. Dort wurde in einem verfallenen Cottage eine völlig verbrannte Leiche entdeckt, die Hunter nicht nur untersuchen, sondern auch feststellen soll, ob ein Mord oder nur ein Unfall vorliegt.
Runa ist eine kleine aber fest in sich ruhende Inselgemeinschaft, deren Mitglieder sich sämtlich zu kennen glauben. Konflikte werden intern gelöst, und „denen vom Festland“ steht man geschlossen misstrauisch und ablehnend gegenüber. Das erschwert die Ermittlungen, zumal Hunter mit Sergeant Fraser ein schroffer und dem Alkohol ergebener Polizeibeamter zur Seite gestellt wurde.
Die Leiche entpuppt sich als weiblich, und der Schädel weist deutliche Spuren eines heftigen Schlages auf. Der Tod war folglich gewaltsam. Der Täter oder die Täterin muss sich noch auf der Insel aufhalten, die in den Wochen seit dem Mord nachweislich niemand verlassen hat. Während Fraser dem Fall nicht gewachsen ist, kann sich Hunter auf die Unterstützung des ehemaligen Inspektors Andrew Brody verlassen, der seinen Altersruhesitz auf Runa genommen hat. Der alte Polizist hat seinen Job nicht verlernt. Gemeinsam mit Hunter nimmt er die Schar der Verdächtigen unter die Lupe. Die ist zwar klein, aber schwer zu durchschauen.
Dass Runa diverse Geheimnisse birgt, wird sogar dem Fremdling Hunter rasch klar. Dann bricht ein gewaltiger Sturm los, der Runa völlig isoliert und dem Mörder die willkommene Gelegenheit bietet, Spuren zu verwischen und mögliche Zeugen zu beseitigen, zu denen sich zu seinem Schrecken auch David Hunter zählen muss …
Ewig spannend: der ‚unmögliche‘ Mord
Hoch schlugen die Wellen, als Simon Beckett 2006 seinen ersten Krimi um den psychisch angeschlagenen Forensiker David Hunter veröffentlichte. Allzu drastisch beschreibe er, was der Tod mit dem menschlichen Körper anrichte, während der eigentliche Romanplot zu dürftig daherkomme, so der grundsätzliche Tenor der Kritik, von der sich die Leser indes nicht beeindrucken ließen. Ihnen gefiel „Die Chemie des Todes“ als Buch, das bei objektiver Betrachtung weder besser noch schlechter als die meisten zeitgenössischen Thriller war.
„Kalte Asche“ ist das zweite Kapitel in der David-Hunter-Vita, das Beckett wieder als Kriminalgeschichte erzählt. Gegenüber dem Debüt gibt es diverse Veränderungen bzw. Entwicklungen. Dieses Mal steht die Ermittlung im Vordergrund, während Hunters private Probleme (angenehm) ausgeklammert oder nur kurz angerissen werden. „Kalte Asche“ ist ein klassischer „Whodunit?“, der geschickt mit den literarischen Stilmitteln des 21. Jahrhunderts dargeboten wird.
Der Mord auf einer durch das Meer und das Wetter isolierten Insel ist wahrlich kein Einfall, der durch Originalität besticht. Wer Krimis liest, wird sogleich ältere Romane nennen können, die sich dieser Kulisse bedienen. (Der bekannteste ist vermutlich „Ten Little Niggers“/„And Then There Were None“, 1939; dt. „Zehn kleine Negerlein“/„Letztes Weekend“/„Und dann gab’s keines mehr“, von Agatha Christie.) Die Vorteile liegen auf der Hand: Der Schauplatz ist (scheinbar) überschaubar, die Zahl der Verdächtigen bleibt auf die (kleine) Gruppe der Insulaner beschränkt. Ein guter Autor wird sich hüten, unfair vorzugehen, was bedeutet, dass Leser, die miträtseln möchten, über dieselben Indizien und Hinweise verfügen wie die ermittelnden Beamten und Detektive.
Zu viel des unterhaltsam Schlechten
Was natürlich eine Illusion ist, was wir durchaus wissen. Letztlich erwarten wir, dass uns der Verfasser im großen Finale überrascht und die sorgfältig gelegten Spuren ad absurdum führt. Dieser Erwartung wird Beckett völlig gerecht, bevor er leider dem heutzutage üblichen Hang zum „Last-Minute-Twist“ folgt, d. h. auf den letzten Seiten den eigentlichen Übeltäter ans Licht zerrt, um der bisher erzählten und logisch aufgeklärten Story eine gänzliche neue Deutung aufzupfropfen.
Selbst das übersteht die Geschichte gut, aber Beckett will den Jeffrey-Deaver-Effekt und zieht auf der allerletzten Seite ein weiteres As aus dem Ärmel; er versucht es jedenfalls, denn was hier stattfindet, ist ebenso lächerlich wie billig und verdirbt viel von dem gutem Eindruck, den „Kalte Asche“ bisher hinterließ.
Denn Runa ist ein malerischer und überzeugender Ort für diesen ziemlich abenteuerlich geplotteten Thriller. Einsame Hügel, bestanden mit steinzeitlichen Hügelgräbern, dazwischen Moore, darüber Nebel, Wolken und Regen: Hier ist die Zivilisation sichtlich abwesend, verläuft das Leben nach alten, sogar archaischen Regeln. Die Inselgemeinde ist eine verschworene Gemeinschaft, in der Konflikte freilich gären wie in einem Dampfkochtopf. Nicht selten entweicht der Überdruck explosiv = gewalttätig und straft den Anschein eines gemütlich-trägen Inselalltags Lügen.
Verfluchte Heimat!
Einig ist man allerdings im Schulterschluss gegen alle ‚Fremden‘. Das schließt selbst den Wohltäter Michael Strachan ein, dem man es insgeheim verübelt, dass er über die finanziellen Mittel verfügt, seinem Gutmenschentum zu frönen. Gern würden die Insulaner ohne solche Hilfe auskommen, die sie eher gnädig als freudig oder gar dankbar annehmen.
Sergeant Fraser verkörpert perfekt das ungeliebte „Festland“, dessen Vertreter ohne Rücksicht auf die feinen Strukturen der Runa-Gesellschaft umherpoltern und gern Überlegenheit bzw. Überheblichkeit an den Tag legen. David Hunter versucht es mit ‚Verständnis‘, trägt aber dabei ebenfalls zu dick auf und stößt auf Ablehnung. Wie Fraser begreift Hunter nicht, dass Runa für seine Bewohner gleichermaßen Segen und Fluch ist: kein idyllischer Urlaubsort, sondern harte Realität und ebenso Heimat wie Verbannung.
David Hunter wird durch die Ereignisse auf Runa immerhin erfolgreich von seiner nach wie vor schwierigen privaten Situation abgelenkt. Nur halbwegs hat er den tragischen Verlust von Frau und Kind überwunden. Seine neue Gefährtin ist nach schrecklichen Erlebnissen (s. „Die Chemie des Todes“) selbst mental labil. Die Beziehung ist ohnehin schwierig, und die Spannungen verschärfen sich, weil Hunter von seiner – durchaus obsessiven – Beschäftigung mit meist grausam zu Tode gekommenen Menschen nicht lassen will. Er hat darin seinen Ausgleich gefunden, der ihm hilft, den Verlust der Familie zu kompensieren: Hunter will Antworten auf Fragen, die ohne seinen Einsatz womöglich unbeantwortet blieben.
Liebe zum garstigen Job
Im Vergleich zu „Die Chemie des Todes“ räumt Beckett dem inneren Ringen Hunters deutlich weniger Raum ein. Dem Roman kommt das sehr zu Gute, da der Verfasser die eigentliche Handlung vorantreibt, die sich u. a. um das Phänomen der klassischen Selbstentzündung dreht, für das Beckett eine logische Erklärung vorlegt.
Der Autor hält das Tempo durch, verzettelt sich nicht mehr in den endlosen Selbstzerfleischungen, die Hunters Denken und Handeln im Vorgängerband allzu stark bestimmen. In dieser Hinsicht wirkt Runa katalytisch: Die Insel ist auch für Hunter eine Stätte jenseits seines Alltagslebens, mit dem er sich während seines Aufenthaltes nur sporadisch beschäftigen muss.
Ob Hunter dank des angemerkten (aber hier natürlich verschwiegenen) finalen Knalleffekts noch einmal ermitteln wird, ist unklar – soll unklar wirken, aber in diesem Punkt lässt sich niemand vom Verfasser in die Irre führen. Stattdessen legt Beckett das Fundament für neue private Turbulenzen seines Helden, der mit ziemlicher Sicherheit recht bald seine nächste garstige Leiche unter die Lupe nehmen wird.
Autor
Simon Beckett (geb. 1968) versuchte sich nach Abschluss eines Englischstudiums als Immobilienhändler, lehrte Spanisch und war Schlagzeuger. 1992 wurde er freier Journalist und schrieb für bedeutende britische Zeitungen wie „Times“, „Daily Telegraph“ oder „Observer“. Im Laufe seiner journalistischen Arbeit spezialisierte Beckett sich auf kriminalistische Themen. Als Romanautor trat Beckett zuerst 1994 an die Öffentlichkeit, doch deren breite Aufmerksamkeit fand er erst mit den Romanen um den Forensiker David Hunter (ab 2006). Allerdings wurde Beckett bereits für „Animals“ (1995, dt. „Tiere“) mit einem „Raymond Chandler Society’s Marlowe Award“ für den besten internationalen Kriminalroman ausgezeichnet.
Mit seiner Familie lebt Simon Beckett in Sheffield. Über sein Werk informiert er auf dieser Website. Interessant ist, dass er seine vier zwischen 1994 und 1998 veröffentlichten (und inzwischen auch in Deutschland erschienenen) Romane unerwähnt lässt.
Taschenbuch: 432 Seiten
Originaltitel: Written in Bones (London : Bantam Press 2007)
Übersetzung: Andree Hesse
http://www.rowohlt.de
eBook: 532 KB
http://www.rowohlt.de
Der Autor vergibt: 



Stuart Kaminsky – CSI New York: Der Tote ohne Gesicht
Zwei Fälle fordern die Aufmerksamkeit des CSI-Teams New York um Mac Taylor in diesem besonders eisigen Februar. Im Aufzug eines vornehmen Appartementhauses liegt mit einer Kugel in der Brust die Leiche des Werbetexters Charles Lutnikov. Weder der Pförtner noch die Mitbewohner haben etwas gehört und gesehen. Blutspuren deuten darauf hin, dass der Verstorbene sich in der Wohnung der prominenten Krimi-Autorin Louisa Cormier schreibt aufgehalten hat. Sie weiß etwas, das Taylor und seine Kollegin Aiden Burn gern erfahren würden.
Fall Nr. 2 wirbelt mehr Staub auf. Alberta Spanio, einer wichtigen Kronzeugin, wurde in dem Hotelzimmer, das ihr bis zur Verhandlung als Versteck diente, ein Messer in den Hals gestoßen. Weil der Mann, der ihre Aussage fürchten musste, der gefürchtete Mafiaboss Anthony Marco ist, liegt der Verdacht nahe, dass dieser Spanios Tod angeordnet hat. Stuart Kaminsky – CSI New York: Der Tote ohne Gesicht weiterlesen
John Meaney – Tristopolis

C. V. Rock – Der 4. Grad

C. V. Rock – Der 4. Grad weiterlesen
Diane Carey – Neuer Ärger mit den Tribbles (Star Trek: DS9)
105 Jahre ist es her, dass der klingonische Spion Arne Darvin von Captain Kirk entlarvt wurde. Von seiner düpierten Regierung fallen gelassen, fristet der Ex-Agent sein Dasein als erfolgloser Kaufmann; Kirk hat er blutige Rache geschworen. Nun bietet sich ihm unverhofft eine Möglichkeit. Darvin erfährt, dass die „Doppelkugel der Zeit“, das Artefakt einer unbekannten Zivilisation, auf den Planeten Bajor gebracht werden soll. Der Auftrag, die Doppelkugel von Cardassia Prime abzuholen, geht an die „Defiant“ unter Captain Sisko von der Föderations-Raumstation „Deep Space Nine“.
Unbemerkt kann sich Darvin Zugang zur Doppelkugel verschaffen. Wie ihr Name bereits verrät, ermöglicht sie Zeitreisen. Darvin aktiviert sie und lässt sich ein Jahrhundert zurück in die Vergangenheit versetzen. Kurz bevor es auf der Raumstation „K-Sieben“ zu dem für sein jüngeres Ich verhängnisvollen Zusammentreffen mit Captain Kirk kommen wird, gedenkt er seinem Feind eine Falle zu stellen. Diane Carey – Neuer Ärger mit den Tribbles (Star Trek: DS9) weiterlesen
Stephen Hunter – Die Gejagten

Stephen Hunter – Die Gejagten weiterlesen











