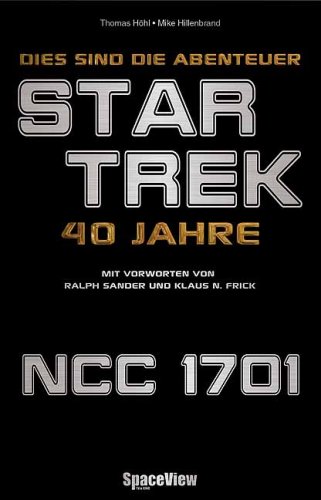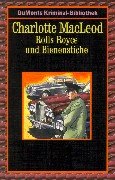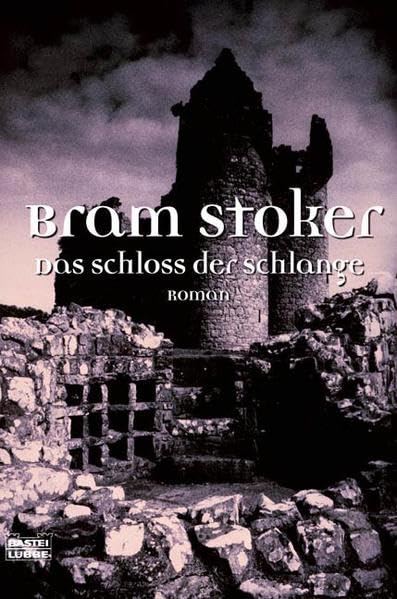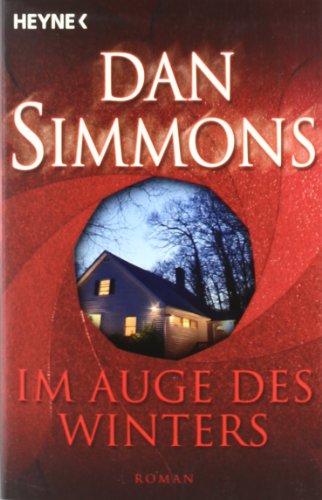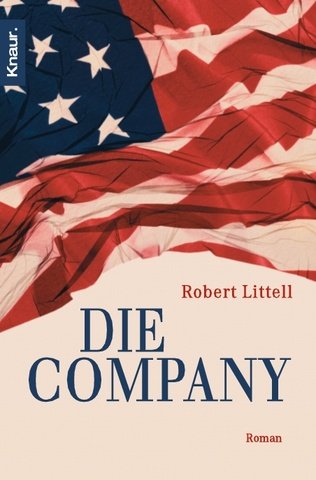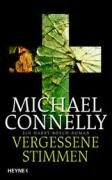Stephen King – Brennen muss Salem weiterlesen
Alle Beiträge von Michael Drewniok
Reginald Hill – Welch langen Weg die Toten gehen
Im leer stehenden „Moscow House“, dem alten Stammsitz der Macivers, schießt sich Palinurus, das Oberhaupt der Familie, mit einer Ladung Schrot den Schädel weg. Er will damit ein Signal setzen und seine verhasste Stiefmutter Kay Kafka in Verruf bringen, die er für den Tod seines Vaters und das Ende der einst selbstständigen Maschinenfabrik Maciver verantwortlich macht. Vor zehn Jahren hatte Palinurus senior seinem Leben auf dieselbe Weise ein Ende gesetzt wie jetzt der Sohn, nachdem ihn Kay als Ehefrau betrogen und ein US-Konzern mit ihrer Unterstützung seine Firma übernommen hatte.
Damals war Palinurus junior bei der Kriminalpolizei von Mid-Yorkshire vorstellig geworden. Der unorthodoxe Detective Superintendent Andrew Dalziel hatte seine Aussage damals aufgenommen, sie jedoch nicht für relevant gehalten, sodass zur Verbitterung des Juniors keine weiteren Schritte erfolgt waren. Auch dieses Mal will Dalziel die Sache offensichtlich unter den Teppich kehren. Detective Chief Inspector Peter Pascoe würde freilich gern weitere Ermittlungen anstellen. Die Macivers sind definitiv keine Musterfamilie. Ist womöglich etwas dran an Kay Kafkas üblem Ruf? Palinurus‘ Schwester Cressida und seine Witwe Sue-Lynn hassen die Stief- bzw. Schwiegermutter ebenso inbrünstig wie der Verstorbene. Helen, die deutlich jüngere Schwestern, liebt sie dagegen wie eine echte Mutter. Wie passt das zusammen? Reginald Hill – Welch langen Weg die Toten gehen weiterlesen
Höhl, Thomas / Hillenbrand, Maik – 40 Jahre STAR TREK – Dies sind die Abenteuer …
Der 8. September 1966 markierte den eher unauffälligen Start einer etwas obskuren TV-Serie, die sich dank ihres Schöpfers Gene Roddenberry, aufgrund ihres zeitlosen Konzepts und durch die intensive Liebe einer stetig wachsenden Fangemeinde sehr langsam aber sicher zu einem Medienkult, zu einem Kulturphänomen und zu einem wirtschaftlich eindrucksvollen Franchise entwickeln konnte. 40 Jahre später besteht das „Star Trek“-Universum aus sechs TV-Serien mit insgesamt 726 Episoden, aus zehn Kinofilmen, aus Romanen und Comics in dreistelliger Bandnummernzahl, aus zahlreichen Videospielen und unzähligen Merchandising-Artikeln. „Star Trek“ begeistert, bewegt und bindet Menschenmassen, hat sich längst verselbstständigt, vermag selbst das Kappen seiner TV-Wurzeln zu überstehen und wurde fest ins „Trekker“-Leben integriert.
In vierzig Kapiteln gehen die beiden Autoren dieses Jubiläumsbuches dem „Star Trek“-Mirakel auf den Grund. Die große Zahl macht es verständlicherweise unmöglich, auf jedes davon einzugehen. Insgesamt orientiert sich die Darstellung an der „Star Trek“-Chronologie der Jahre 1966 bis 2006. Folgerichtig steht zunächst die Vorgeschichte im Mittelpunkt, wobei sich diese auf die Figur des „Star Trek“-Schöpfers Gene Roddenberry konzentriert. Im Überblick gehen die Verfasser auf alle TV-Filme und die Kinofilme und die zeitgleich erfolgenden Veränderungen hinter den Kameras ein.
Zwischen diese Kapitelblöcke werden immer wieder Zusatzinfos gestellt. Die Einschübe tragen manchmal seltsame Titel wie „Ein Glatzkopf als Captain“, doch die meisten Texte liefern interessante „Star Trek“-Informationen (z. B. über die Schwierigkeiten, die Serie halbwegs originalgetreu einzudeutschen, das Regelwerk, dem ein „Star Trek“-Buchautor unterliegt oder die Umtriebe im „Trek“-Merchandising).
Berichtet wird ausführlich über das Fandom, dessen Mitglieder in Fernsehberichten publicitywirksam gern als verkleidungssüchtige Träumer & Trottel verunglimpft werden. Höhl & Hillenbrand berichten, was wirklich vorgeht hinter den Kulissen einer „Star Trek“-Convention.
Unterfüttert werden viele Informationen durch Interviews. Erstaunlich offen äußern sich „Star Trek“-Veteranen von vor und hinter der Kamera, aus dem Fandom oder den eher geschäftsorientierten Abteilungen des Franchises über ihre Arbeit, die keineswegs im Umfeld Roddenberryscher Einigkeit abläuft, sondern von heftigen Auseinandersetzungen um den schnöden Mammon und Machtkämpfe geprägt wird.
Die Abbildungen beschränken sich auf wenige Schwarzweißfotos sowie eine längere Farbfotostrecke, die vor allem Bilder der „Star Trek“-Darsteller zeigen, die sich auf Conventions ihren Fans stellen. Immer wieder in den Haupttext eingeschoben finden sich grau unterlegte Boxen, in denen primär deutsche Trekker ihren Gedanken zu 40 Jahren „Star Trek“ Ausdruck verleihen. Eingeleitet wird „Dies sind die Abenteuer …“ vom deutschen „Trek“-Spezialisten Ralph Sander und seinem „Kollegen“ Klaus N. Frick (der freilich vor allem die Werbetrommel für „seinen“ „Perry Rhodan“ rührt, den er als Chefredakteur betreut), am Ende steht ein Register, das die Suche nach Namen, Orten und Sachstichworten ermöglicht.
„Star Trek“ ist tot – es lebe „Star Trek“! Nach dem Doppeldesaster von 2005 – „Star Trek – Nemesis“ legte im Kino, „Star Trek – Enterprise“ im Fernsehen eine Bruchlandung hin – sah es so aus, als sei das Franchise am Ende. In Deutschland sind sogar die Romane zu den diversen Serien vom Markt verschwunden. Wenn es einen „Anlass“ gab, das Jahr 2006 in die „Star Trek“-Chronologie aufzunehmen, so zunächst nur deshalb, weil das „Trek“-Studio Paramount die Magazine leerte und im Rahmen einer Großauktion quasi alle Requisiten aus vier Jahrzehnten „Star Trek“ unter den Hammer wandern ließ.
Doch ein echter Kult kann zwar wanken, wird aber selten stürzen. Die Fans, an die im hier vorzustellenden Buch besonders gedacht wurde, scheren sich nicht um primär finanziell ausgerichtete Studiointeressen, sondern frönen – auch in Deutschland – ihrem Hobby „Star Trek“ auch in der Krise. Dennoch bleibt zu fragen, ob „Dies sind die Abenteuer …“ erschienen wäre, hätte das Franchise nicht unerwartete Schützenhilfe durch den Drehbuchautor („Lost“) und Regisseur („Mission Impossible III“) J. J. Abrams bekommen, der zur Zeit in Hollywood ganz oben steht und den die Studiobosse deshalb ordentlich bauchpinseln. Dieser Abrams ließ also durchblicken, einen „Star Trek“-Kinofilm drehen zu wollen – und es ward ihm genehmigt!
Der Zug zu den Sternen wird also fortgesetzt, und in der ruhigen Gewissheit dieser erfreulichen Tatsache lässt sich umso besser Rückschau halten. Keine einfache Aufgabe ist es, welche die beiden Autoren sich gestellt haben. Zum einen lassen sich vierzig ereignisreiche Jahre schwer auf knapp 450 Seiten zusammenfassen. Andererseits ist Deutschland auch in Sachen Hintergrundinfos keine „Star Trek“-Diaspora! Allein Ralph Sander hat in den 1990er Jahren im |Heyne|-Verlag vier voluminöse Bücher zum Thema verfasst. Sehr richtig beschlossen Höhl & Hillenbrand deshalb, sich für die Jahre vor 1998 – hier erschien Sanders „Star Trek-Universum“-Band 4 – auf die grundsätzlichen Informationen zu beschränken, sich stattdessen auf das in zehn Jahren neu aufgelaufene Wissen zu stützen und dem Sander-Quartett quasi einen fünften Band folgen zu lassen; es ist genug geschehen, das eine solche Fortsetzung rechtfertigt.
Lobenswert ist weiterhin der Verzicht auf ausufernde Inhaltsangaben. Vor allem recherchefaule Autoren füllen ihre Bücher mit solchen Nacherzählungen und vielen Fotoseiten. Höhl & Hillenbrand wählen den schwierigen Weg: Sie liefern echte Informationen, und sie sparen nicht damit, reihen nicht Anekdote an Anekdote, verzichten auf Hörensagen, stellen die „Apokryphen“ der „Star Trek“-Story als solche vor, stellen Gerüchte richtig, weisen auf unterschiedliche Überlieferungen hin, ohne stets die Fakten rekonstruieren zu können.
Vor allem schauen sie hinter die Kulissen und hinter die Fassade der Friede-Freude-Eierkuchen-Welt, als die sich das offizielle „Star Trek“ gern präsentiert. Zwar sickerte in den vergangenen Jahren im Zeitalter des Internets viel Internes durch, das wenig gemein hatte mit der glanzvollen Zukunft Gene Roddenberrys, in der angeblich nicht mehr der Drang nach Geld und Macht, sondern der Wissensdurst und die Arbeit an einem „besseren“ Menschen den Zeitgenossen prägen wird.
Doch auch hier gibt es Missverständnisse, Falschmeldungen, Fehlinterpretationen, die Höhl & Hillenbrand aufzuklären versuchen. Sie profitieren dabei vom Kontakt zu „Eingeweihten“, die sich manchmal erstaunlich offen äußern, wenn sie sich im fernen Europa dem Maulkorb des Studios entronnen wähnen. Dabei wühlt das Autorenduo nicht in schmutziger Wäsche, sondern liefert ein vollständiges Bild des „Star Trek“-Phänomens, das seine lichten wie dunklen Seiten aufweist.
Dass sich „Dies sind die Abenteuer …“ durchweg spannend und flüssig liest, liegt an der Fähigkeit der Autoren, den umfangreichen Stoff nicht nur überzeugend zu gliedern, sondern ihn auch in ansprechender Sprache zu vermitteln. Gerade im fannischen Bereich scheint die Artikulation in grammatisch korrekten Sätzen eine aussterbende Kunst zu sein. Höhl & Hillenbrand zeigen, dass man sich niveauvoll auch in einfachen Worten verständlich machen kann, ohne in die Niederungen des aktuellen SMS-Pidgins zu geraten.
Zwar zuletzt aber dafür mit Nachdruck sei darauf hingewiesen, dass der |Heel|-Verlag dieses lesenswerte Buch für 12,95 Euro feilbietet. Das ist definitiv ein Schnäppchen. Nicht nur eingefleischte „Star Trek“-Fans sollten hier schwach werden, sondern auch jene, die bisher wenig am Hut haben mit dem „Star Trek“-Universum.
Thomas Höhl (geb. 1967) ist hauptberuflich als Jurist in einem Fachverlag tätig. Darüber hinaus schreibt er (hauptsächlich für das SF/Fantasy-Magazin „Space View“) über „Star Trek“ und andere Genre-Serien; er hat zu diesem Thema auch mehrere Bücher verfasst.
Mike Hillenbrand (geb. 1972) drehte mehrere Jahre die Dokumentationsvideos zur „FedCon“, der größen „Star Trek“-Convention Europas, und kam dabei mit vielen bekannten oder wichtigen Personen aus dem „Trek“-Franchise in Kontakt. Er arbeitet als Moderator für Radio und Fernsehen und ist als Genre-Rezensent und –Berichterstatter in den Printmedien und im Internet vertreten.
http://www.heel-verlag.de/
David, Saul – größten Fehlschläge der Militärgeschichte, Die. Von der Schlacht im Teutoburger Wald bis zur Operati
Suchen Sie schon lange nach einem Buch, bei dessen Lektüre Sie sich mal wieder so richtig aufregen können? Oder schätzen Sie Werke, die das literarische Äquivalent zu jenen Sendungen darstellen, mit denen das private Fernsehen genüsslich die Dämlichkeiten synaptisch fehlgeschalteter Zeitgenossen zelebriert („Die ulkigsten Genickbrüche der Welt“)?
Dann greifen Sie zu, denn eine größere Ansammlung von Nieten und Versagern werden Sie in der nächsten Zeit nur noch in der täglichen Schenkelklopf-Show eines gewissen grinsenden TV-Metzgers finden. Einen gewichtigen Unterschied gibt es allerdings: Die Stümper („blunder“ = engl. Schnitzer, Pfusch oder eben Stümperei), die der Militärhistoriker Saul David uns hier vorstellt, haben Menschenleben auf dem Gewissen – und das nicht zu knapp!
Der Krieg ist der Vater aller Dinge, hat der griechische Philosoph Heraklit um 500 vor Christus angeblich geschrieben. (Keine Sorge: Das soll´s auch schon gewesen sein an humanistischem Bildungsgut der Vergangenheit.) Wenn er darin die Dummheit mit einschließt, hat er wohl Recht. Der Kampf, die Schlacht, der Krieg – das sind nicht nur Namen für den gewaltsamen Konflikt mindestens zweier verfeindeter Menschengruppen. Die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln (nun gut – einer sei mir noch gestattet: Carl von Clausewitz, 1780-1831) war und ist immer auch die Geschichte von Menschen unter Druck – und das ist bekanntlich keine gute Ausgangsposition für ein heikles Unternehmen wie den Versuch, einen (ähnlich gestressten und bis an die Zähne bewaffneten) Gegner in die Flucht zu schlagen.
Unter diesen Voraussetzungen ist es verständlich, dass Saul David es leicht hatte, Beispiele für strategische, politische oder einfach „nur“ menschliche Fehleinschätzungen aus der Militärgeschichte zusammenzutragen. 30 bekannte und weniger bekannte Konflikte aus 2000 Jahren – von der Schlacht im Teutoburger Wald (Römer gegen Germanen, 9 n. Chr.) bis zur „Operation Desert Storm“ (USA gegen Irak; wird bis heute gelegentlich in kleinerem Rahmen wiederholt) – analysiert der Autor, schildert kurz den Kampfablauf und entwickelt daraus das Wie und Warum der entscheidenden Fehler. Es ist bedrückend zu lesen, wie unfähige oder übertrieben ehrgeizige Kommandanten, simple Kommunikationsprobleme, bewusste „Bauernopfer“, die Einmischung unkundiger Politiker oder das Unterschätzen des Gegners wieder und immer wieder in dieselbe Katastrophe mündeten: den unnötigen Tod zahlloser Menschen, deren Pech es primär war, als Soldaten den Befehlen von Stümpern ausgeliefert zu sein.
Bücher (und Filme) über militärische Holzköpfe haben Konjunktur; kein Wunder, wenn wir die tragischen Geschichten hinter dem ungläubigen Kopfschütteln bedenken. Besonders unsere britischen Nachbarn beschäftigen sich intensiv mit den zahlreichen Schlachten ihrer langen Geschichte; da sie zumindest in den letzten Jahrzehnten jeweils auf der „richtigen“ Seite gekämpft haben (bis auf diese peinliche, aber halb vergessene Sache auf den Falklandinseln), können sie das relativ entspannt und ohne schlechtes Gewissen tun. Nun gut, ob sie es tun können, sei dahin gestellt; sie tun´s halt einfach – und zwar mit Begeisterung: Lässt man im Internet eine Suchmaschine – Ihr Rezensent bevorzugt Google – nach dem Begriffspaar „Military“ und „Blunders“ (nach dem Originaltitel des vorliegenden Buches) suchen, werden stolze 15.000 Websites angeboten!
Allerdings sollte Begeisterung keinesfalls Sachkenntnis ersetzen. Ohne in Details zu gehen, möchte Ihr Rezensent an dieser Stelle anmerken, dass ihm, der sich in der frühen und mittelalterlichen Geschichte berufsbedingt ziemlich gut auskennt, einige Punkte in Sauls Darstellung der besagten Schlacht im Teutoburger Wald, besonders aber des zweiten Kreuzzugs arg missfallen haben. Hier stützt sich der Autor zum Teil auf veraltete oder sogar definitiv falsche Quellen. Das lässt natürlich Misstrauen aufsteigen, inwieweit wir ihm sonst vertrauen können.
Ein weiteres Manko: Man mag es kaum ansprechen, aber wenn man nicht gerade zu denjenigen Zeitgenossen gehört, deren höchste Wonne es ist, die Schlachten der Weltgeschichte mit Tausenden von Zinnsoldaten nachzuspielen, ermüdet es unabhängig von der Zahl der Opfer rasch nachzulesen, wieso welcher Truppenteil wann welchen Berg stürmte (oder nicht). David selbst beschreibt die Schwierigkeit, um der Lesbarkeit willen die Balance zu finden zwischen der streng wissenschaftlichen und der eher populärwissenschaftlichen Darstellung; so recht ist ihm das jedenfalls nicht gelungen.
Angesichts der höchst komplizierten Dynamik, die dem Prozess des Kriegführens offensichtlich innewohnt, fragt man sich allerdings, ob noch so sorgfältige Pläne den Ausgang eines Gefechts wirklich beeinflussen können. Irgendwann scheint sich stets der Zufall durchzusetzen, es sei denn, der Kommandant ist definitiv verrückt, was übrigens häufiger vorgekommen ist, als man sich das vorstellen mag.
So wird die Lektüre mit fortschreitender Seitenzahl langsam etwas zäh. Man wird ungeduldig, runzelt über das inhaltliche Durcheinander bzw. die eigentümliche thematische Gliederung („Unfähige Kommandanten“, „Katastrophale Pläne“, „Einmischung von Politikern“, „Übertriebenes Selbstvertrauen“, „Truppenversagen“ – eine klare Trennungslinie kann da überhaupt nicht gezogen werden) die Stirn, mag Stalingrad nicht unbedingt an der Seite von Little Big Horn sehen. Vielleicht wäre es ratsam, „Die größten Fehlschläge …“ nicht am Stück, sondern in Etappen (um in den Jargon des Themas zu verfallen) zu lesen. Zu viel Dummheit am Stück kann ermüdend wirken oder zu wütender Resignation führen.
Übrigens präsentiert uns Saul David keineswegs „die größten Fehlschläge der Militärgeschichte“, wie uns der deutsche Titel weismachen möchte. Der Autor kann bereits im Vorwort glaubhaft machen, dass es ihm leicht gefallen wäre, ein Vielfaches an militärisch-menschlichen Katastrophen aus der Geschichte zu wählen. Aber sein Potpourri menschlichen Versagens reicht auch so vollauf!
James Hadley Chase – Der Schlächter von Dead End

James Hadley Chase – Der Schlächter von Dead End weiterlesen
Barrett, Andrea – Jenseits des Nordmeers
An einem Maitag des Jahres 1855 verlässt der ehemalige Walfänger „Narwhal“ den Hafen der Südstaaten-Metropole Virginia. Mit hehren Zielen ist man gen Arktis in See gestochen, will der seit acht Jahren verschollenen Expedition des Entdecker-Helden Sir John Franklin auf die Spur kommen, die polarnahe Natur erforschen und womöglich die lange gesuchte Nordwestpassage finden, die es angeblich ermöglicht, den nordamerikanischen Kontinent per Schiff im Norden zu umrunden. Ja, Zecheriah Vorhees, der charismatische, erst 26-jährige Kommandant der „Narwhal“, versteht es außerordentlich, für sich und seine Sache die Werbetrommel zu rühren!
Aus ganz anderem Holz geschnitzt ist sein väterlicher Freund und zukünftiger Schwager Erasmus Darwin Wells. Mit seinen 40 Jahren sieht er sich selbst als im Leben Gescheiterter. Einst schien die Welt dem begabten und belesenen Naturforscher offen zu stehen. Doch er wurde um die Forschungsergebnisse jener Weltreise geprellt, die ihm den Weg in eine wissenschaftliche Karriere ebnen sollte. Von diesem Schlag hat sich Wells nie erholt. Als kurze Zeit darauf auch noch seine Braut starb, versank Erasmus in Lethargie, ließ sich treiben und hat sich in einen verbitterten Eigenbrötler voller Ängste und Frustrationen verwandelt. Vorhees’ Einladung, an Bord der „Narwhal“ auf eine neue Reise zu gehen, sieht er als letzte Gelegenheit, seinem Leben wieder einen Sinn zu geben.
Doch die Expedition steht unter keinem guten Stern. Vorhees zeigt sich seinem Amt nur bedingt gewachsen. Die für die Wissenschaft so wichtige Dokumentation langweilt ihn. Er will Entdeckungen machen, um berühmt zu werden! Seinen Visionen haben sich Besatzung und Passagiere gefälligst unterzuordnen. Während Letztere ihrem Kommandanten lange hilflos gegenüberstehen, wächst unter Ersterer der Widerstand, so dass die „Narwhal“ schließlich nicht nur hart am Rande des bedrohlichen Packeises, sondern auch einer Meuterei steht, während sie vom zusehends größenwahnsinnigen Vorhees immer weiter in den Norden getrieben wird, bereit, den Weg seines Vorbildes Franklin bis zum bitteren Ende zu gehen.
Die Fahrt der „Narwhal“ endet in einer Katastrophe. Das Schiff, von Vorhees wider alle Vernunft zu lange an der Rückfahrt gehindert, wird vom Eis eingeschlossen. Mannschaft und Passagiere erleben einen fürchterlichen Kälte- und Hungerwinter, den nicht alle überleben. Dessen ungeachtet drängt Vorhees auf weitere Erkundungen. Als sich seine Begleiter weigern, zieht er allein in die Polarwüste und verschwindet spurlos. Erasmus soll die wenigen Überlebenden dorthin führen, wo Rettung zu erwarten ist. Diese Flucht über das Eis entwickelt sich zum tödlichen Albtraum, der Erasmus und die wenigen Überlebenden schrecklich zeichnet. Zudem waren alle Qualen umsonst: Nach der Rückkehr stellt sich heraus, dass Vorhees die „Narwhal“ in ein Gebiet lenken ließ, das längst erforscht wurde … Statt gefeiert zu werden, muss sich Erasmus als Versager und Feigling beschimpfen lassen. Doch sein Leidensweg hat nicht einmal begonnen, denn eines Tages kehrt Zeke Vorhees aus dem Eis zurück – ein ruhmreicher Held, beladen mit den Ergebnissen eigener Forschungen, von denen Erasmus genau weiß, dass sie zu schön sind, um wahr zu sein. Doch ihm fehlen die Beweise, und so muss er ohnmächtig mit ansehen, wie der betrügerische Vorhees sich skrupellos seinen Platz in der Geschichte verschafft …
„Jenseits des Nordmeers“ gehört wohl eindeutig zu den wenigen historischen Abenteuerromanen, die in den letzten zehn Jahren das meiste Kritikerlob und (was gleichzeitig normalerweise unmöglich ist) die ungeteilte Aufmerksamkeit des lesenden (und denkenden) Publikums auf sich lenken konnten. Nur wenige Seiten Lektüre geben deutlich Aufschluss über den Grund: „Jenseits des Nordmeers“ ist schlicht und ergreifend ein in Inhalt und Form verdammt gutes Buch!
Der Kraftausdruck sei im Positiven Ihrem Rezensenten gestattet, der sonst an dieser Stelle mit Zorn, Frustration und Resignation die meisten der so genannten „historischen“ Romane geißelt, für die guter Wald abgeholzt wird, statt der Sauerstofferzeugung vorbehalten zu bleiben. Geschichte auf TV-Seifenopern-Niveau ist es, die meist im (fadenscheinigen) Gewand des Krimis auf die Leser losgelassen wird. Das Gespür für vergangene Zeiten erschöpft sich gar zu oft darin, die Figuren in ulkige Gewänder zu stecken oder eine feurige Prä-Feministin gegen klotzköpfige Kirchenfürsten antreten zu lassen.
Ganz anders dagegen Andrea Barrett. Ihr ist nicht nur eine spannende Geschichte eingefallen, was an sich bereits eine anerkennenswerte Leistung und die halbe Autorenmiete ist: Sie wird auch noch so mitreißend erzählt, dass selbst einem alten Lesekämpen wie Ihrem Rezensenten mehr als 400 Seiten wie im Fluge vergehen; eine leider Gottes seltene Erfahrung, wenn der Buchberg eines Leserlebens Himalaja-Höhen erreicht hat.
Die Grundkonstellation ist denkbar einfach, aber viel erprobt und immer noch funktionstüchtig, wenn man die Gebrauchsanweisung kennt: Versammle einige Personen möglichst unterschiedlichen Charakters an einem Ort, von dem sie nicht fliehen können (hier das gute Schiff „Narwhal“), schicke sie dann auf eine gefährliche Reise und warte ab, was geschieht! Geht es jetzt mit einem recht primitiven Gefährt hinauf in das eisige Oberstübchen unseres Globus‘, ist das abenteuerliche Element schon einmal sichergestellt!
Jetzt zu den Hauptpersonen unseres Dramas. Treffen wir an Bord der „Narwhal“ die sprichwörtlichen dreizehn Mann auf des toten Mannes Kiste (mit ’ner Buddel voll Rum), d. h. gesichtslose und austauschbare Gestalten, die dem einzigen Zwecke dienen, neben dem eigentlichen Helden vom Mast zu stürzen, sich die Pest einzufangen oder in einen Haifisch-Rachen zu stürzen? Oh nein, echte Individuen hat Barrett mit Sachkenntnis und Liebe zum Detail in ihre Romanwelt gestellt. Helden gibt es übrigens auch nicht, sondern nur Menschen. An ihrer Spitze steht Erasmus Darwin Wells, eine traurige Gestalt, die aus einer gescheiterten Existenz hinaus auf die See flüchtet, um dort die Erfahrung zu machen, dass ungelöste Probleme mit ihren unglücklichen Besitzern zu reisen pflegen. Mit dieser Erkenntnis und den Folgen bleibt Erasmus nicht allein; mit seltenem Geschick und düsterer Konsequenz schildert Barrett eine hehre Mission, die weniger an den Unbilden der Natur als an menschlichem Versagen erst krankt und dann scheitert.
Ähnlich dürfte es der Expedition Sir John Franklins ergangen sein, auf dessen Spur sich die Crew der „Narwhal“ gesetzt hat. Dieses reale Rätsel der Entdeckungsgeschichte bildet den idealen Rahmen für Barretts Drama. Mit viel Vorschusslorbeeren und in einem sehr modern anmutenden Medien-Gewitter war der von seinen britischen Landsleuten verehrte und weltweit anerkannte Polar-Pionier im Mai 1845 mit zwei Schiffen gen Nordpolarmeer aufgebrochen, um endlich die sagenhafte Nordwestpassage zu finden. Eigentlich war Franklin schon viel zu alt und auch nicht gesund genug für eine solche Expedition, doch wie Zecheriah Vorhees versessen darauf, den eigenen Ruhm weiter zu mehren. So ersetzte ein regelrechter Ausrüstungs-Overkill eine realistische Planung des Unternehmens, das in einem schrecklichen Fiasko endete: Die Schiffe gingen verloren, und alle 135 Männer kamen grausam zu Tode; verirrt, erfroren, verhungert oder gar vergiftet durch die eigenen, mit Blei (!) schlampig verschweißten Konserven.
Es dauerte 140 Jahre, bis der Großteil dieser traurigen Wahrheit ans Licht kam. Als Erasmus Wells in See stach, herrschte dagegen noch Hoffnung. Lady Jane, John Franklins Gattin, drängte unermüdlich jeden Seemann und Entdecker, in den Norden zu dampfen oder zu segeln, um dort auf die Suche zu gehen. Sie war viele Jahre sehr überzeugend, zumal immer wieder Relikte der verschollenen Expedition entdeckt wurden. Die „Narwhal“ reiht sich deshalb unauffällig in die Flotte echter Schiffe ein, die zwar nie John Franklin fanden, aber immerhin das Wissen um den hohen Norden entscheidend zu mehren wussten.
Wenn sie denn ihre Abenteuer überlebten. „Jenseits des Nordmeeres“ verzeiht die Natur keine Schwächen, das macht uns der gleichnamige Roman eindrucksvoll klar. Dabei ist die Arktis keine tödliche Eishölle, sondern ein Ort, an dem es sich durchaus leben lässt, solange man bereit ist, sich den Verhältnissen anzupassen. Barrett schildert präzise den Zwiespalt, der die Entdecker des 19. Jahrhunderts immer wieder in selbst verschuldeten Krisen untergehen ließ: Sie kamen nur scheinbar in fremde Landstriche, um zu lernen, während sie unterbewusst davon überzeugt waren, schon alles Wissenswerte zu kennen. Barrett beschreibt, was Erasmus Wells in den Laderäumen der „Narwhal“ verstaut; mindestens die Hälfte ist in der Arktis völlig nutzlos und fehl am Platze, während wirklich Wichtiges oft fehlt. Aber: Ein Gentleman reist halt so, und außerdem muss er vor den „Wilden“ die Überlegenheit der weißen Rasse demonstrieren!
Nur Erasmus und sein neuer Freund, der Schiffsarzt, entwickeln einen echten Sinn für die Schönheit der Welt, die sie bereisen. Durch ihre Augen sieht der Leser dank Barretts Talent den hohen Norden in seiner ganzen Pracht. Während sich minder begabte Autoren gern vor Landschaftsbeschreibungen drücken oder in bleierne Langeweile abrutschen, entwickelt Barrett eine Wortgewalt, die einfach mitreißend ist. Hierin gleicht sie tatsächlich dem im Klappentext als Wink mit dem Zaunpfahl genannten Herman Melville [(„Moby Dick“), 1144 ohne ihn jedoch jemals zu imitieren. „Jenseits des Nordmeers“ ist ein absolut eigenständiges Werk, ein moderner Klassiker des Genres Reiseabenteuer, ein Literaturkapitel, das man oft schon für abgeschlossen hält, da doch die Welt inzwischen bis in die letzten Winkel erforscht ist. Aber so ist es nicht, und selten macht es so viel Spaß, vom Gegenteil überzeugt zu werden!
Und als Erasmus Wells in die Zivilisation zurückkehrt, ist gerade die Hälfte des Romans gelesen! Jetzt geht es erst richtig los: Als ob sie die Eiswüste nie verlassen hätten, setzen Wells und Vorhees ihr auf der „Narwhal“ begonnenes Duell mit unverminderter Härte fort. Vorhees verkörpert dabei die dunkle Seite der noch heute meist ohne Einschränkung verehrten Heldengestalten der Entdeckungsgeschichte. Doch die Männer, die das Neue suchten, benahmen sich in der Fremde nicht selten wie die sprichwörtliche Axt im Walde. Besonders im Umgang mit den Ureinwohnern der besuchten (oder besser eroberten) Gebiete geschah vieles, das in den offiziellen Forschungsberichten lieber verschwiegen wurde. Barrett nennt diese Dinge beim Namen, und siehe da: Diese zweite Hälfte, die in der Tat „Jenseits des Nordmeers“ spielt, gibt der ersten in Sachen Dramatik und Spannung nicht das Geringste nach!
PS: Famos übersetzt wurde das Werk auch noch!
Lee Child – Sein wahres Gesicht
Jack Reacher, ehemaliger Elite-Soldat und Militär-Polizist, ist auf seiner ziellosen Reise durch die USA in Key West, Florida, gelandet. Dort verdingt sich nach Feierabend als Leibwächter in einer Oben-ohne-Bar, wo ihn Privatdetektiv Costello anspricht, der ihn im Auftrag einer „Mrs. Jacob“ aus New York finden soll. Reacher hat keine Ahnung, wer dies ist, und hält sich daher im Hintergrund, was klug ist, denn Costello hart auf den Fersen sind zwei Schläger, die dem Detektiv auflauern, ihn nach Reacher ‚befragen‘ und, als er nichts preisgeben kann, brutal umbringen.
Reachers Ermittler-Instinkte brechen wieder durch. Er reist nach New York, wo er feststellt, dass „Mrs. Jacob“ Jodie Garber ist, die Tochter seines verehrten militärischen Lehrmeisters und väterlichen Freundes General Leon Garber, der gerade einem Herzleiden erlegen ist. In den letzten Lebenswochen beschäftigte ihn der Victor Hobie, der vor fast dreißig Jahren als hoch dekorierter Helikopter-Pilot im Vietnamkrieg verschollen ist. Das Militär mauerte, und Garber wollte den Grund herausfinden. Er konnte noch in Erfahrung bringen, dass Hobie bei einem Absturz schwer verletzt und verstümmelt wurde. Er desertierte aus dem Lazarett, tötete dabei einen Kameraden und verschwand mit viel Geld, das er durch allerlei krumme Geschäfte ergaunert hatte. Ein Mustersoldat als übler Gauner: Dies war dem Militär so peinlich, dass es Hobies Akte einfach schloss. Lee Child – Sein wahres Gesicht weiterlesen
MacLeod, Charlotte – Rolls Royce und Bienenstiche
Wie in jedem Jahr richtet das Millionärs-Ehepaar Nehemiah und Abigail Billingsgate für seine Familienmitglieder, Verwandten und Freunde auf dem Gelände seines Anwesens vor den Toren der US-Metropole Boston (Massachusetts) ein prunkvolles Renaissance-Fest aus. Unter den zahlreichen Gästen tummeln sich auch Max und Sarah Bittersohn, die heuer nicht nur zur Feier eingeladen wurden, sondern außerdem einen peinlichen Diebstahl aufklären sollen. Die Bittersohns arbeiten als Privatdetektive, und der Hausherr setzt größeres Vertrauen in sie als in Chief Grimpen, den ebenso aufgeblasenen wie unfähigen Polizeichef, dem dennoch noch reichlich Gelegenheit geboten wird, sich tüchtig zu blamieren.
Seit Jahrzehnten sammelt die Familie Billingsgate Luxus-Automobile der Marke Rolls Royce. Der Wert dieser Oldtimer ist enorm, so dass große Aufregung entsteht, als ein Modell „New Phantom“, Baujahr 1927, aus der als Museum eingerichteten und gut gesicherten Großgarage verschwindet. Für das Fest wurden deshalb besondere Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Der alte Hausdiener Rufus bewacht die fest verschlossene Wagenhalle, und regelmäßig schaut Max Bittersohn nach dem Rechten.
Dennoch geschieht das Unfassbare: Auf einem seiner Kontrollgänge findet Max den Wachposten verlassen vor. Nach kurzer Suche entdeckt er den scheinbar saumseligen Rufus: Er hängt mit einem Seil um den Hals hoch im Wipfel eines Baumes! Man hat ihn erst ermordet und dann mit einem Flaschenzug dort hinaufgezogen. Gleichzeitig ist wieder einer der wertvollen Rolls Royces verschwunden – und Boadicea Kelling, eine der zahllosen Tanten Sarahs, die anscheinend den Dieben und Mördern zufällig über den Weg lief und von diesen verschleppt wurde.
Die Ermittlungen gestalten sich schwierig. Da ist zum einen der unausstehliche Grimpen, der nichts lieber täte, als den Fall unter fadenscheinigen Gründen zu den Akten zu legen. Auf der anderen Seite müssen die Billingsgates und die Bitterbaums sich eingestehen, dass der oder die Täter wohl im Kreise der Gäste gesucht werden müssen; eine peinliche Situation, da die Anwesenden nicht nur mit den Gastgebern und untereinander verwandt sind, sondern einander schon seit Jahrzehnten kennen …
Der achte Band der „Boston“-Serie, die sich lose um die kriminalistischen Abenteuer der Amateur-Detektivin Sarah Kelling-Bitterbaum rankt, vermittelt seinen Lesern schon auf den ersten Seiten das beruhigende Gefühl, durch nichts Neues verschreckt zu werden. Seit jeher steht für Charlotte MacLeod weniger der Thrill, d. h. das Verbrechen und seine Aufklärung, im Mittelpunkt, sondern die Beschwörung einer guten, altmodischen, heilen Welt, bevölkert von liebenswerten und skurrilen Gestalten, denen ein Mord auch nicht dramatischer erscheint als ein Familienskandal, der sich vor fünfzig oder mehr Jahren abgespielt hat.
So schlägt MacLeod in der „Boston“-Serie einen Großteil ihres Witzes aus dem unglaublich verzweigten Clan der Kellings, einem genealogischen Albtraum hart an der Grenze zur Inzucht, der quasi die Bevölkerung eines ganzen Landstriches stellt und dem Verschrobenheit offensichtlich schon in die Wiege gelegt wird. Nach sieben Bänden hat sich die daraus erwachsende Komik allerdings ziemlich abgenutzt, doch der wahre (meist weibliche) MacLeod-Fan sieht das natürlich ganz anders und kann gar nicht genug von immer neuen Kellings mit ulkigen Namen und ebensolchen Gewohnheiten in märchenhaft-traulicher Landhaus-Atmosphäre lesen. Weit, weit weg ist die grausame Realität, vor der sich auf diese Weise vortrefflich fliehen lässt. Allzu spannend darf und soll es in dieser gemütlichen Nische nicht zugehen: „Cozys“ nennt man solche baldrianischen Krimis im Angelsächsischen mit gutem Grund. Alles wird schließlich immer wieder gut, während mindestens ein unverheirateter Großonkel zwölften Grades für kauzige Komplikationen sorgt; im vorliegenden Band ist er zwar nicht mehr am Leben, was aber nebensächlich ist, da für die Kellings Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sowieso nahtlos ineinander übergehen und in diesem zeitlosen In-sich-selbst-Ruhen selbst tote Verwandte stets präsent bleiben.
Schwierigkeiten mit dem Kelling-Clan kennt die treue MacLeod-Leserschaft nicht. Die Autorin lässt einmal eingeführte Figuren immer wieder die Handlung bereichern, bis sie sich in der ständigen Wiederholung dem Publikum eingeprägt haben. Ansonsten sind sie austauschbar, was die eigentlichen Hauptpersonen nicht ausschließt: Sarah und Max Bittersohn sind liebenswerte Gutmenschen, die als Überdosis genossen durchaus Brechreiz hervorrufen können. In inniger Liebe einander zugetan, gesegnet mit einem gar niedlichen Kindelein und verschont von profanen Sorgen, gehen sie einem (im MacLeodschen Sinn) aufregenden Beruf nach und verkörpern damit, wonach sich viele Leser/innen mindestens unterschwellig sehnen.
Das muss man sich vor Augen führen, wenn man als Neuling in die „Boston“-Welt stolpert. Charlotte MacLeod ist mit ihren Cozys jedenfalls gut gefahren. Im reifen Alter von 57 Jahren erst ist sie 1979 auf die „Boston“-Goldader gestoßen. Noch drei weitere Serien derselben Machart sicherten ihr (mildes) Kritikerlob und ein treues Publikum, das die fleißige Autorin über mehr als zwei Jahrzehnte zuverlässig mit immer neuen Variationen der alten Melodie bei Stimmung hielt.
Nach 1990 verlangsamte sich MacLeods Arbeitstempo merklich. Zum Kummer ihrer zahlreichen deutschen Fans war mit „Der Mann im Ballon“ nicht nur das Dutzend voll, sondern das Ende der Serie erreicht. Weitere Kriminalromane aus der Feder Charlotte MacLeods gab es nicht mehr. Die inzwischen 80-jährige Autorin litt an der Alzheimerschen Krankheit, an deren Folgen sie 2005 starb. Die absolut hirnrissige, geradezu peinliche „Auflösung“, die MacLeod sich für „Rolls Royce und Bienenstiche“ hat einfallen lassen, führt allerdings zu der Frage, ob der geistige Verfall nicht schon ein Jahrzehnt früher eingesetzt hat.
Die „Boston“-Serie:
01. Die Familiengruft (1979; „The Family Vault“) – DuMonts KB Nr. 1019
02. Der Rauchsalon (1980; „The Withdrawing Room“) – DuMonts KB Nr. 1022
03. Madame Wilkins‘ Palazzo (1981; „The Palace Guard“) – DuMonts KB Nr. 1035
04. Der Spiegel aus Bilbao (1983; „The Bilbao Looking Glass“) – DuMonts KB Nr. 1037
05. Kabeljau und Kaviar (1984; „The Convivial Codfish“) – DuMonts KB Nr. 1041
06. Ein schlichter alter Mann (1985; „The Plain Old Man“) – DuMonts KB Nr. 1052
07. Teeblätter und Taschendiebe (1987; „The Recycled Citizen“) – DuMonts KB Nr. 1072
08. Rolls Royce und Bienenstiche (1988; „The Silver Ghost“) – DuMonts KB Nr. 1084
09. Jodeln und Juwelen (1989; „The Gladstone Bag“) – DuMonts KB Nr. 1092
10. Arbalests Atelier (1992; „The Resurrection Man“) – DuMonts KB Nr. 1097
11. Mona Lisas Hutnadeln (1995; „The Odd Job“) – DuMonts KB Nr. 1104
12. Der Mann im Ballon (1998; „The Balloon Man“) – DuMonts KB Nr. 1110
http://www.dumontliteraturundkunst.de/
Stoker, Bram – Schloss der Schlange, Das
Adam Salton, reich geworden im fernen Australien, folgt der Einladung seines Großonkels Richard Salton, der in Mittelengland das behagliche Leben eines betuchten Landedelmannes führen und seinem Hobby frönen kann: der Archäologie. Richard hat sich dort niedergelassen, wo sich einst das alte Königreich Mercia erstreckte – ein denkbar geeigneter Ort für Altertumsforscher, denn Römer, Angelsachsen und Normannen haben ihre Spuren im Boden hinterlassen, die Richard und sein alter Freund Sir Nathaniel de Salis, Präsident der Archäologischen Gesellschaft von Mercia, begeistert ausgraben.
Gerade bietet sich den Forschern, denen sich Adam gern anschließt, eine einmalige Chance: Nachbar Edgar Caswall kehrt nach langer Abwesenheit auf sein Landgut Castra Regis zurück. Hier vermutet Richard die Ruinen einer Festung und Kultanlage der Römer, die fast fünf Jahrhunderte Britannien beherrschten. Doch Caswall verliert keine Zeit, den üblen Ruf seiner Familie – seine Vorfahren sollen ihren Reichtum erworben haben, indem sie einen Pakt mit dem Teufel schlossen – unter Beweis zu stellen. Heftig bedrängt er die junge Lilla Watford, Enkelin eines Pächters, obwohl sich die elegante, ihm gesellschaftlich viel näher stehende Lady Arabella March sehr um ihn bemüht, die sich in einer finanziellen Notlage befindet.
Auch die Saltons suchen – allerdings aus wissenschaftlichen Beweggründen – die Nähe der Lady. Diana’s Grove, jener Platz, auf dem ihr Landhaus steht, ist eine weitere historische Stätte. Sie wird im Volksmund auch die „Höhle des weißen Wurms“ geheißen, weil dort in grauer Vorzeit ein drachenähnliches Untier gehaust haben soll, das als Gottheit verehrt wurde. Dass diese Sage nicht eines wahren Kerns entbehrt, muss Adam feststellen, als er sich ritterlich auf die Seite der Watfords schlägt und sich dabei sowohl Caswell als auch Lady Arabella zu erbitterten Feinden macht …
Wie die Musik kennt auch die Literatur ihre „one hit wonder“ – Schriftsteller, die überhaupt nur ein Buch schreiben bzw. d a s Buch, den Überbestseller, neben dem ihre übrigen Werke schlicht verblassen und nicht zur Kenntnis genommen werden. Bram Stoker ist der Autor von „Dracula“. Ihn hat das Schicksal mit der Variante Nr. 2 geschlagen. Außer seinem Epos um den blutsaugenden Vampirgrafen nimmt die Kritik noch eine Handvoll kurzer Geschichten gnädig zur Kenntnis. Das Romanwerk wird sehr unfreundlich beurteilt; werden Bücher wie „Das Schloss der Schlange“ heute überhaupt neu aufgelegt, dann fehlt niemals der Hinweis darauf, dass Stoker Draculas geistiger Vater ist. (Im angelsächsischen Sprachraum ist das Copyright für „Lair of the White Worm“ offenbar wie Dracula im Sonnenlicht zu Staub zerfallen, so dass der Roman gleich an mehreren Stellen gratis aus dem Internet geladen werden kann.)
Das schürt Erwartungen, die jedoch nicht erfüllt werden können. Stoker schrieb „Das Schloss der Schlange“ 1911 als kranker, ausgebrannter, von Geldsorgen geplagter Mann; nur wenige Monate später ist er gestorben. „Dracula“ war sein Lebenswerk, ein Roman, an dem er viele Jahre gearbeitet, gefeilt, gestrichen, ergänzt und korrigiert hatte. Die Romane, die Stoker danach verfasste, entstanden in Eile und ohne den Enthusiasmus, der aus „Dracula“ trotz offensichtlicher literarischer Schwächen einen Bestseller für die Ewigkeit werden ließ.
Erneut lässt Stoker „unnatürliche“ Figuren auftreten und bemüht (im schicklichen Rahmen) Sex & Thrill, aber es ist anders als in „Dracula“ kaum mehr als ein müder Reflex. Dracula ist dieses Mal eine Frau? Nein, so einfach hat es sich Bram Stoker trotz seines schlechten Gesundheitszustands denn doch nicht gemacht. Zudem war diese Idee bereits 1871 (!) Grundlage der Novelle [„Carmilla“ 993 von Joseph Sheridan LeFanu gewesen. Lady Arabella March ist nicht durch den Biss eines Vampirs zur Blutsaugerin geworden. Ein vorzeitliches Wesen hat sich ihrer bzw. ihres Geistes bemächtigt. Das hat sie schamlos & mannstoll werden lassen, was für einige aus zeitgenössischer Sicht eindeutig zweideutige Szenen gut ist; auch 1911 galt bereits „Sex sells“, obwohl Stoker, der viktorianische Engländer, in dieser Hinsicht stark chiffriert arbeitete. Die „Stellen“ wirken auf diese Weise sogar noch deutlicher – Künstler lernten zu allen Zeiten schnell, wie sich die Zensur austricksen lässt.
Sex ist unheimlich und „schmutzig“, aber eben auch verführerisch – und deshalb doppelt „schlecht“: So schließt sich der Teufelskreis, dem Stoker schon in „Dracula“ Ausdruck verliehen hatte. Doch was dem gesellschaftlichen Bann verfällt und verdrängt wird, kehrt umso häufiger zurück. Diese „Prüfung“ wird bekanntlich nicht oft bestanden. Für Stoker kann nur „das Böse“ dahinterstecken, wenn brave Männer den Verlockungen des Weibes erliegen: Es ist eigentlich der Wurm, der Carswell über seine Sendbotin verhext und schwach werden lässt. (Sehr schön zeigt eine Illustration aus der Erstausgabe von 1911 übrigens, wie dieser „große, weiße Wurm“, der steil aufgerichtet Blitze aus seinen Augen schießt, auch gedeutet werden könnte …) Nach einer – allerdings umstrittenen – Theorie von Deborah Hayden litt Stoker an der Syphilis und schrieb „Das Schloss der Schlange“ im Endstadium dieser Krankheit als Mischung aus Roman und verschleierter Offenbarung.
Kaum verwunderlich ist übrigens, dass Stoker die „bösen“ Figuren wesentlich vielschichtiger gelungen sind als die „Helden“. Onkel und vor allem Neffe Salton vertreten Gesetz, Glaube & Moral und wirken entsprechend steif und uninteressant. Sie müssen halt ins Spiel, weil das Gute zu siegen hat. Erstaunlich ist die Charakterisierung des Oolanga, eines afrikanischen Dieners, den Edgar Carswell von seinen Reisen „mitgebracht“ hat. Einerseits schildert ihn Stoker sehr zeittypisch, nämlich chauvinistisch als triebhaften, primitiven, bösartigen „Neger“, lässt aber mehrfach durchblicken, dass auch Oolanga seine Träume von einem besseren Leben hat.
Übrigens ist die Idee, die dem „Schloss der Schlange“ zugrunde liegt, durchaus interessant. Arthur Machen oder Algernon Blackwood haben den Einbruch vorzeitlicher Naturgeister in die moderne Welt mehrfach und sehr wirkungsvoll dramatisiert. Aber Stoker kann mit diesem Konzept nichts anfangen. Einige bildhafte Details haften im Gedächtnis. Der große Drache über Castra Regis gehört dazu, auch die Schilderung des Wurms hat ihre Momente. Dennoch ist „Das Schloss der Schlange“ insgesamt ein schier unlesbares Dickicht begonnener, aber nie beendeter Erzählstränge, die erst recht nicht zu einem überzeugenden Finale zusammenfinden. Stoker hat die Kontrolle über seinen Roman verloren und wollte ihn schließlich nur noch irgendwie zu Ende bringen – ein trauriger Abschied für einen Mann, der beruflich wie privat anscheinend nicht viel Glück in seinem Leben hatte; selbst im Tod blieb ihm der Ruhm als „Dracula“-Autor verwehrt: fast zeitgleich sank die „Titanic“ in den eisigen Fluten des Nordatlantiks, und dieses Ereignis war es, das die Schlagzeilen in aller Welt beherrschte.
1988 inszenierte der einst als Skandalregisseur gefeierte oder verfluchte Ken Russell nach eigenem Drehbuch den gleichnamigen Film zu Stokers Roman. Für die Hauptrollen verpflichtete er einen noch sehr jugendlichen Hugh Grant sowie Amanda Donahue und Catherine Oxenberg und schuf einen turbulenten, sein geringes Budget deutlich offenbarenden Horrorfilm im Stil der späteren „Hammer“-Heuler. „Lair“, der Film, wird wahlweise als geniale, ehrfurchtsfreie Interpretation einer lange als unverfilmbar geltenden Vorlage oder als „Meisterwerk“ des Schund- und Trashfilms gewertet.
Bram (eigentlich Abraham) Stoker wurde am 8. November 1847 in dem irischen Dorf Clontarf in der Nähe von Dublin geboren. Er war ein kränkliches Kind, das die ersten sieben Jahre seines Lebens praktisch im Bett verbringen musste. Die Erfahrung des scheinbar ständig präsenten Todes prägte Stoker nachhaltig. Ebenfalls nie in Vergessenheit gerieten die Geschichten seine Mutter, die aus dem reichen irischen Sagenschatz schöpften, der das Übernatürliche, den Tod und deren heimliche, aber ständige und nicht ungefährliche Präsenz im Leben der Menschen thematisierte.
Stoker besaß eine ausgeprägte künstlerische Ader, doch leider nicht das Einkommen, ihr nachzugeben. Nach einem Studium am Trinity College (Dublin) schlug er die Beamtenlaufbahn ein. Nebenbei schrieb er. 1881 erschien eine Sammlung allegorischer, ziemlich düsterer Kunstmärchen oder Kindergeschichten. Neben seiner Beamtentätigkeit veröffentlichte er weitere Kurzgeschichten und (ab 1871) Theaterkritiken. Damit erregte er die Aufmerksamkeit des berühmten Shakespeare-Schauspielers Henry Irving: Stoker folgte diesem 1878 nach London, wo er die Geschäftsführerstelle in Irvings neuen „Lyceum Theatre“ übernahm. Die scheinbare Eintrittskarte in die Welt der Kunst entpuppte sich als Knochenjob für eine nüchterne Bürokratenseele und Irving als exzentrischer Egoist, der es für selbstverständlich hielt, dass Stoker ihm bei Tag und bei Nacht zur Verfügung stand.
Dennoch hielt Stoker aus. Seinen eigenen Durchbruch erhoffte er von einem Roman, für den er viele Jahre recherchiert hatte. „Dracula“ erschien 1897 – und wurde eher beiläufig zur Kenntnis genommen. Stoker blieb also am Theater, doch als Henry Irving 1905 starb, stand er auf der Straße. Nun schrieb er, um sich und seine Familie zu ernähren; ein aufreibender Kampf, der zunehmend an seiner Gesundheit zehrte. Seine späteren Romane erreichten nicht einmal annähernd den Rang seines „Dracula“. Bram Stoker starb am 20. April 1912. Den Ruhm, den er sich erträumt hatte, erlebte er nicht mehr. Nur wenige Jahre später begann Dracula seinen Siegeszug über die ganze Welt.
http://www.bastei-luebbe.de
Dan Simmons – Im Auge des Winters
Nach einem missglückter Selbstmordversuch versucht Dale Stewart, Literaturdozent und Schriftsteller in mittleren Jahren, einen Neuanfang. Er beschließt er den Rückzug in die Einsamkeit, wo er mit sich selbst ins Reine kommen und ein neues Buch schreiben möchte. Stewart wählt als Thema die eigene Vergangenheit. In Elm Haven, einer Kleinstadt im ländlichen Illinois der Vereinigten Staaten, ist er aufgewachsen und hat eine glückliche Kindheit verlebt, derer er sich gern erinnert.
Allerdings gibt es da einen schwarzen Fleck in seinem Gedächtnis. Die Kindheit in Elm Haven war nicht frei von Tragödien. Das alte Farmhaus, in das Stewart nun einzieht, gehörte dem Vater seines besten Freundes Duane McBride, der vor vier Jahrzehnten bei einem nie geklärten Unfall grausam ums Leben kam. Damals hatte sich das Böse in der alten Central School eingenistet und Elm Haven in seinen Bann gezogen. Zahlreiche Menschen mussten sterben, und zu ihnen gehörte auch Duane, was Dale Stewart längst verdrängt hat. [Diese Vorgeschichte erzählt Simmons in „Sommer der Nacht“] Dan Simmons – Im Auge des Winters weiterlesen
Manly Wade Wellman – Der Schattensee
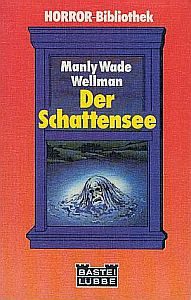
Manly Wade Wellman – Der Schattensee weiterlesen
Littell, Robert – Company, Die
Der letzte Tag des Zweiten Weltkriegs leitete zugleich den Dritten ein, sprach einst ein Zyniker, der aber kein Dummkopf war. Nazi-Deutschland wurde zerschlagen, was weltfremde Träumer zu der Annahme verleitete, die Geschichte beginne wieder bei null und bringe nun Frieden und Einigkeit über die Menschheit. Stattdessen begann der Kalte Krieg, der diese Erde in zwei supermächtige Blöcke zerfallen ließ. Der „freie Westen“, mehr oder weniger offen unter dem Primat der USA, stand gegen die UdSSR und den „Ostblock“. Getrennt wurden beide Sphären durch den „Eisernen Vorhang“, den Stalin niedergehen ließ. Nie hatte sich der sowjetische Diktator davon abhalten lassen, die Welt unter das kommunistische Joch zu zwingen. Unverhohlen nutzte er ab 1945 den Kriegssieg dazu, seinen Einflussbereich in Europa und Asien auszudehnen.
Lange wollten die einstigen Verbündeten USA dies nicht wahrhaben, aber dann lernten sie schnell: 1947 versprach die Truman-Doktrin allen freien Völkern der Welt den Beistand der USA im Kampf gegen jeglichen Totalitarismus. Amerikanische Auslandspolitik wurde zukünftig von umfangreichen Geheimdienstaktivitäten begleitet: Die „Central Intelligence Agency“, kurz CIA, führt seitdem einen Untergrundkrieg gegen ihren mächtigen Gegner, den sowjetischen KGB, in dem sich beide Parteien nicht das Geringste schuldig bleiben.
Macht korrumpiert; eine alte Weisheit: Wie ein Moloch breitet sich die CIA aus, als der Kalte Krieg zu eskalieren beginnt – und sie macht sich selbstständig. Anfang der 50er Jahre zeichnet sich die Gefahr eines atomaren Schlagabtausches immer deutlicher ab. Dem glaubt die CIA nur durch eine intensivierte Unterwanderung der UdSSR und ihrer Trabantenstaaten begegnen zu können. Dazu braucht es mehr Personal – nicht mehr nur ehemalige Soldaten, Schnüffler der alten Schule oder sogar wendehalsiger Nazi-Agenten, sondern junge, ausgebildete Männer und Frauen, die sich nicht scheuen, sich im Dienst der vorgeblich guten Sache die Finger schmutzig zu machen.
Auf Jack McAuliffe und Leo Kritzky trifft dies zu; sie sind idealistisch und patriotisch, d. h. vor allem stramm antikommunistisch. Der dritte im Bunde ist der russische Austauschstudent Jewgeni Alexandrowitsch Tsipin, den es indes bald zur Konkurrenz zieht. Während Jack und Leo von der CIA angeheuert werden, wird Jewgeni ein „Schläfer“, der in den USA lebt und auf seine Einsätze wartet. Im nächsten halben Jahrhundert werden sich die Wege dieser drei Männer immer wieder kreuzen. Das Katz-und-Maus-Spiel wird sie um den gesamten Globus führen – und Opfer kosten, Unschuldige, scheinbar Schuldige und manchmal einen echten Übeltäter.
Der Korea-Krieg, der Volksaufstand in Ungarn, das Desaster in der Schweinebucht, die Watergate-Affäre, der Bürgerkrieg in Afghanistan und schließlich Glasnost und Perestroika sind die Stationen dieses Agenten-Krieges, der zugleich die jüngere und jüngste Weltgeschichte widerspiegelt – bis der Zusammenbruch der Sowjetunion der CIA ihres wichtigsten Gegners und ihrer Legitimation zu berauben scheint. Aber viele Jahrzehnte des heimlichen Krieges haben die Beteiligten gelehrt, dass es irgendwo auf der Welt immer eine Bedrohung geben wird – und wenn man sie selbst ins Leben rufen müsste.
Ein nicht nur im Umfang gewaltiges Werk legt Politthriller-Routinier Robert Littell hier vor. „Die Company“ ist sicherlich das ehrgeizigste Projekt seiner langen Schriftsteller-Karriere. Unerhörte Arbeit hat er investiert, bis ins Detail recherchiert, und unabhängig von der Frage, ob er stets historische Präzision für sich beanspruchen kann (um es vorweg zu nehmen: kann & will er nicht), hat er auf jeden Fall einen Grad der Stimmigkeit und Atmosphäre erreicht, die viele Seiten (trotz eines gewissen Hangs zur historischen Predigt) wie im Fluge verstreichen lassen.
Dabei hat Littell bei allem Aufwand beileibe das Rad nicht neu erfunden. Ein Stilist ist er nie gewesen. Auch „Die Company“ ist denkbar einfach, fast altmodisch strukturiert. Da haben wir eine Reihe von Hauptfiguren, denen wir immer wieder begegnen, und eine Chronologie, die von der Weltgeschichte vorgegeben wird. Die Werbung zitiert Mario Puzos [„Der Pate“ 2767 als Vergleich und tut dabei, als sei dies ein bemerkenswert gutes Buch gewesen, was keineswegs zutrifft.
Tatsächlich steht „Die Company“ als eine Art dramatisiertes, d. h. um fiktive und narrative Elemente ergänztes Geschichtsbuch, das freilich keinen Anspruch auf historische Genauigkeit erheben kann, eher in der Tradition von James Michener (1907-1997), der seinen Ehrgeiz daran setzte, die Geschichte möglichst vieler US-Staaten von der Entstehung der Erde bis in die Gegenwart nachzuerzählen, wobei alle Protagonisten irgendwie miteinander verwandt sind und stets an historischen Brennpunkten auftauchen, so sehr dies die Gesetze der Wahrscheinlichkeit auch strapazieren mag. Die Lücken zwischen dem Weltbewegenden werden mit seifenoperlichen Intermezzos gefüllt, was emotionale Tiefe suggeriert, die indes meist eher Versprechen bleibt und zum gefühlsduseligen Klischee gerinnt. Auch Littell ist in dieser Beziehung kein Meister und beschränkt derartige Anwandlungen klugerweise auf ein Minimum; der Auftrieb geplagter, aber geduldiger und zum Wohle ihres Landes alle Fährnisse (mehr oder weniger) still erleidender Ehefrauen, Mütter etc. ist trotzdem noch groß genug.
Die Handlung als solche zerfällt in voneinander mehr oder weniger unabhängige Episoden, die der Verfasser hintereinander schalten konnte. „Die Company“ umfasst viele hundert Seiten, doch Littell hätte ohne Schwierigkeiten noch einige Kapitel einschieben können. Trotzdem gibt es so etwas wie einen roten Faden. Das Buch erzählt die Geschichte einer Gruppe von Idealisten, die im Dienste einer guten Sache ein ehrgeiziges Projekt verwirklichen, das eine ungute Eigendynamik entwickelt, sie verformt und korrumpiert, ohne dass sie selbst dies zu bemerken scheinen.
Übrigens bleibt fraglich, ob Verfasser Littell sich dieser Interpretation anschließen würde. Er ist eher ein Falke als eine Taube, eindeutig rechts der politischen Mitte, ganz sicher nicht liberal, und das schimmert in seinem Werk nicht nur durch, sondern wird deutlich und markig thematisiert. Hier ist es z. B. die Figur Leo Kritzky, die aufgrund eines Versehens in die Mühlen der eigenen „Firma“ gerät und dabei mit kalter Berechnung genauso übel gefoltert wird, wie dies den teuflischen KGB-Teufeln angelastet wird. Aber was geschieht, als sich Kritzkys Unschuld herausstellt? Weil’s letztlich für Uncle Sam war und jeder schließlich mal irren kann, reiht sich der Geschundene sogleich wieder in Schar seiner Mitstreiter ein und geht wacker erneut auf Kommunisten- und Terroristenhatz. (Zu Littells Ehrenrettung sei erwähnt, dass er nachträgliche Verklärungen ablehnt; sein Porträt des US-Präsidenten Ronald Reagan ist höchst boshaft und ziemlich erschreckend.)
Freilich ist „Die Company“ auch der Versuch, die ganz besondere Geisteshaltung in Worte zu fassen, von der die CIA mindestens bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion geprägt war. Littell zeichnet sehr schön eine ganz eigene Welt, deren Regeln von Paranoia und Misstrauen bestimmt werden – und bestimmt werden müssen, da hinter jedem Ereignis auf dieser Welt „der Feind“ stecken kann, der mit unfassbarer Raffinesse versucht, seinen Gegner zu überlisten. Das prägt und hinterlässt Spuren bei denen, die sich dem „Großen Spiel“ widmen, bis sich CIA und KGB so sehr gleichen, dass man sie für Spiegelbilder halten könnte (was beide Parteien allerdings vehement abstreiten würden).
Überhaupt wirkt der Krieg der Geheimdienste tatsächlich wie ein globales Spiel, das seine Teilnehmer süchtig werden lässt. Kim Philby, der berühmte britische Spion, fasst dies sehr schön in Worte, als er trotz drohender Entdeckung die Flucht in das Land verweigert, für das er viele Jahre spioniert hat: Die UdSSR schätze er ideologisch, meint er da, aber lieber aus der Ferne, denn leben wolle er dort lieber nicht. Geheimdienstler neigen folglich zur Schizophrenie; auf jeden Fall stehen sie unter Dauerstress, was wohl auch die erstaunliche Häufung von Saufexzessen erklärt, die Littell in diesen politisch korrekten Zeiten in sein Werk einflicht. Hinzu kommen die unerhörten Möglichkeiten, die eine mit Macht und Geld genudelte Organisation wie die CIA ihren meist jungen und begeisterten Mitgliedern bietet: Auf Staatskosten bereisen sie die ganze Welt, jagen die Bösen und drehen mit am Rad der Geschichte, was sonst der großen Politik und der Wirtschaft vorbehalten bleibt.
Spätestens in den 1960er Jahren verkam die CIA, die einst gegründet wurde, um taktisch bedeutende Informationen für die US-Regierung zu sammeln, zu einem obskuren Staat im eigenen Staate, der unter Brechung praktisch sämtlicher Gesetze selbst offensive Politik zu treiben begann (und sich dabei denkbar ungeschickt anstellte). Auch dies wird vom Verfasser offen angesprochen, doch wiederum kann man nicht von Objektivität sprechen: Littells CIA war, ist und bleibt im Kern gut und notwendig; ihre hehren Ziele verliert sie womöglich manchmal aus den Augen, aber das ist stets nur einigen Verblendeten, vor allem jedoch notorisch feigen Politikern anzulasten, die den Schwanz einziehen, wo Härte und Rückgrat gefragt wären.
Daher verwundert es nicht, dass der Verfasser das moderne Russland mit denselben misstrauischen Augen betrachtet wie die alte Sowjetunion. Spione werden immer Konjunktur haben, so lautet Littells – durchaus überzeugendes – Resümee, aber nichtsdestotrotz schießt er hier über sein Ziel hinaus: Welt, sei wachsam & lass’ die CIA ihre heilige Arbeit tun, denn der Feind ist noch lebendig und stark; er hat nur seine Methoden geändert. Dass Russland, wirtschaftlich marode, von politischen Krisen und sogar Bürgerkriegen geschüttelt, zur Zeit über die Ressourcen verfügt, das „Große Spiel“ im großen Stil fortzusetzen, mag der Leser nicht ernsthaft glauben, aber das ist ja genau der Anschein, den der böse Iwan erwecken möchte, um uns einzulullen – und mit dieser Erkenntnis haben wir wohl Littells Aufnahmeprüfung in den Club der Paranoiker mit Glanz bestanden … Und schließlich gibt es im Nahen Osten oder mit Nordkorea immer neue Schurkenstaaten, die es unter sorgfältiger Beobachtung zu halten gilt.
http://www.knaur.de
Algernon Blackwood – Der Tanz in den Tod. Unheimliche Geschichten
Eine Novelle und neun Kurzgeschichten von Algernon Blackwood (1869-1951), dem Meister der angelsächsischen Gruselliteratur:
– Der Tanz in den Tod (The Dance of Death, 1907), S. 7-18: Browne, ein unglücklicher Büroknecht mit ausgeprägter Herzschwäche, tanzt für sein Leben gern. Die schöne Issidy, das mysteriöse Mädchen in Grün, wird seine letzte Partnerin.
– Der Mann, den die Bäume liebten (The Man Whom the Trees Loved, 1912), S. 19-97: Sein Leben lang hat der alte Bittacy Bäume geliebt; manchmal scheinen sie ihm sogar lebendig. Dass sie außerdem mit eigener Intelligenz begabt aber recht Besitz ergreifend sind, merken er und seine Gattin, als sie ein einsam gelegenes Landhaus am Rande eines großen Waldes beziehen. Algernon Blackwood – Der Tanz in den Tod. Unheimliche Geschichten weiterlesen
Nesbø (Nesboe), Jo – Fährte, Die
Ein psychopathischer Bankräuber, genannt der „Exekutor“, terrorisiert die norwegische Stadt Oslo. Obwohl er seine Beute ohne Zwischenfälle einkassieren konnte und keine Spuren am Tatort hinterlassen hatte, erschoss er scheinbar ohne Grund eine junge Angestellte. Seitdem hat der hervorragend organisierte Täter noch weitere Verbrechen begangen, die durch ihre kaltblütige Planung und Durchführung auffallen. Für die Presse ist diese Serie ein gefundenes Fressen, was die Politik nervös werden lässt, gilt es doch, das Bild einer vorbildlich regierten Stadt zu wahren, damit dahinter die bekannten Spielchen um Macht und Geld ungestört weiterlaufen können.
Im Polizeidezernat für Gewaltverbrechen ging der „Exekutor“-Fall an den ehrgeizigen aber unfähigen Dezernatsleiter Ivarsson. Als dieser keine schnellen Ergebnisse vorweisen kann, übernimmt Harry Hole, ein Ermittler, der durch seine bemerkenswerten Fahndungserfolge bekannt und wegen seiner alkoholbedingten Ausraster berüchtigt ist. Dank seiner unkonventionellen Methoden und unterstützt durch eine neue Kollegin, die mit dem perfekten Personengedächtnis ausgestattete Beate Lønn, kann Hole trotz der miserablen Indizienlage bald erste Teilergebnisse erzielen.
Allerdings ist Hole abgelenkt. In Abwesenheit seiner Lebensgefährtin Rakel hatte er eine Affäre mit der ehemaligen Geliebten Anna begonnen und war dabei erneut dem Alkohol verfallen. Als er mit Filmriss aus seinem aktuellen Rückfallrausch erwachte, fand man Anna erschossen in ihrem Bett. Die Spuren deuten auf Selbstmord hin. Harry ist sich da nicht sicher. Was ist in der Nacht geschehen, die in seinem Gedächtnis fehlt? Als Polizist schweigt er, der als Hauptverdächtiger gelten würde. Doch Anna ist tatsächlich ermordet worden: Der Täter nimmt Kontakt zu Harry auf und quält ihn mit E-Mails, in denen er droht, die Polizei zu informieren. Harry muss unauffällig nach dem Mörder suchen und gleichzeitig im vollen Rampenlicht nach dem „Exekutor“ fahnden – ein Drahtseilakt, der nicht lange gut gehen kann und nicht nur für Harry in einem Desaster endet …
Wenn man den Drang verspüren sollte, „Die Fährte“ in eine Schublade zu stecken, so könnte man dieses Buch als einen derjenigen Thriller bezeichnen, die Jeffery Deaver – stets vergeblich – zu schreiben versucht. Gemeint ist diese besonders vertrackte Art von Thriller, deren Plot sich dreht und windet wie ein schlüpfriger Aal, seinen Lesern dabei immer wieder zwischen den Fingern durchschlüpft, um im Finale dort zu landen, wo niemand ihn vermutet hätte. Kurz und gut: „Die Fährte“ ist ein Krimi, der sein Publikum gleich mehrfach täuscht und mit neuen Wendungen verblüfft, ohne es durch aus dem Hut gezauberte, quasi übernatürliche Wendungen vor den Kopf zu stoßen. Die atemberaubende Story schlägt ihre Haken sogar, ohne dass ihr die Logik darüber jemals verloren ginge.
Das verwundert durchaus, da „Die Fährte“ ein an Klischees überaus reiches Werk ist. Auch in Nesbøs Skandinavien gibt es offensichtlich keinen Sommer. Harry Hole ermittelt in einem Oslo, das düster und regnerisch ist. Dieses Klima gilt gleichzeitig als Metapher für die gesellschaftliche Kälte: Die Polizei ist kaum mehr Ordnungsmacht, sondern tanzt am Gängelband von Politik und Medien. Streber und Karrieristen geben den Ton an; sie drängen diejenigen Kollegen, die sich auf ihren Job konzentrieren, an den Rand und lassen sie desillusioniert und verbittert zurück. Auch sonst ist die Welt schlecht, d. h. geprägt von Unvernunft, Habgier, Fremdenfeindlichkeit usw. usf. Doch Nesbø übertreibt es nicht und findet ein Gleichgewicht zwischen diesen Unerfreulichkeiten, die einen als Leser deshalb nicht bedrängen oder sich gegenseitig erschlagen, sondern ihren Teil zur Handlung beitragen.
Die Kunst des Jo Nesbø manifestiert sich vor allem in der Figur des Harry Hole: Wie viele einsame, dauerdeprimierte Ermittler, die an der Flasche hängen, verträgt der Krimileser? Hole scheint exakt in diese schon viel zu tief ausgehauene Kerbe zu stolpern. Dennoch schafft er es, Individuum zu bleiben: Harry ist kein Super-Detektiv und privat ein schwacher Mensch. Nesbø findet den schmalen Grat zwischen Routine und Übertreibung und lässt seinen menschlichen Helden dort mit traumwandlerischer Sicherheit meist waghalsige Kunststücke treiben. Zur Spannung der Krimi-Handlung kommt deshalb stets die bange Frage, ob er sich auch dieses Mal halten kann oder endgültig stürzen wird.
Bei seinem Seiltanz hilft Harry mehr als ein Quäntchen eistrockenen Humors. Hole wälzt sich – anders als z. B. ein literarisch ungleich erfolgreicherer Kollege aus dem schwedischen Ystad – nicht stellvertretend für die enttäuschten Gutmenschen dieser Welt leidend im Sumpf der Gemeinheiten & Scheußlichkeiten, die ihre Artgenossen sich einander antun. Zwar kann sich auch Nesbø einige allzu aufdringliche Verweise in diese Richtung nicht verkneifen – Harry verfolgt mehrfach am Fernseher den Stand des US-amerikanischen „Befreiungskrieges“ im Irak und denkt sich seinen Teil -, doch letztlich konzentriert er sich wieder auf den aktuellen Fall, der es so in sich hat, dass sein Verfasser auf den erhobenen Zeigefinger leicht verzichten kann.
Hole fügt der langen Liste seiner persönlichen Verfehlungen dieses Mal gleich mehrere Neueinträge an. Er verfällt abermals seinem persönlichen Dämon, dem Alkohol, lässt sich von einer ehemaligen Geliebten umgarnen, obwohl er inzwischen neu verbandelt ist, und setzt zu einem wahren Kamikazeflug gegen seine ohnehin wenig von ihm eingenommenen Vorgesetzten an. Doch Harry wächst in der Krise über sich hinaus; er scheint den Druck zu benötigen, der den sechsten Sinn des guten Fahnders stimuliert. Zudem kann er sich auf einige wenige treue Freunde verlassen, die wie er zu den Außenseitern gehören und kein Problem damit haben, Gesetze und Regeln ein wenig großzügiger auszulegen, als dies gestattet bzw. toleriert wird.
Das ist nur gut so, denn den Schurken, die uns Nesbø in „Die Fährte“ vorstellt, lässt sich schwerlich unter getreuer Beachtung der Dienstvorschrift beikommen. Da ist zunächst der eiskalte „Exekutor“, der seinen Häschern mehr als ein gelungenes Rätsel aufgibt. Hole speist mit dem Teufel, um ihn zu fassen, wobei er bald merkt, dass der Löffel, den er benutzt, nicht lang genug ist: Raskol Baxhet, ein Bankräuber, der sich aus unerfindlichen Gründen selbst stellte, ist wahrlich ein zwielichtiger Charakter. In einem Augenblick lässt er sich von Hole als „Berater“ in Sachen „Exekutor“ anheuern, im nächsten bedroht er dessen kleine Familie, um sich an einem alten Feind rächen zu können. Aber Harry zeigt sich auch dieser Herausforderung gewachsen: Nicht durch Gewalt kommt er Baxhet bei, sondern indem er dessen Intrigenspiel noch besser spielt als dieser – gerade noch, denn sein Gegner ist ein Meister!
Innerhalb der Polizei kämpft Hole offene und verborgene Schlachten aus. Dezernatsleiter Ivarsson repräsentiert das Establishment, das Quertreiber und interne Kritiker wie Harry hasst und mobbt. Nesbø gönnt uns den Genuss zu beobachten, wie Ivarsson sich selbst demontiert. Aber er bleibt Harrys Vorgesetzter und wird seine Zeit abwarten, um sich zu rächen. Ebenfalls präsent ist Tom Waaler, der die weitaus größere Gefahr darstellt. Sein infamer Feldzug gegen Hole, der ihn des heimtückischen Mordes an einer Kollegin zumindest verdächtigt, ist an Spannung kaum zu überbieten. Waaler nutzt geschickt die Animositäten zwischen Harry und Ivarsson, während er gleichzeitig Beweise manipuliert, die auf Hole als Drahtzieher hinter dem „Exekutor“ hinweisen. Auch dies kann Harry abwehren; er geht sogar einen Schritt weiter und intensiviert seine Ermittlungen gegen Waaler – dieser Subplot wird auch im nächsten Band der Serie eine wichtige Rolle spielen.
Jo Nesbø wurde 1960 in Oslo geboren. Er war zunächst als Finanzanalytiker und Ökonom für die norwegische Handelshochschule in Bergen tätig, arbeitete aber nebenberuflich als Journalist, bevor er sich als Schriftsteller selbstständig machte. Schon für seinen ersten Kriminalroman – „Flaggermusmannen“ (dt. „Der Fledermausmann“) bekam Nesbø 1997 den Preis für den besten Krimi des Jahres. Hier schildert der Autor die Erlebnisse von Kriminalkommissar Harry Hole auf einer verhängnisreichen Dienstreise nach Australien.
Ebenfalls subtil, aber trotzdem volkstümlich ist die Pop-Band „Di Derre“: Frontmann, Vokalist und Komponist Jo Nesbø ist auch ein anerkannter Musiker, der nach Auskunft der Kritik gute Texte mit schwungvollen Popmelodien verbindet.
Ruth Rendell – Das Verderben

Ruth Rendell – Das Verderben weiterlesen
H. P. Lovecraft – Der Fall Charles Dexter Ward

H. P. Lovecraft – Der Fall Charles Dexter Ward weiterlesen
Stuart MacBride – Die dunklen Wasser von Aberdeen
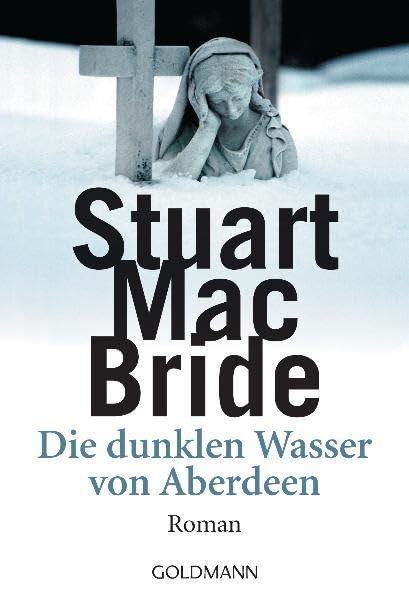
Das geschieht:
Nach krankheitsbedingter Arbeitspause kehrt Detective Sergeant Logan McRae in den Dienst der Grampian Police im ostschottischen Aberdeen zurück. Bereits am ersten Tag muss er einen grausigen Mordfall übernehmen: In einem Graben fand man den Körper des erst dreijährigen David Reid. Seit drei Monaten wurde das Kind vermisst. Sein Mörder hat ihn erdrosselt. Schlimmer noch: Er ist offensichtlich zur Leiche zurückgekehrt und hat sich „Souvenirs“ abgeschnitten.
Wie sein Chef, der aufbrausende Detective Inspector Insch, schließt McRae aus dem planvollen Vorgehen des Mörders, dass David womöglich nicht dessen erstes Opfer ist. Außerdem ist davon auszugehen, dass er seine kranke Fantasie an einem weiteren Kind ausleben wird. Und tatsächlich verschwindet kurz darauf der fünfjährige Richard Erskine. Die schlimmsten Befürchtungen scheinen sich zu bewahrheiten, als auf einer Müllhalde eine Kinderleiche gefunden wird. Allerdings handelt es sich um den Körper eines drei- oder vierjährigen Mädchens, das niemand als vermisst gemeldet hat.
Alle Beamten der Grampian Police ermitteln intensiv in diesen Fällen von Mord und Entführung. Die Öffentlichkeit ist aufgestört, die Medien fachen den die Auflage stärkenden Volkszorn gezielt an. Auch die Politik wird aufmerksam und setzt Insch und seine Leute publicitywirksam unter Druck. McRae muss sich nicht nur um die unbekannte Kinderleiche kümmern. Man überträgt ihm auch einen Mordfall, dessen Opfer man ohne Kniescheiben aus dem Hafenbecken gezogen hat. Es handelt sich um einen engen ‚Mitarbeiter‘ des Gangsters Malcolm McLennan, genannt „Malk the Knife“, der aus Edinburgh in die Unterwelt von Aberdeen drängt. Es wird eng für die Polizei. Immer neue Verdächtige tauchen für alle Fälle auf. Nur langsam klärt sich das Durcheinander; es verschafft dem Kidnapper die Zeit, sich ein weiteres Kind zu schnappen …
Tartan Noir – etwas grobmaschiger
Breit ist der Schatten, den Ian Rankin als Krimiautor über Schottland wirft. Seit er den unvergleichlichen Inspektor John Rebus in ebenso tragische wie bizarre Fälle verwickelt, hat sich für diese nordenglische Variante des Thrillers sogar ein eigener Genrebegriff namens „Tartan Noir“ eingebürgert. Er beschreibt sehr gut ein bestimmtes literarisches Webmuster, das Rankin vorbildhaft vorexerzierte: Düstere Mordfälle geschehen in einer rauen (Stadt-) Landschaft, die von ebensolchen Bewohnern bevölkert wird. Die Stimmungs-Tonart ist (wie das Wetter) Moll, wobei die „skandinavische Tristesse“, die spätestens seit den Wallander-Romanen des Henning Mankell als Markenzeichen für den sozialkritischen europäischen Krimi der Gegenwart gilt, durch einen ruppigen, trockenen Humor angenehm gebrochen wird: Die Welt ist schlecht, aber das muss uns nicht auch noch den Leseabend verderben!
Nun tritt Stuart MacBride in Rankins Fußstapfen – die Parallelen sind unübersehbar. Sie werden vom Verfasser auch gar nicht geleugnet, sondern in einem hübschen In-Joke auf S. 421 angesprochen. „Die dunklen Wasser von Aberdeen“ liest sich wie ein Rebus-Roman, was zunächst einmal als Lob zu verstehen ist. Der Plot ist angenehm vertrackt und wird sauber entwickelt, die Ermittlungen sind spannend geschildert, die Schauplätze plastisch beschrieben, die Figuren wirken lebendig.
Und doch ist da zweierlei, das irritiert. Die Übereinstimmung zwischen Rankin und MacBride ist manchmal allzu auffällig; man spricht nicht nur dieselbe Sprache, sondern auch mit derselben Zunge, wobei Rankin ‚unverdächtig‘ dasteht – John Rebus ermittelt schon seit den 1990er Jahren. (Der deutsche Goldmann Verlag unterstreicht die ‚Verwandtschaft‘ übrigens durch eine Buchgestaltung, die sich eng an die der Rankin-Bestseller anlehnt; hier sollen Leser ‚umgeleitet‘ werden.)
Brachiale Taten, gebeutelte ‚Helden‘
Zweitens missvergnügt MacBrides Versuch, sich durch noch größere Originalität in der Schilderung perverser Gewaltverbrechen zu etablieren. Der Autor setzt hier auf ein Mehr an Blut, Verwesung und Pathologen-Gemetzel. Gleichzeitig nagt er wie ein politisch unkorrekter Biber am ohnehin morschen Stamm eines Tabus: Er lässt seinen Serienmörder auf kleine Kinder los, die er als Opfer unter getreuer Schilderung aller grässlichen Details quasi instrumentalisiert. Dies wäre nicht nötig; ein Irrer, der sich an Erwachsenen vergreift, hätte es genauso getan. MacBride setzt hier unverhohlen auf den unvergleichlichen Schrecken, den das Kapitalverbrechen am ‚unschuldigen‘ Kind auslöst; ein Trick, den man übel nimmt, weil es kalkuliert wirkt.
Ist Logan McRae ein bisher unbekannt gebliebener Bruder von John Rebus? Auch hier sind die Ähnlichkeiten frappant, nur dass das Geschick dem Kollegen aus Aberdeen deutlich heftiger mitgespielt hat – ein weiteres „Mehr“, aber nicht unbedingt „Besser“, das MacBride seinem Helden angedeihen lässt. McRae ist ganz genretypisch ein guter Polizist, was von den bornierten Vorgesetzten natürlich nicht zur Kenntnis genommen wird, dazu ein sperriger Charakter, von Natur aus sogar für einen Schotten ein wenig eigenbrötlerisch, und die Kollegen meiden ihn fast abergläubisch, seit ihn – jetzt dreht MacBride mächtig an der Schicksalsschraube – ein 15-facher Frauenmörder bei einem Kampf auf Leben & Tod mit dem Messer beinahe ausweidete. „Lazarus“ nennt man ihn nun im Revier, ist er doch dem Sensenmann nur knapp entronnen und muss für den Rest seines Lebens mit Narben und Schmerzen leben.
Privat sieht es auch nicht rosig aus. Natürlich – auch hier regiert das Klischee – hat ihn die Freundin verlassen, die ihm indes – Stoff für allerhand zukünftige Verwicklungen ist garantiert – als Arbeitskollegin verbunden bleibt. McRae bläst nach Feierabend ordentlich Trübsal, schaut zu tief in die Flasche, verstrickt sich ungeschickt in perspektivenlose Liebeshändel. Glücklicherweise ist Constable Watson, McRaes Partnerin, recht bodenständig. Sie erdet den manchmal allzu sehr von seiner Inspiration mitgerissenen McRae und vermittelt darüber hinaus dem Leser pflichtschuldig die übliche Palette chauvinistischer Ungerechtigkeiten, denen auch die Polizeibeamtin von Heute ausgesetzt ist.
Debüt als Petrischale
McRaes Vorgesetzter bleibt eine prägnante Nebenrolle als großer Exzentriker. Detective Inspector Insch ist ein poltriger Dickwanst, der pausenlos Gummibärchen, Lakritz und anderen Geleekram mampft. Selbstverständlich verbirgt sich hinter dieser Fassade nicht nur ein wacher Verstand, sondern auch ein mitfühlendes Herz, sodass McRae und Insch sich in jenen Ritualen ergehen können, die in einer wahren Männerfreundschaft sentimentale Sympathiebekundungen ersetzen.
MacBride besetzt viele Rollen seines Krimis geschickt mit überzeichneten Figuren. Hart an der Grenze zum Klischee agieren abgebrühte Polizisten, wüste Ganoven, dreiste Reporter. In der doch sehr düsteren Geschichte sorgen trockene Wortwitze für notwendige humoristische Momente, ohne dadurch den Plot zu unterminieren. In diesem Punkt kann MacBride Ian Rankin übrigens mühelos das Wasser reichen, so dass der Kreis sich schließt: Dieser „Tartan Noir“ kann empfohlen werden, auch wenn er direkt am Webstuhl neben dem Original entstanden ist.
Ein Blick in die Zukunft sei an dieser Stelle gestattet: Rasch emanzipierte sich der Autor von seinem Vorbild. Die Logan-McRae-Serie fand ihr Publikum und wird bis heute regelmäßig fortgesetzt. Dabei hat MacBride seinen eigenen Weg gefunden. Die Routinen des Polizeialltags wichen mehr und mehr dem alltäglichen Irrsinn. Immer abgedrehter wurden die Figuren. MacBride wich vom Konzept des zentralen Falls ab und ließ seine Romane immer episodischer ablaufen. Im Finale werden die Fäden zusammengefasst. McRae ist wesentlich umgänglicher geworden, und seine Verletzung findet kaum mehr Erwähnung. Obwohl Krimi-Puristen murren, kann diesen Romanen weder Spannung noch Unterhaltungswert abgesprochen werden: Logan McRae hat sich freigeschwommen, und wie es aussieht, wird er den Kopf noch eine ganze Weile über den Wasser von Aberdeen & Co. halten können!
Autor
Stuart MacBride wurde am 27. Februar 1969 im schottischen Dumbarton geboren. Die Familie zog wenig später nach Aberdeen um, wo Stuart aufwuchs und zur Schule ging. Studiert hat er an der University in Edinburgh, die er indes verließ, um sich in verschiedenen Jobs (Designer, Schauspieler, Sprecher usw.) zu versuchen. Nach seiner Heirat begann MacBride Websites zu erstellen, stieg bis zum Webmanager auf, stieg in die Programmierung ein und betätigte sich in weiteren Bereichen der Neuen Medien.
Stuart MacBride lebt heute wieder in Aberdeen. Über Leben und Werk informiert er auf seiner Website, die er um einen Autorenblog sowie eigene Kurzgeschichten erweitert hat.
Taschenbuch: 544 Seiten
Originaltitel: Cold Granite (London : HarperCollins UK 2005)
Deutsche Erstausgabe: Oktober 2006 (Wilhelm Goldmann Verlag/TB Nr. 46165)
Übersetzung: Andreas Jäger
eBook: 1310 KB
ISBN-13: 978-3-641-12238-6
http://www.randomhouse.de/goldmann
Der Autor vergibt: 



W. J. Stuart – Alarm im Weltall

W. J. Stuart – Alarm im Weltall weiterlesen
Connelly, Michael – Vergessene Stimmen
Nach drei Jahren Pension nimmt Hieronymus „Harry“ Bosch wieder den Dienst für das Los Angeles Police Department auf. Nachdem sich seine ehemalige Partnerin Kizmin Rider eindringlich für ihn eingesetzt hatte, holte ihn der neue Polizeichef zurück. Bosch und Rider arbeiten nunmehr für „Offen-Ungelöst“, eine Unterabteilung der Mordkommission, die sich mit ungelösten Kapitalverbrechen der Vergangenheit beschäftigt. 8000 Mordfälle blieben seit 1960 im Großraum Los Angeles ungesühnt – eine Zahl, die Bosch tatendurstig zu senken gedenkt.
Sein erster Fall scheint einfach: 1988 wurde die 16-jährige Rebecca Lost erschossen in der Nähe ihres Elternhauses gefunden. Die Tatwaffe lag neben der Leiche; der Hahn hatte ein Stückchen Menschenhaut abgerissen, die möglicherweise dem Mörder gehörte, was mit den zeitgenössischen Untersuchungsmethoden indes nicht hatte geklärt werden können. Seither hat die Kriminalistik vor allem im Bereich der Identifikation per DNS gewaltige Fortschritte gemacht. Die konservierte Probe wurde neu untersucht, die Ergebnisse durch neue Datenbänke gejagt. Ein Name wurde ausgespuckt: Der Hautfetzen gehört Roland Mackey, einem kleinkriminellen Drogenabhängigen mit reicher Knasterfahrung, die indes Gewalt bisher nicht einschloss.
Bosch hat kein gutes Gefühl; nach seiner Erfahrung passt Mackey nicht ins Täterprofil. Stattdessen lässt die Ermittlung einen monströsen Fall von „High Jingo“ zu Tage treten: eine Verschwörung krimineller Polizisten in hohen Rängen, unter denen sich ausgerechnet Chief Deputy Iverson, Boschs alter Intimfeind, befindet. Als der längst begraben geglaubte Lost-Fall in gesamter Breite aufgerollt wird, reagiert man ‚oben‘ erst nervös und beginnt dann, die ganze Macht des Departments gegen Bosch aufzuwenden …
Wird ein Mordfall nicht binnen möglichst weniger Tage gelöst, beginnen die Spuren sich abzukühlen, die Ermittlungen geraten in Gefahr abzuirren und müssen schlimmstenfalls eingestellt werden: Der Fall ist „kalt“ geworden, die Beweismittel verschwinden in einer großen Kiste und verstauben in einem Lager, wo in Sachen Gerechtigkeit die Zeit buchstäblich stehen bleibt. Die Polizei hasst diese Fälle, denn nehmen sie an Zahl allzu stark zu, erregen sie die Aufmerksamkeit nicht unbedingt wohlmeinender Kritiker.
In seinem neuen Fall öffnet nun ausgerechnet Harry Bosch eine dieser „kalten“ Zeitkapseln. Wie sich herausstellt, ist dieser Temperaturangabe keineswegs zu trauen: Ein Mord beendet zwar das Leben eines Menschen, doch sind da die Familie, Freunde, Kollegen. In Fällen gewaltsamen Todes konservieren die Hinterbliebenen Empfindungen wie Entsetzen, Trauer und Zorn perfekt unter einer dünnen Schicht seelischer Asche. „Vergessene Stimmen“ schildert nicht nur die Geschichte einer kriminalistischen Ermittlung, sondern thematisiert auch die Folgen einer Tragödie, die eben nicht vergessen wird: Die Toten sprechen mit den Stimmen derjenigen, die sie zurücklassen.
Zuverlässig verschmilzt Michael Connelly die beiden Komponenten zu einem rasanten Thriller mit Tiefgang. Nachdem der Autor zuletzt mit seinem Helden experimentierte, indem er u. a. die Erzählperspektive wechselte (s. u.), kehrt er zur bewährten Form zurück. „High Jingo“ heißt ein Großkapitel des vorliegenden Romans. Dies ist Polizeijargon für ein Komplott in der Führungsspitze: Hochrangige Beamte missbrauchen ihre beträchtlichen Kompetenzen, um eigene Verbrechen oder kriminelle Taten politischer Verbündeter zu decken.
Ermittlungen in diese Richtung sind für einen Detective wie Bosch, der recht weit unten in der Hierarchie steht, verständlicherweise eine brandgefährliche Sache. Korrupte Polizisten müssen besonders harte Strafe gewärtigen, was sie antreibt, bis zum Äußersten zu gehen, wenn sie aufzufliegen drohen. Verfügen sie gleichzeitig über entsprechende Macht, brechen für den Ermittler harte Zeiten an. Harry Bosch ist notgedrungen ein „High Jingo“-Experte. Schon mehrfach hat er sich den Zorn krimineller Vorgesetzter zugezogen, waren Karriere und sogar Leben in Gefahr. „High Jingo“ war mit ein Grund für Boschs Kündigung.
In gewisser Hinsicht wiederholt sich die Geschichte also. Trifft dies auch auf Connellys Bosch-Serie zu, die immerhin in die elfte Runde geht? Glücklicherweise nein, denn die Zeit ist nicht stehen geblieben. Der Kunstgriff, Bosch für einige Jahre aus dem Polizeidienst zu nehmen, gestattet die Konfrontation des Helden mit einem System, das sich entwickelt hat. Das „neue“ LAPD muss Harry Bosch – zusammen mit dem Leser – erst kennen lernen; geschickt baut Connelly einige Szenen in die Handlung ein, die den Detective merken lassen, dass er Rost angesetzt hat.
Dennoch ist Harry Bosch definitiv zurück – nicht nur als zentrale Figur einer der besten Serien des modernen angelsächsischen Kriminalromans, sondern vor allem als Cop mit Dienstmarke und –waffe. Drei Jahre bzw. zwei Romanlängen war Bosch „draußen“; zermürbt von polizeiinternen Querelen und ausgebrannt von zu viel hautnah miterlebter alltäglicher Gewalt. Doch rasch wurde ihm klar, dass er einen Fehler begangen hatte. Zwar ging er als Privatdetektiv weiterhin auf Mörderfang, aber er vermisste die Vorrechte und Möglichkeiten, die ihm der Polizeidienst sicherte. Ohne blieb er eingeschränkt und angreifbar – ein zahnloser Tiger, dem mehr als genug Zeit blieb, sich seinem komplizierten Privatleben zu widmen.
Der Harry Bosch dieser Phase berichtete in der „Ich“-Form über seine Erlebnisse. So erhielten die Leser auch einen tieferen Einblick in das Seelenleben dieser Figur, was ihr nicht zwangsläufig gut bekam, weil darüber verloren ging, was die eigentliche Attraktivität der Harry-Bosch-Reihe ausmacht: die Verzahnung zwischen Polizeiarbeit und aktuellem Tagesgeschehen, wobei ein Mordfall als roter Faden dient, der tief in gesellschaftlichen und menschlichen Abgründen ausläuft.
Auch in der Welt des Hieronymus Bosch heilt die Zeit manche Wunde. Ein neuer Besen kehrt im LAPD, und für Bosch, den Ermittler mit eindrucksvoller Erfolgsquote, gibt es eine ideale Aufgabe – er versucht sich an Fällen, die nie geklärt werden konnten; ein angenehmer Nebeneffekt, so denkt der Polizeichef, ist die Tatsache, dass Bosch bei diesen Ermittlungen niemandem auf die Füße treten kann.
Womit er sich natürlich getäuscht hat, was er nach seinem einleitenden Vortrag selbst hätte wissen müssen, hat er doch selbst betont, dass die Stimmen der Toten nicht überhört werden können. Bosch nimmt ihn beim Wort, gräbt gewohnt tief – und fördert zu Tage, was mancher Zeitgenosse buchstäblich begraben glaubte und gern weiterhin begraben sähe. So beginnt der alte „High Jingo“-Tanz erneut, den Bosch mindestens ebenso liebt wie die Polizeiarbeit: der Kampf mit dem Apparat bzw. mit denen, die das System korrumpieren und unterminieren.
Die Randfiguren erleben neuerlich einen Wechsel. Bosch-Kumpel Edgar, der sich ihm in den Jahren als Privatdetektiv eng angeschlossen hatte, rückt in den Hintergrund. Kiz Rider, die weiblich, schwarz und lesbisch und auf diese Weise gleich dreifach diskriminierenden Attacken ausgesetzt ist, steht Bosch dagegen wieder zur Seite (soweit dies möglich ist; Bosch wird nie wirklich ein Teamspieler sein). Dieser Aspekt ist deshalb von Bedeutung, weil es in „Vergessene Stimmen“ auch um das hässliche Thema Rassismus geht. Bosch gerät tief in den Sumpf faschistoider „Kämpfer für ein weißes Amerika“, die in ihrer bornierten Bösartigkeit vor keinem feigen Anschlag auf alle, die nicht „arisch“ sind wie sie, zurückschrecken.
Viel Arbeit also für Harry Bosch. Nur halbwegs spöttisch nennt er sich einen „Missionar“ und „Kreuzritter“. In gewisser Weise ist er das wirklich. Dass er in dieser Rolle nicht lächerlich wirkt, verdankt er seiner Aufrichtigkeit, die verknüpft ist mit persönlichen Schwächen. Nach vielen Jahren ist in Bosch immer noch der Soldat, der voller Angst aber entschlossen in den Erdhöhlen des Vietcong um sein Leben kämpfte. Er wird es hoffentlich noch weitere Jahre bleiben.
Michael Connelly wurde 1956 in Philadelphia geboren. Der „Entdeckung“ der Bücher von Raymond Chandler verdankte der Journalismus-Student der University of Florida den Entschluss, sich selbst als Schriftsteller zu versuchen. Zunächst arbeitete Connelly nach seinem Abschluss 1980 für diverse Zeitungen in Florida. Er profilierte sich als Polizeireporter. Seine Arbeit gefiel und fiel auf. (2006 erschien eine Auswahl in Buchform unter dem Titel „Crime Beat. A Decade of Covering Cops and Killers“ – ein Werk, das übersetzt hoffentlich ebenfalls seinen Weg nach Deutschland findet.) Nach einigen Jahren heuerte die |Los Angeles Times|, eines der größten Blätter des Landes, Connelly an.
Nach drei Jahren in Los Angeles verfasste Connelly „The Black Echo“ (dt. [„Schwarzes Echo“), 958 den ersten Harry-Bosch-Roman, der teilweise auf Fakten beruht. Der Neuling gewann den „Edgar Award“ der „Mystery Writers of America“ und hatte es geschafft.
Michael Connelly arbeitet auch für das Fernsehen, hier u. a. als Mitschöpfer, Drehbuchautor und Berater der kurzlebigen Cybercrime-Serie „Level 9“ (2000). Mit seiner Familie lebt der Schriftsteller in Florida. Über das Connellyversum informiert stets aktuell die Website http://www.michaelconnelly.com.
Bill Curtsinger – Unter Wasser

Bill Curtsinger – Unter Wasser weiterlesen