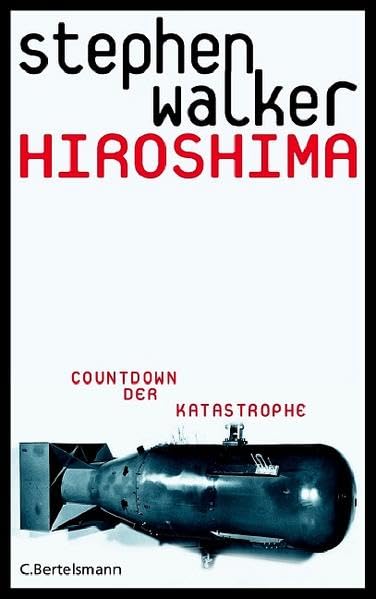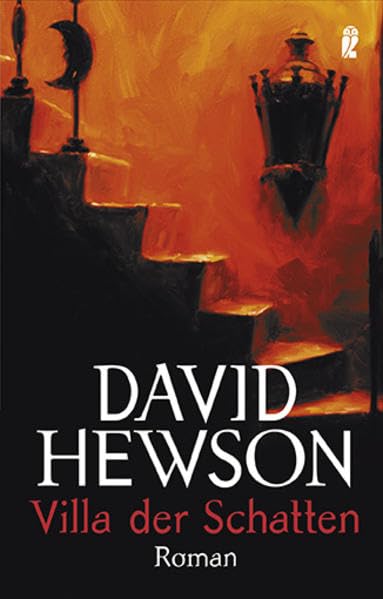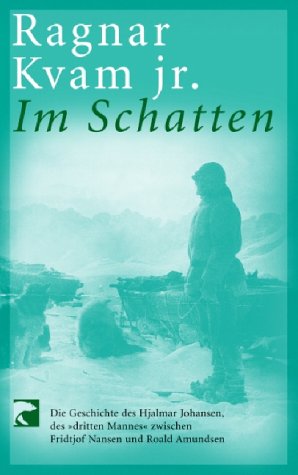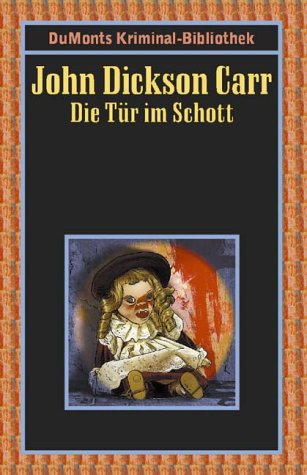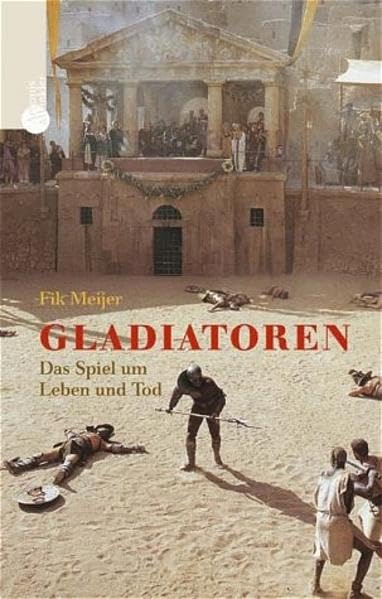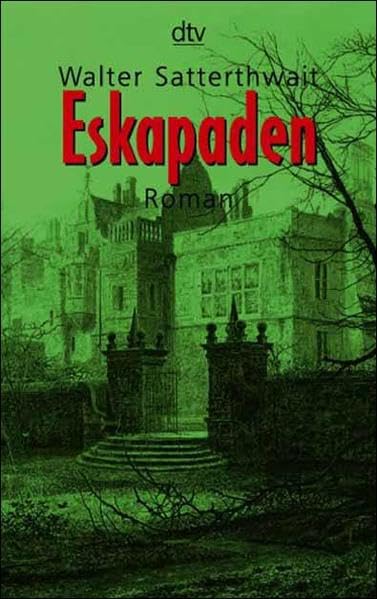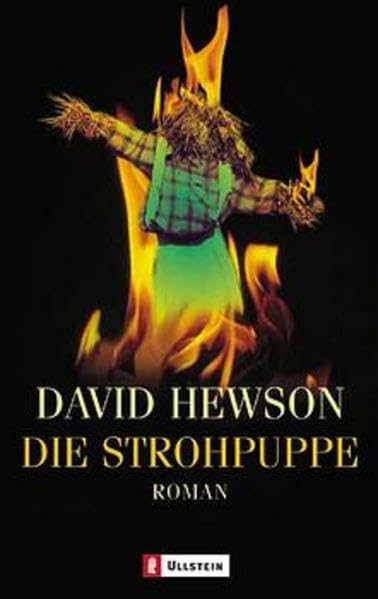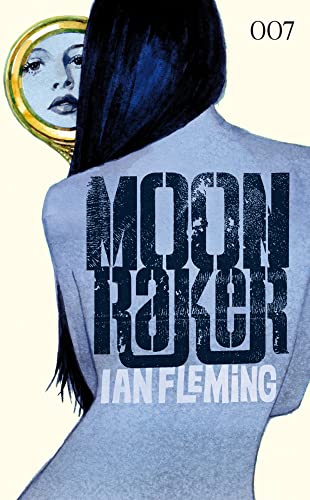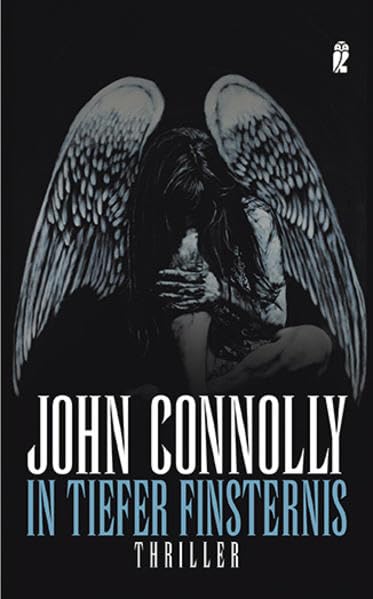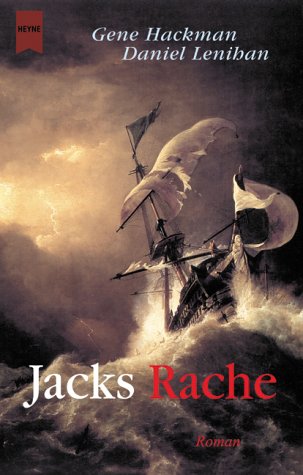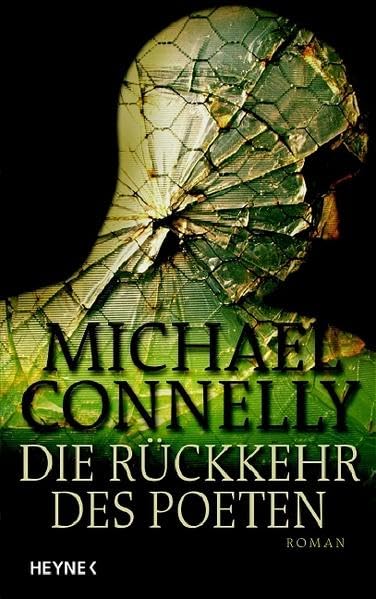6. August 1945, 9.15 Uhr Guam-Kriegszeit: ein weiterer historischer Moment in einem an denkwürdigen Daten reichen Jahr. Doch dies ist kein Augenblick, der zum freudigen Rückblick Anlass gibt, denn er markiert den ersten militärischen Einsatz der Atombombe und die Vernichtung der japanischen Stadt Hiroshima und ihrer Einwohner – nach Stephen Walker, dem Verfasser des hier vorgestellten Sachbuchs, ein Drama in vier Akten.
Der erste Akt schildert eine Generalprobe der besonderen Art: Die Bombe auf Hiroshima war keineswegs die erste ihrer Art. Drei Wochen zuvor war jenes Licht, das heller und heißer als die Sonne strahlte, in einem öden Wüstenstrich in New Mexico aufgeflammt. Zu diesem Zeitpunkt war weder klar, ob die Atombombe funktionieren noch welche Folgen dies haben würde. Zwei Milliarden Dollar waren in die Entwicklung geflossen, eine ganze Legion der klügsten Naturwissenschaftler dieser Welt hatte sich jahrelang in das Problem verbissen. Die Bombe zeigte sich als störrisches Instrument, das endlose Pannenserien produzierte. Zudem warnten Fachleute, dass eine atomare Explosion die Atmosphäre der Erde in Brand setzen und so das irdische Leben auslöschen könne. Aber gezündet wurde trotzdem, das Experiment war schauerlich erfolgreich – und die Entscheidung für die Aufführung des zweiten Akts gefallen.
In der zweiten Julihälfte widmet sich ein Team von Spezialisten und eigens ausgebildeten Piloten dem Problem, die Atombombe als Waffe einzusetzen, ohne dabei selbst in Stücke gerissen zu werden. Walker beschreibt nervenaufreibende Wochen der Vorbereitung in der Einsatzzentrale des 509. Geschwaders auf einer Insel irgendwo im Pazifik, während die Japaner verzweifelt auf die Möglichkeit einer ehrenvollen Kapitulation hoffen, die ihnen weder die US-Amerikaner noch deren sowjetische Verbündete aus taktischen Gründen zugestehen wollen: Noch während der II. Weltkrieg im asiatischen Raum gekämpft wird, werden die politischen Weichen für eine Ära gestellt, in der sich USA und UdSSR als Gegner gegenüberstehen. Der Besitz einer Atomwaffe, die ihre Effizienz unter Beweis gestellt hat, kann dabei von entscheidender Bedeutung sein.
Der dritte Akt versucht die letzten Stunden vor dem Flug des Bombers „Enola Gay“ mit seiner monströsen Fracht in Worte zu fassen. Als Ziel des „Einsatzes“ haben die Amerikaner Japans siebtgrößte Stadt Hiroshima gewählt, die noch unzerstört geblieben ist und deren spektakuläre Vernichtung die Widerstandskraft des Feindes brechen soll. Walker lässt Einwohner Hiroshimas und Soldaten zu Wort kommen, während er schildert, wie sich die „Enola Gay“ der ahnungslosen Stadt nähert und die Bombe schließlich abwirft.
Akt 4 beschreibt das, was niemand sich vorstellen konnte oder wollte: die ersten 24 Stunden nach der Explosion. Mit bedrückender Eindringlichkeit beschwört Walker die Verheerungen, welche die Detonation mit Feuer und Druck auslöst, während das eigentliche Grauen erst Stunden später offenbar wird: Wer in Hiroshima überlebt hat, fällt nun der radioaktiven Strahlung zum Opfer. Zur selben Zeit ist man in Washington erleichtert und erfreut: Der atomare Feldzug ist wie geplant verlaufen und gewonnen. Über die Konsequenzen dieses Geschehens machen sich die Verantwortlichen keine besonderen Gedanken. Zwei Wochen später fällt die Atombombe auf Nagasaki.
In seinem Epilog liefert Walker eine Vorschau auf die Welt unter der Atombombe. Die Fronten zwischen Befürwortern und –gegnern vertiefen sich; viele von denen, die in New Mexiko die Entwicklung vorantrieben, bereuen es bitter. Weil das Wissen um den Bau der Bombe zudem von einem Spion umgehend nach Moskau gemeldet wurde, kann die gefürchtete und bald verhasste Sowjetunion ihre eigene atomare „Verteidigung“ errichten. Aber schon haben in den US-Labors die Arbeiten an der Wasserstoffbombe begonnen …
„Hiroshima“ klingt mit einer langen Reihe von Anmerkungen zum Text, einem Quellenverzeichnis plus Bibliografie, einem Personen-, Orts- und Sachregister sowie einer Danksagung und dem Abbildungsnachweis aus.
Auf drei Wochen im Sommer des Jahres 1945 verdichtet Verfasser Stephen Walker seine bemerkenswerte Chronik eines ebenso denkwürdigen wie traurigen Ereignisses. Diese Zeitspanne beinhaltet nach seiner Meinung die relevanten Aspekte der Atombomben-Story. Walker legt seine Darstellung sehr „filmisch“ an; er wechselt die Perspektive, springt von Ort zu Ort, stellt uns die handelnden Personen in ihren Worten und Taten vor, während der „Countdown der Katastrophe“ längst begonnen hat. Der Leser springt quasi auf einen bereits fahrenden Informationszug auf. Dies birgt die Gefahr, dass vor allem dem historischen Laien grundsätzliche Vorkenntnisse unbekannt bleiben. Doch Walker beherrscht die Kunst, wichtige Infos in seinen Bericht einfließen zu lassen, ohne dass es die Chronologie stört. Das Ergebnis überzeugt: „Hiroshima“ ist ein rasant zu lesendes Buch, dessen Erzählfluss das Tempo widerspiegelt, mit dem 1945 die Atombombe zum Einsatz kam.
„Hiroshima“ erzählt diese Geschichte als durchaus nicht vollständiges historisches Mosaik. Zahlreiche Ereignisse lassen sich sechs Jahrzehnte später nur noch annähernd rekonstruieren. Umrisse sind fassbar, Details, Momentaufnahmen, Anekdoten vorhanden, bloß: Lässt es sich verantworten, das Vorhandene zu einer „ultimativen“ Geschichte zu verknüpfen? Stephen Walker zieht sich elegant aus der Affäre, indem er nur selten und dann offen spekuliert, sondern sich lieber auf die Fakten stützt. Gleichzeitig lässt er die Zeitzeugen sprechen. Was sie sagen, kann und ist sicherlich recht subjektiv. Andererseits ist es unmittelbar und zieht den Zuhörer oder Leser in den Bann.
Ein weiteres Verdienst Walkers: Er verzichtet darauf, Partei zu ergreifen. Daraus entwickelt sich ein wahrer Eiertanz, denn Kandidaten für die Rolle/n des Bösewichts gäbe es genug – gleichgültig, ob japanischer, sowjetischer oder US-amerikanischer Herkunft. Stattdessen versucht Walker Situation & Stimmung im Sommer 1945 zu verdeutlichen: Die den Einsatz der Bombe fordern, glauben wirklich an die Notwendigkeit, eine Stadt (bzw. zwei Städte, denn nach Hiroshima starb Nagasaki den atomaren Tod) mit Mann & Maus vom Erdboden zu tilgen, um damit einen opferreichen Bodenkrieg Mann gegen Mann zu vermeiden, während die Japaner das Grauen durch ihr Hinauszögern der definitiv unabwendbaren Kapitulation selbst mit heraufbeschwören.
Haben die Atombomben auf Japan den II. Weltkrieg beendet oder waren sie längst überflüssig, ein Menschen verachtendes Experiment jener gar, die ausprobieren wollten, was ihr neues Spielzeug leisten konnte? Diese Fragen werden noch heute erbittert diskutiert. „Hiroshima“ kann keine endgültige Antwort geben aber womöglich gibt es die auch gar nicht.
Über Leben und Werk von Stephen Walker gibt es sogar im Internet offenbar nur, was auch der Klappentext zu „Hiroshima“ nachbetet. Demnach hat Walker Geschichte in Harvard studiert und drehte später Dokumentarfilme für die BBC – so über die Schlacht an der Somme im November 1916, über die Besatzungszeit in Frankreich, über die Geschichte des Terrorismus sowie nun über das Ende Hiroshimas. Für seine Arbeit habe er diverse Preise erhalten, darunter die „Goldene Rose von Montreux“ und den Preis der „British Academy of Film and Television Arts“. (Bei näherer Betrachtung war es allerdings nicht Walker, der 2003 die „Rose“ gewann, sondern die Pseudo-Realityshow „Faking It“, für die er als einer von zahlreichen Regisseuren drehte, während er in den Annalen der „British Academy of Film and Television“ weder als Gewinner noch als für einen Preis Nominierter erscheint; dies jedoch nur am Rande & als Hinweis darauf was geschehen kann, wenn man solche Angaben nachprüft …) Darüber hinaus sei er Drehbuchautor und für eines seiner Bücher mit einem „Best Drama Award“ für die „Writer’s Guild“ ausgezeichnet worden. (Ich konnte beim besten Willen keine Institution dieses Namens recherchieren … nur eine „Writer’s Guild of America“, der jedoch kein Stephen Walker bekannt zu sein scheint …)