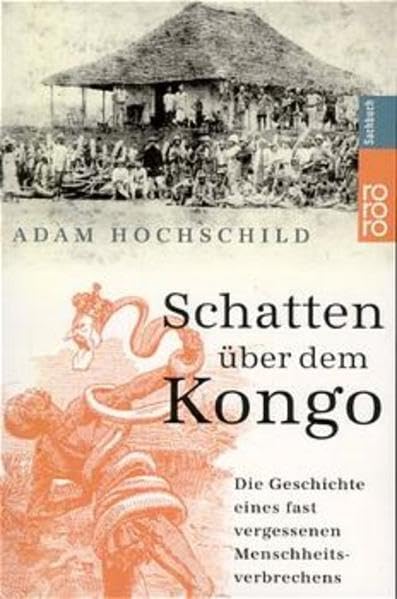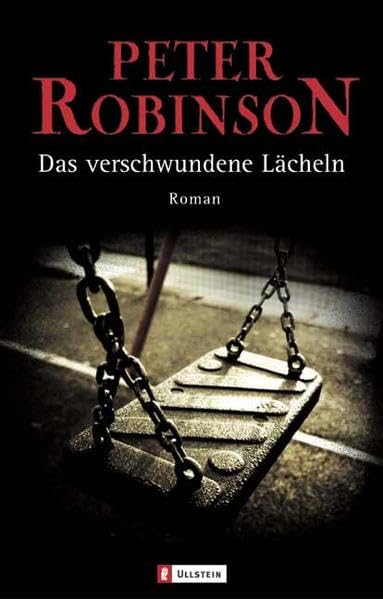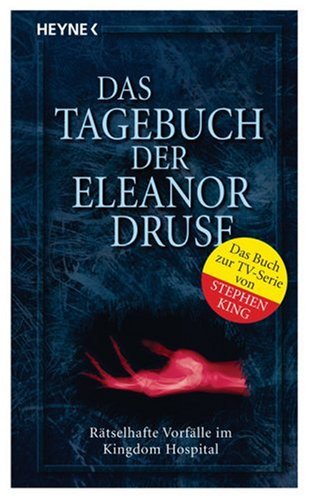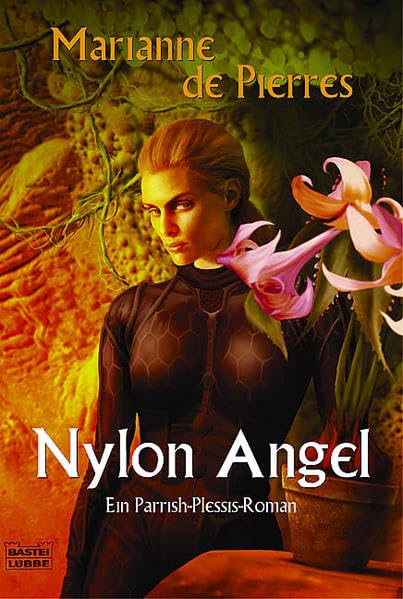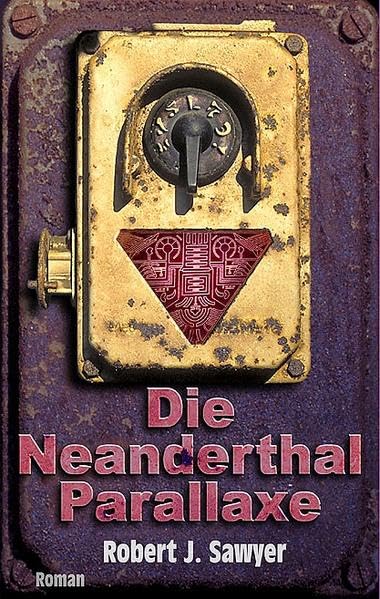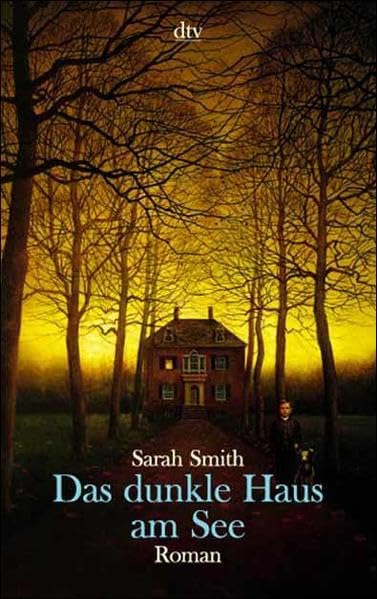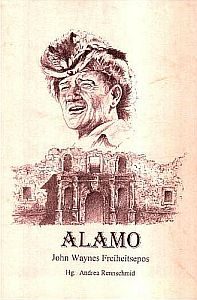Kleines Rohr mit großer Wirkung
Früher war zwar keineswegs alles besser. Trotzdem ging es in jenen Momenten, in denen Weltgeschichte geschrieben wurde, ein wenig geruhsamer zu. In einer zwar kalten aber klaren Novembernacht des Jahres 1609 war es keine atomspaltende Hightech-Höllenmaschine, die das Universum aus den Angeln hob, sondern eine scheinbar simple Röhre aus Metall, in der zwei Stückchen Glas steckten. Nachdem man diese durch sorgfältiges Schleifen in Linsenform gebracht und in einem gewissen Abstand voneinander innerhalb besagter Röhre befestigt hatte, war ein Instrument entstanden, für das sich alsbald die Bezeichnung „Teleskop“ einbürgerte. „Fern-Sehen” im buchstäblichen Sinne war es, das dem Menschen plötzlich möglich wurde – der Blick auf weit Entferntes, das bisher verborgen und Objekt der Spekulation und des Rätselratens geblieben war.
Dabei galt es zu unterscheiden zwischen dem ‚gewöhnlichen‘ Fernrohr und dem Teleskop. Während ersteres in der Seefahrt oder im Krieg als nützliches Werkzeug sogleich begeistert angenommen und eingesetzt wurde, erschloss sich der Sinn des Teleskops lange Zeit nur einem kleinen Kreis wissenschaftlich interessierter und ausgebildeter Spezialisten. So stark vergrößerten nämlich schon die ersten Teleskope, dass sie für den einfachen Blick in die irdische Nachbarschaft eigentlich unbrauchbar waren. Da der Mensch von Natur neugierig bzw. an seiner Umwelt interessiert ist, war es nur eine Frage der Zeit, bis ein Forscher auf den Gedanken kam, sein Teleskop gen Himmel zu richten.
Auf einen Schlag wurde alles anders. Seit vielen Jahrtausenden beschäftigt sich der Mensch mit den seltsamen Lichtern, die er besonders des Nachts hoch droben am Firmament stehen sieht. Weil er schon immer Ungewissheit hasst und das Spekulieren liebt, bemüht er sich sehr jeher, den Himmel in sein Weltbild zu integrieren. Im christlichen Abendland der frühen Neuzeit war man zufrieden mit dem, was man schon seit der Antike ‚wusste‘: Das Universum war die von Gott als Höhepunkt der Schöpfung geschaffene Erde im und als Zentrum, umkreist von der Sonne, dem Mond und vielen Sternen, von denen man nur wusste, dass sie offenbar klein, kalt und weit entfernt ihre Bahnen zogen und des Nachts dem Reisenden zur Orientierung dienen konnten. So hatte der HERR es eingerichtet, so stand es in der Bibel vermerkt. Kirche, Könige & wer sonst das Sagen hatte auf Erden, war damit zufrieden und achtete darauf, dass diese Welt geozentrisch blieb. Dem Skeptiker musste genügen, dass sich das Establishment inzwischen immerhin dazu bequemt hatte, die Kugelgestalt der Erde als Tatsache anzunehmen.
Jenseits beruhigend überschaubarer Grenzen
Buchstäblich über Nacht war es vorbei mit dem Frieden. Zwar hatte Galileo Galilei (1564-1642), Naturwissenschaftler in der italienischen Universitätsstadt Padua, das Teleskop nicht erfunden. Auch war er nicht der Erste, der damit den Himmel betrachtete. Aber er gehörte zu jenen raren Menschen, denen es in die Wiege gelegt wird, Grenzen zu sprengen und hinter die Kulissen zu blicken. In der eingangs erwähnten Novembernacht schaute deshalb ein Mensch in die Sterne, der nicht nur das Teleskop unter Berücksichtigung bisher wenig bekannter physikalischer Prinzipien entscheidend verbessert hatte, der nicht nur sah und staunte, sondern begriff, was sich in unglaublicher Ferne abspielte. Er war der richtige Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit. In kürzester Zeit entdeckte, erkannte und beschrieb Galilei neue und fremde Welten, schied Planeten von Sternen, identifizierte Monde und begriff die Milchstraße als Ansammlung unendlich vieler Sterne.
Immer neue Sterne fanden Galilei und jene, die es ihm in der nächtlichen Himmelsbeobachtung nachtaten. Das alte Weltbild stürzte ein, als die Erde als Planet und die Sonne als Stern unter Sternen erkannt wurde. Die Einmaligkeit des geozentrischen Sonnensystems konnte nicht länger gehalten werden. Die neuen Erkenntnisse ließen sich nicht in Einklang mit dem biblischen Weltbild bringen. Das war fatal für die Forscher einer Zeit, in der Naturwissenschaftler immer auch Philosophen waren, die ihr Wissen als Teil der von Gott gegebenen Weltordnung betrachteten. Auch Galilei war kein Rebell im Namen der Wissenschaft. Lange Zeit bemühte er sich, seine Beobachtungen ins Gebäude der traditionellen Lehre zu integrieren. Allerdings war dies irgendwann einfach nicht mehr möglich: Was Galilei sah, sprach eine andere Sprache als das, was er zu sehen erwartete und auch sehen sollte. Dies war endgültig der Startschuss zur wissenschaftlichen Revolution, in der er wider Willen eine so prominente Rolle einnehmen würde.
Wissen ist Macht. Kein Wunder, dass es die Diktatoren und selbst ernannten Führer der Geschichte stets sorgfältig unter Verschluss ge- und dem Volk vorenthalten haben. Das Teleskop hat das politische und geistliche Establishment jedoch schlicht überrascht. Es schien nur eine Spielerei zu sein, aber es war tatsächlich das Auge Gottes: Der Mensch konnte ins All blicken, begriff dessen unendliche Weite und wurde sich der eigenen Nichtigkeit bewusst. Vorbei war es mit der eigenen Größe; nicht einmal im eigenen Planetensystem war man mehr Herr im Haus, denn das Teleskop brachte es bald an den Tag, dass sich die Sonne beileibe nicht um die Erde drehte. Stattdessen war es umgekehrt und der Mensch abermals eine Stufe des universellen Throns hinabgepurzelt.
Zäher Kampf um wahre Erkenntnisse
Diese Revolution verlief bekanntlich nicht friedlich. Galileis Schicksal dokumentiert nur eines von vielen Gefechten in diesem Krieg der Weltanschauungen, den die Wahrheit schließlich für sich entscheiden konnte. Wieder trug das Teleskop seinen Teil dazu bei. Wer Augen hatte zu sehen, konnte sich selbst davon überzeugen, dass die ketzerischen Astronomen in der Tat Recht hatten, während die von ihren Gegnern düster prophezeite Anarchie ausblieb. So trugen sie schließlich den Sieg davon und stiegen sogar in eine eigene Forscher-Elite auf: Der nächtliche Sternengucker an seinem Teleskop wurde zum Idol der Massen, die begierig auf neue Sensationen aus dem nahen und fernen All warteten.
Friedrich Wilhelm Herschel (1738-1822), geboren in Hannover aber schon in jungen Jahren nach England emigriert, erntete die Früchte, die Galilei und andere Pioniere gesät hatten. Ihm gelang eine Bilderbuch-Karriere, er wurde in den Adelsstand erhoben und mit Ehren überhäuft. Das Wissen an sich stand nun im Vordergrund; Streit und Kämpfe fanden höchstens in den eigenen Reihen statt, denn auch Forscher sind nur Menschen, die um des Ruhms, der Eitelkeit und des Geldes willen raufen. Das Fundament für das Haus des astronomischen Wissens aber war gelegt, und unter seinem Dach stand das Teleskop, das in den Jahrhunderten nach Galilei imposante Ausmaße angenommen hatte und entsprechend tiefere Einblicke ermöglichte.
Herschel steht für die nächste Stufe der Himmelsforschung: Neben die Suche nach dem Neuen trat die quantitative Auswertung des inzwischen Bekannten. Herschels systematische, sich über Jahrzehnte hinziehende Kartierung des Sternenhimmels ließ einen Sternenkatalog oder Atlas entstehen, der Ordnung in das galaktische Chaos brachte. Der Mensch konnte den Weltraum zwar noch immer nicht bereisen, aber er verirrte sich nunmehr nicht mehr darin, wenn er ihn von der Erde aus musterte – bis sich herausstellte, dass er nur einen mikroskopisch kleinen Teil des Gesamtgefüges kannte. Aktuelle Schätzungen gehen von einem Universum mit 100 Milliarden Galaxien aus, die ihrerseits aus vielen Milliarden Sternen bestehen, um die wiederum Planeten, Monde u. a. Himmelskörper kreisen.
Rekonstruktion des nur scheinbar Selbstverständlichen
Galilei, Herschel, Isaac Newton und anderen Helden der Forschungsgeschichte setzt Richard Panek, Wissenschaftsjournalist für das „New York Times Magazine“ u. a. Zeitschriften ein Denkmal. Der wahre ‚Held‘ ist allerdings jenes Gebilde aus Metall und gläsernen Linsen (später Spiegeln, Parabol- und Deflektor-Antennen etc.), das den Quantensprung des menschlichen Geistes ermöglichte. Eine „Ode an das Teleskop“ nannte die „Berliner Morgenpost“ Paneks Werk (in der Ausgabe vom 11. Oktober 2001).
Wer meint, Sachbücher über ein recht dröges Thema müssten zwangsläufig trocken und langweilig zu lesen sein, wird hier eindrucksvoll eines Besseren belehrt. Panek weiß genau, wie er sein Publikum ködern muss. Virtuos verquirlt er vorzüglich recherchiertes Wissen mit klug ausgewählten historischen Anekdoten zu einem fabelhaft geschriebenen (und übersetzten) Sachbuch. „Gegen den Frost rieb er [F. W. Herschel] sich mit rohen Zwiebeln ein, während sein Atem am Teleskop und die Tinte im Faß gefror …“: Das waren noch Zeiten! Bemerkenswert ist auch die Geschichte des Teleskop-Veteranen George Ellery Hale, der sich in Zeiten übergroßen Forscherstresses von einer Elfe beraten ließ.
Da ist kein Wort zu viel, wird nie der gefürchtete pädagogische Zeigefinger sichtbar, fehlt völlig die erbauliche Verklärung einsam-entschlossener Heroen der Wissenschaft, mit der hierzulande die lesende Jugend gar zu vieler Jahrzehnte für dumm verkauft wurde. Galilei war eben nicht der Cary Cooper der Forschung, der von der bösen Kirche 12 Uhr mittags in die Kerker der Inquisition geworfen werden sollte. Die geistige Revolution der frühen Neuzeit fand auf einem ganz anderen Niveau statt. Sie zu veranschaulichen ist keine leichte Aufgabe, denn die Prozesse, die dabei abliefen, waren höchst komplex, Aber Panek schafft es mit Leichtigkeit und bereichert das gar nicht so breite Spektrum von Sachbüchern, die man gern liest, weil sie ebenso kompetent wie leicht verständlich – den echten Fachmann erkennt man daran, dass er sich nicht hinter Fachausdrücken & Zitaten verstecken muss – die Welt als Wundertüte der Natur schildern und jene, die wissen wollen, wie sie denn tickt, in ihren Bann ziehen.
Taschenbuch: 197 Seiten
Originaltitel: Seeing and Believing – How the Telescope Opened Our Eyes and Mind to the Heavens (London : Penguin 1998)
Übersetzung: Dieter Zimmer
http://www.dtv.de
Der Autor vergibt: