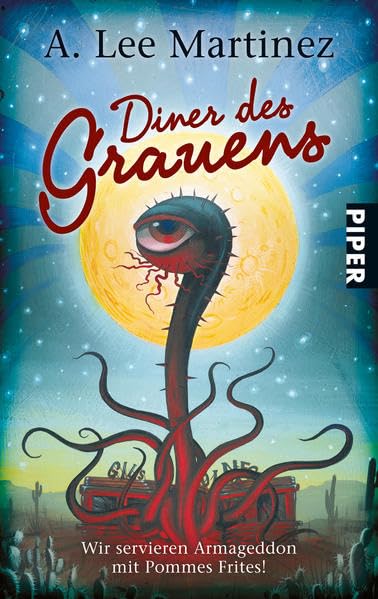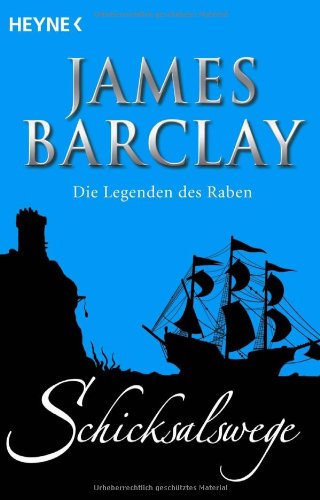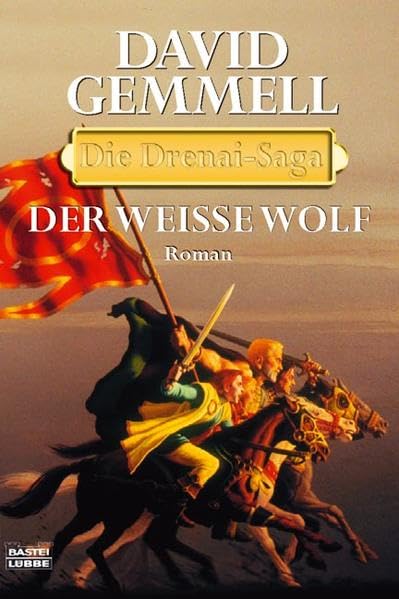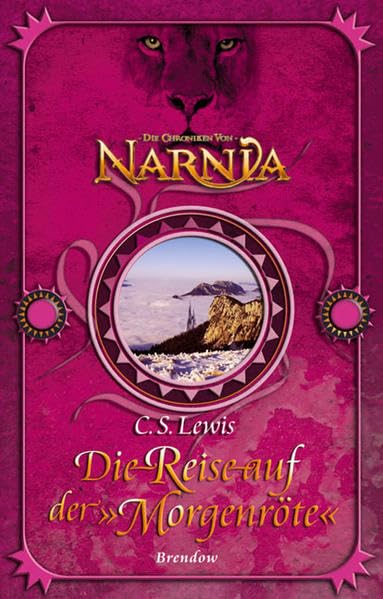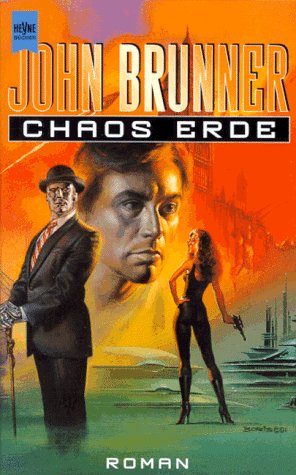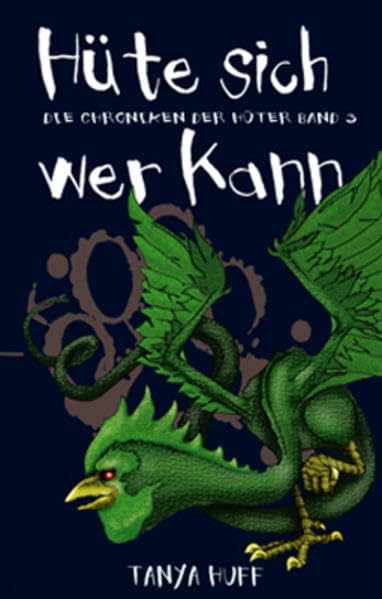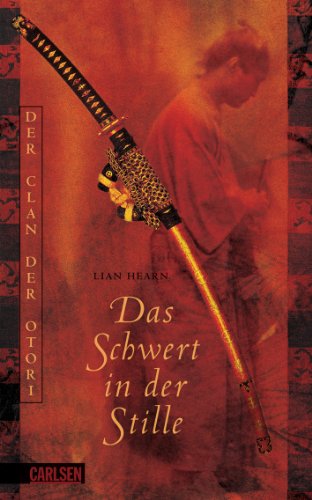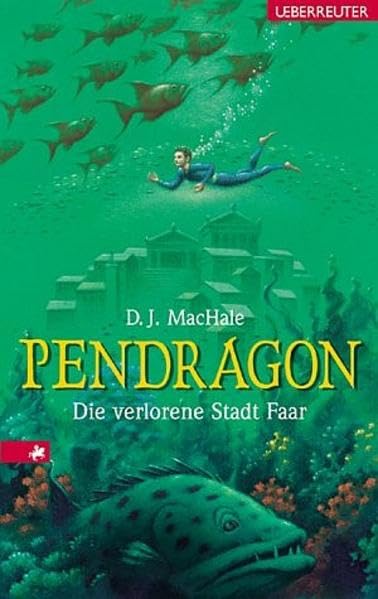_Umtriebiger Nachwuchs …_
… hat das Licht der Bücherwelt erblickt in den Reihen zwerchfellkitzelnder Phantasten: A. Lee Martinez, ein 33-jähriger Bursche aus Texas, verbeugt sich vor der Komikergilde um Asprin, Pratchett, Rankin, Adams und Co. und hat mit „Diner des Grauens“ einen locker-flockigen Horrorspaß aus seiner Feder gewrungen. Ob er die Eminenzen von ihrem Gelächter-Thron stoßen wird, bleibt fraglich, der Unterhaltungswert dieses Debüts ist es nicht:
_Willkommen im |Gil´s all Fright Diner|!_
Zunächst: Man möge dem Klappentext der deutschen Ausgabe nicht allzu großen Wert beimessen, spricht er doch von Earl als dem „coolsten Vampir“ und von Duke als dem „fettesten Werwolf“ aller Zeiten. Nun, Earl wäre darüber sicherlich sehr geschmeichelt. Er würde sich durch die vampirischen Geheimratsecken fahren und sich freuen, dass er einmal nicht als weinerliche, hochneurotische Vampirnervensäge bezeichnet wurde. Duke allerdings würde dem Verfasser via eingeschlagenem Schädel klarmachen, dass sich eine riesenhafte, jähzornige Kampfmaschine mit unmenschlichen Kräften eben ungern als „fettester Werwolf“ bezeichnen lässt.
Besagtes Pärchen jedenfalls schaukelt mit einem rostigen Pickup durch die Wüsten von Amerika, um schließlich im |Gil´s all Fright Diner| abzusteigen. Wie das Schicksal so will, kommt eine Meute Zombies zur gleichen Zeit auf die gleiche Idee, und ein paar beschäftigungsreiche Augenblicke später bekommen die beiden von Bardame Loretta einen Job, gleich nachdem sie diverse Zombieüberreste vor die Tür gefegt hat.
Das Städtchen Rockwood hat nämlich schon seit längerem unter derartigen Heimsuchungen zu leiden, nicht erst, seit Gil, der ursprüngliche Besitzer des Diners, spurlos verschwunden ist. Also greifen Earl und Duke der beleibten Loretta unter die Arme und stellen fest, dass Rockwood ein wahrer Magnet für übernatürliche Unbilden zu sein scheint. Bald schon finden sie den Grund dafür heraus …
_Zwerchfell- und Nervenkitzel in einem._
Wie das immer so ist, mit „Sensationsromanen“ und mit Werken, denen man „den größten Spaß seit Douglas Adams“ attestiert; die heraufbeschworenen Erwartungen bleiben auf der Strecke. So auch beim „Diner des Grauens“. Aber auch wenn das kein „Sensationsroman“ ist, ist es doch ein wunderbar unterhaltsamer Zeitvertreib, bei dem man mal an den Nägeln kaut, sich mal den Bauch hält, und dann plötzlich erschrocken feststellt, dass man schon am Ende angelangt ist.
Es macht einfach Spaß, die beiden Protagonisten bei ihrem skurrilen Abenteuer zu begleiten: Earl ist ein weinerlicher, empfindlicher Feigling, der sich den ganzen Tag mit Duke in den Haaren liegt. Duke hingegen hat für alles, wenn er denn mal spricht, nur staubtrockene Kommentare übrig und legt ansonsten einen äußerst werwölfigen Aktionismus an den Tag. Kompliziert (und hoch amüsant) wird es, als sich Earl in eine Geisterdame verliebt (und diese Peinlichkeit unbedingt vor Duke verbergen möchte), und als Duke sich gegen die Annäherungen einer attraktiven Teenagerin wehren muss, obwohl ihm das Tier im Manne ganz Anderes schmackhaft macht. Als ob sie mit dem Geheimnis um den verschwundenen Gil und seinen Horror-Diner nicht schon genug um die Ohren hätten …
Die Story an sich gießt ganze Kellen an Spott über die Konventionen des Horror-Genres aus: Da beklagt Earl sich bitterlich, dass ihm den ganzen Tag pubertäre Mädels an die Wäsche wollten, weil das die Ausstrahlung von Vampiren nun mal so mit sich bringe, und er leidet unter riesigen Minderwertigkeitskomplexen, da die Medien unerfüllbare Erwartungen an untote Liebhaber stellen. Es gibt Protoplasma-pinkelnde Geisterhunde, einen sturen Magic-Eight-Ball, der sich nur mit Bonanza zu einer Antwort bestechen lässt, Ghouls, die sich Komplimente machen, während sie auf den tödlichen Sonnenaufgang warten, Beschwörungen in pubertärer Silben-Geheimsprache, und dergleichen mehr, das der Leser wohl besser selbst entdecken sollte.
_Wildwasserfahrt im Comicpark._
Die Figuren sind Comic-Figuren mit Leib und Seele. Keine ihrer Anwandlungen hat etwas Natürliches an sich, alles ist überspitzt und überdreht, aber Tiefe besitzen sie trotzdem. Earl und Duke beispielsweise; es gibt eine Geschichte, wie sie sich getroffen haben, warum sie zusammenhalten und wie sie mit ihrem Schicksal allgemein klarkommen. Aber auch die Nebenfiguren aus Rockwood haben, für ein Comic-Universum, glaubwürdige Motive.
Und diese Motive verknüpfen sich überhaupt erst zu der gesamten Story: Durch den Klappentext erwartet man eigentlich eine Ansammlung unsinniger Skurrilitäten, die mit einem losen Handlungsfaden aneinandergeknüpft wurden, aber das ist im „Diner des Grauens“ überhaupt nicht der Fall. Alles hat seinen Grund: Warum der alte Gil aus seinem Diner verschwunden ist, warum plötzlich Zombie-Kühe auftauchen, warum es ausgerechnet einen Vampir und einen Werwolf an diesen Ort verschlägt. All das steigert sich zu einem Showdown, der nicht nur in sich schlüssig ist, sondern auch spannend, und der an seinem Ende keine offenen Fragen hinterlässt.
Pluspunkte gibt es außerdem für Tammy: Die Antagonistin ist eine hübsche Achtzehnjährige, ein typischer Vamp, die jeden Typen genau in die Richtung manipuliert, in die sie ihn haben möchte, obwohl der Verhexte genau weiß, dass er damit in das offene Messer rennt. Standard eigentlich, so sehr, dass man fast schon von archetypisch sprechen könnte, aber Martinez hat die Verführkünste seiner Gegenspielerin derart lebensecht und spürbar in Szene gesetzt, dass der Verfasser dieser Zeilen zugegebenermaßen recht kribblig geworden ist, das eine oder andere Mal …
_Schmackhaftes Desert nach schweren Gängen._
Nein, es bleiben kaum Wünsche offen nach dem Besuch von Gil’s Diner. Natürlich, um Hochliteratur handelt es sich dabei nicht, aber für einen luftigen Snack nach allzu schwerer Kost taugt es allemal. Zwar erreicht Martinez keinesfalls den Ideenreichtum eines Douglas Adams oder eines jungen Terry Pratchett, und auch ist „Diner des Grauens“ nicht so ausgeklügelt und augenzwinkernd wendungsreich wie die Dämonen-Abenteuer von Robert Asprin. Aber für einen Einstand in das Genre hat sich der junge Texaner hervorragend geschlagen.
Und, um den Brückenschlag zur einleitend erwähnten Umtriebigkeit zu vollführen: Martinez ruht sich auf diesen Lorbeeren keineswegs aus. Im August dieses Jahres wird sich „In the Company of Ogres“ zur Aufgabe machen, das Fantasy-Genre zu verhöhnen, „The Nameless Witch“ ist schon fertig verfasst und befindet sich in der Korrekturphase, während sich Agent und Verleger von Martinez schon über „Nessys Castle“ beugen, und über „Automatic Detective“, eine Verballhornung des Noir-Krimis mit „Robotern, Mutanten und anderem coolen Zeug“. Ob Martinez seinen Horizont erweitern wird? Oder ob er in Pratchett’sches Gag-Recycling verfallen wird? Ob er sein Pulver schon verschossen hat, oder ob er gerade mal anfängt, warm zu werden? Keine Ahnung. Seine Chance hat er sich jedenfalls mit dem „Diner des Grauens“ verdient!
http://www.piper.de