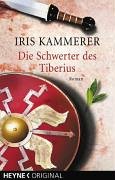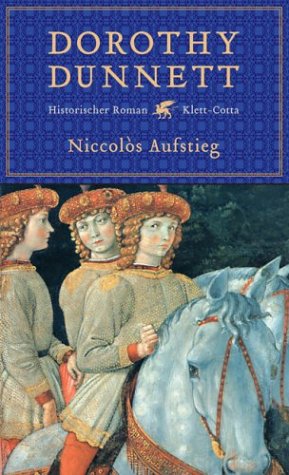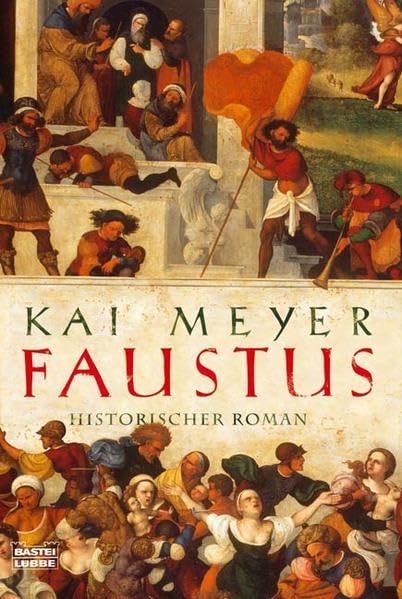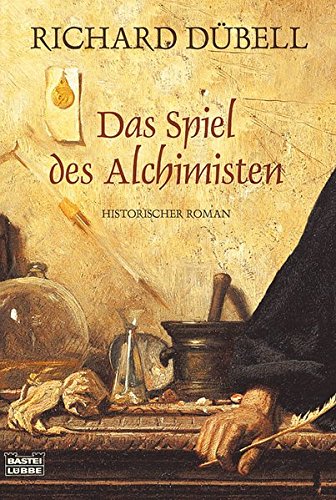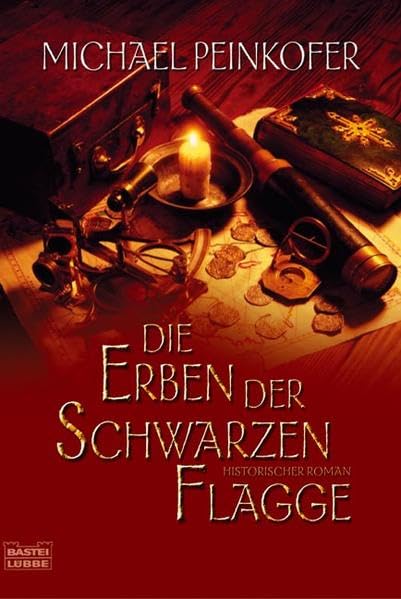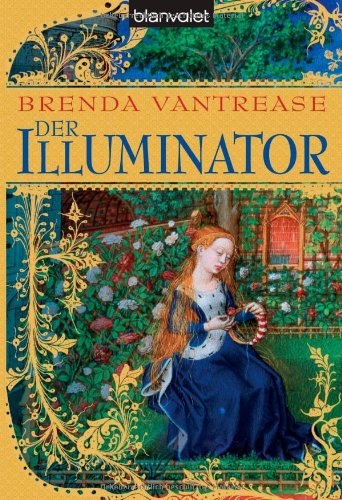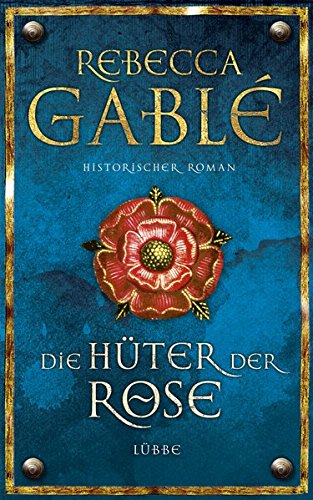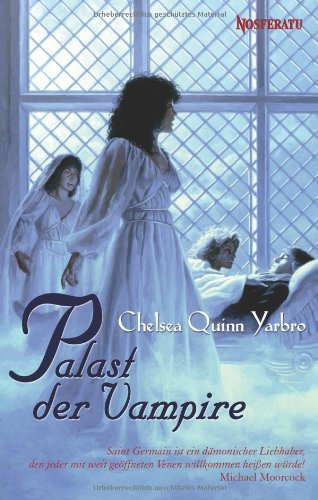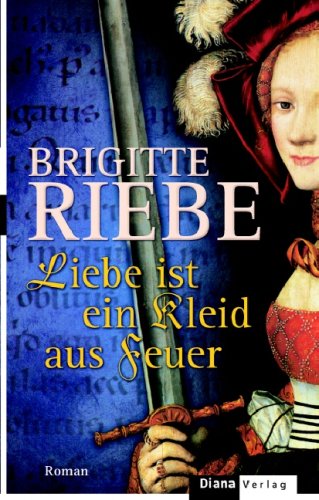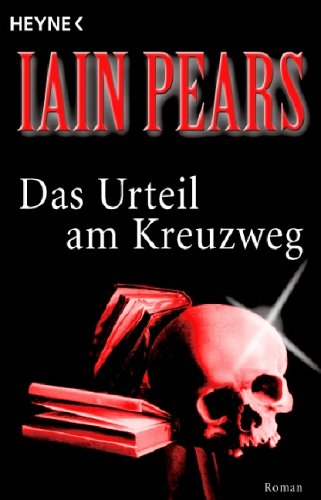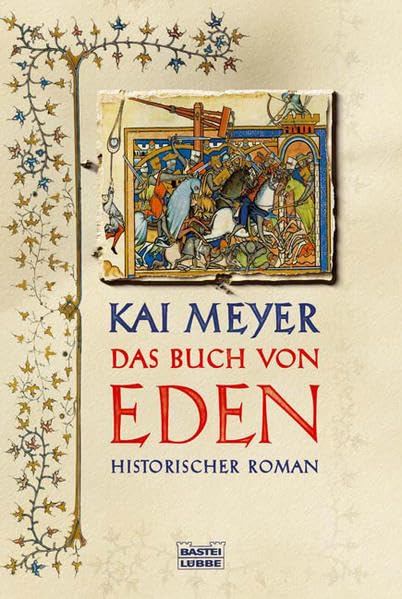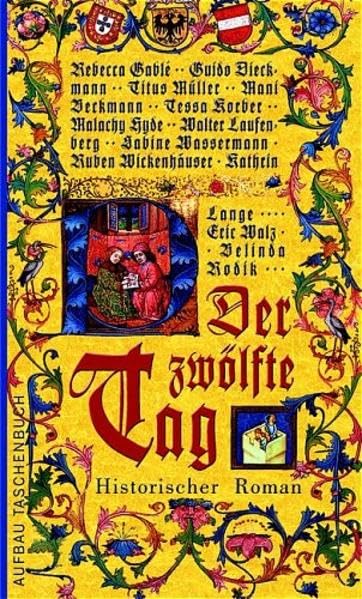Band 1: [„Der Tribun“ 3536
Bei der Schlacht zwischen Römern und Germanen im Teutoburger Wald in der Nähe von Kalkriese im Osnabrücker Umland gehen die Archäologen und Geschichtsforscher derzeit davon aus, dass bis zu 25.000 Menschen allein auf römischer Seite ihr Leben lassen mussten.
Drei ganze Legionen des römischen Senators und Statthalters wurden vernichtet, und die römische Besatzung zog sich nach dieser Niederlage zurück. Cäsar Augustus war bestürzt über diese Niederlage und verlangte umgehende Aufklärung und Stabilisierung der Grenzen nach Germanien. Höchste Priorität hatte auch die Ergreifung des germanischen Offiziers und Verräters Arminius, der in den Hilfstruppen der Legionen diente. Ein Fürstensohn der Cherusker, der sich der römischen Herrschaft unterworfen hatte und perfekt militärisch ausgebildet wurde.
Dieser Arminius einigte mit falschen Versprechen einige wichtige Stämme in Germanien und lockte Varus, der ihm vertraute, mitsamt seinen Legionen in eine tödliche Falle, aus der es kein Entkommen gab.
Augustus war es ein Gräuel und eine Schande, seine Truppen zurückziehen zu müssen und die Gefallenen auf dem Schlachtfeld zu wissen. Er ist nicht gewillt, die Provinz Germanien ihrem Schicksal zu überlassen und beauftragt seinen Oberbefehlshaber damit, den Verräter Arminius zu fangen und dem Volk und Senat von Rom zu übergeben.
_Die Geschichte_
In „Die Schwerter des Tiberius“, dem zweiten Teil der historischen |Tribun|-Trilogie von Iris Kammerer, bilden genau diese theoretischen Pläne des Kaisers die Grundlage des Romans.
„Die Schwerter des Tiberius“ knüpft logisch genau in der Handlung dort an, wo „Der Tribun“ endete. Ein Jahr war der ehemals römische Tribun Gaius Cinna die Geisel eines germanischen Fürsten. Als die Situation sich zuspitzte und Cinna Gefahr lief, Arminius ausgeliefert zu werden, setzten sich seine Bewacher für ihn ein und retteten ihm somit das Leben. In den letzten Monaten der Gefangenschaft wurde Gaius Cinna mehr Freund als Geisel, mehr Lehrer und Verbündeter. Als die Situation zwischen den uneinigen Stämmen eskalierte, nutzte Cinna zusammen mit Sunja, der Tochter des germanischen Fürsten, die Chance und flüchtete zu den weit entfernten Vorposten der römischen Legionen.
Doch nach seiner Rückkehr muss sich Cinna im römischen Heer völlig neu behaupten. Er wurde in seiner Abwesenheit für tot erklärt, sein Vater, der dem Kaiser nicht unbedingt die Treue geschworen hat, starb und hinterließ keinen Erben. Somit konnte Cinna keinen Titel, keinen Besitz und keinen ehrbaren Namen direkt in Anspruch nehmen, da der Besitz seines Vaters nach dessen Tode automatisch auf den Kaiser überging.
Mittellos und ehrlos, zudem noch in den römischen Augen mit einer Barbarin verheiratet, ist er ganz allein auf die Gnade des römischen Oberbefehlshaber Tiberius angewiesen. Tiberius zwingt Cinna, ihm als Unterhändler zu dienen, denn alleine mit seinem Wissen um die Kultur und die Denk- und Lebensweise der Germanen ist dieser dem römischen Heer eine große Hilfe.
_Meine Meinung_
Im zweiten Roman von Iris Kammerer steht der römische Offizier wieder im Mittelpunkt der Handlung und stellt die logische Verbindung zu „Der Tribun“ her. Zweifellos überzeugt „Die Schwerter des Tiberius“ mit seiner auf Fakten beruhenden Erzählung von den Vergeltungsplänen der Römer. Wie auch schon im ersten Teil, muss man Iris Kammerers Gespür für die historische Genauigkeit Respekt schulden. Schauplätze und Regionen, Städte und Kultur, Militär und Leben der damaligen Bevölkerung, egal ob es nun die Römer oder die Germanen sind – all diese Details wurden perfekt in die Handlungsstränge mit aufgenommen und dem Leser verständlich erklärt.
Die Spannung allerdings hat spürbar im Gegensatz zum ersten Teil nachgelassen. Die Handlungsorte wechseln meiner Meinung nach zu stark, so dass die Einzelschicksale der Charaktere nicht vollständig zur Geltung kommen. Iris Kammerer hat es sicherlich nur gut gemeint, aber oftmals hatte ich den Eindruck, sie verrenne sich in viel zu viel geschichtlichen Details und in der Politik der damaligen Zeit. Ein Spannungsbogen, der sich langsam entwickelt, war für mich in diesem Roman leider nicht erkennbar.
Das Familienleben und die Schwierigkeiten mit der daraus resultierenden Situation sind ein immer wiederkehrendes Thema in diesem zweiten Band. Hier hätte es gut getan, sich wesentlich mehr für den Schauplatz der politischen Lage zu entscheiden als sich mit Familienfehden und Streitigkeiten zu befassen. Besondere und positive Aufmerksamkeit wurde den Pläne des Tiberius gewidmet; diese Gespräche zwischen den römischen Offizieren und dem Oberbefehlshaber in Germanien selbst waren höchst interessant und spannend erzählt.
Sicherlich ist die Geschichte des Volkshelden Arminius literarisch schon öfter ausgearbeitet worden, sei es nun in Form eines Romans oder in geschichtlichen Abhandlungen. Und meistens wurde die Person des Befreiers Arminius als durchweg positiv geschildert. Iris Kammerer ist es gelungen, die Persönlichkeit des Arminius zwar historisch belegt korrekt zu beschreiben, doch verzichtet sie auf das genreübliche Klischee von Gut und Böse in der Studie der Charaktere. Ein Jeder muss sich ein eigenes Urteil über diesen Cherusker-Fürsten bilden; für den einen eine Art von Freiheitsheld, der das germanische Volk vom Joch der römischen Tyrannei befreit hat, für den anderen ist er wohl nur ein meineidiger Verräter, der keinem Volk wohl wirklich uneigennützig gedient hat, sondern nur seinem persönlichen Ehrgeiz. Und genau diese Charakterstudien bilden die absoluten Pluspunkte in diesem Band.
_Fazit_
Seien wir gespannt auf den dritten und letzten Teil der Trilogie. Der erste Roman von Iris Kammerer, „Der Tribun“, war insgesamt spannender und überzeugte mich mehr. „Die Schwerter des Tiberius“ ist sicherlich kein schlechter Roman, kein uninteressanter Nachfolger einer erfolgreichen Geschichte, obwohl ich häufiger den Eindruck hatte, die Autorin verrenne sich und finde den roten Faden nicht wieder. Historisch ungemein sauber und fesselnd geschrieben, ist der zweite Band also durchaus zu empfehlen und macht neugierig darauf, wie es weitergeht, nicht nur mit der Figur des Gaius Cinna, sondern auch mit seinem Widersacher und Erzfeind Arminius.
Originalausgabe
Taschenbuch, ca. 560 Seiten
http://www.heyne.de
http://www.iris-kammerer.de/