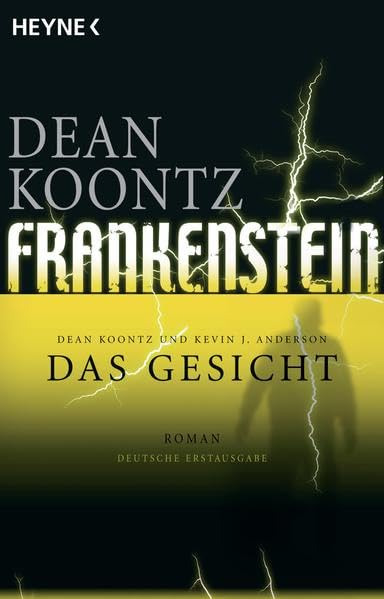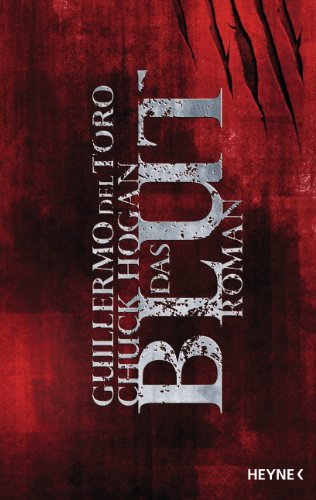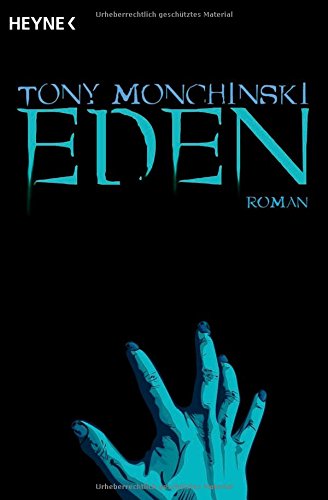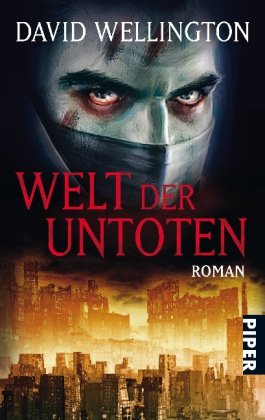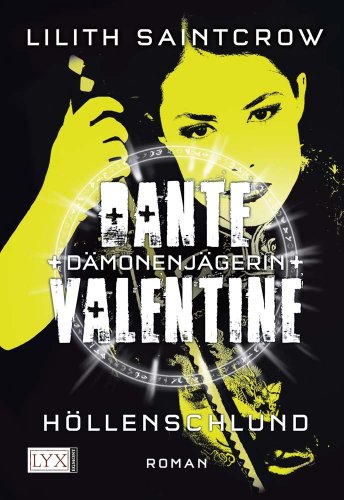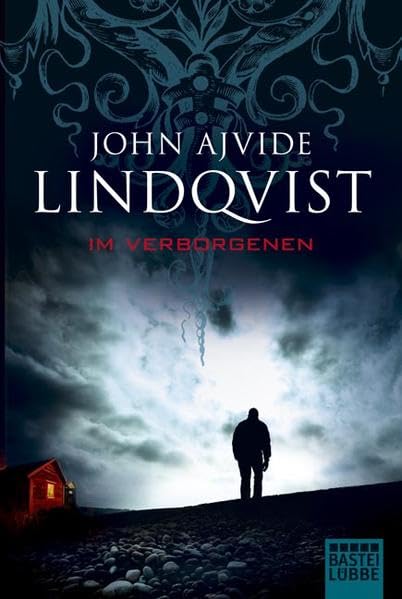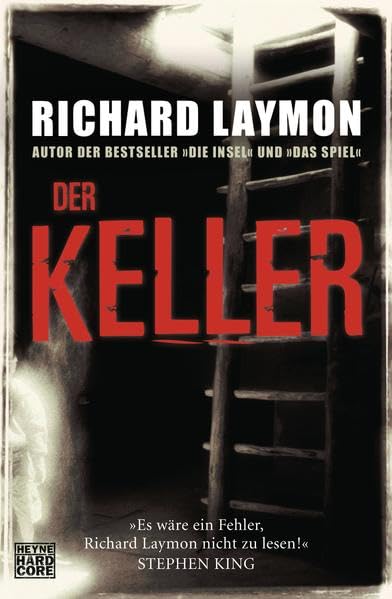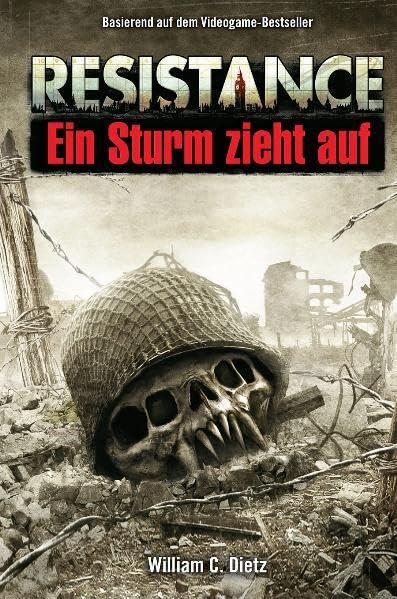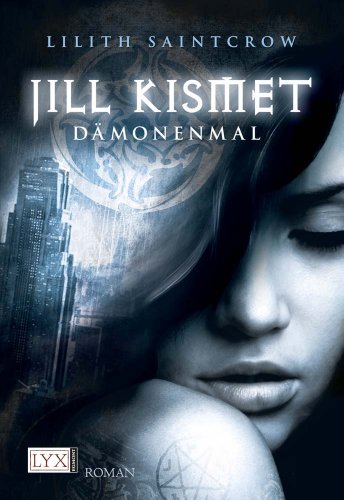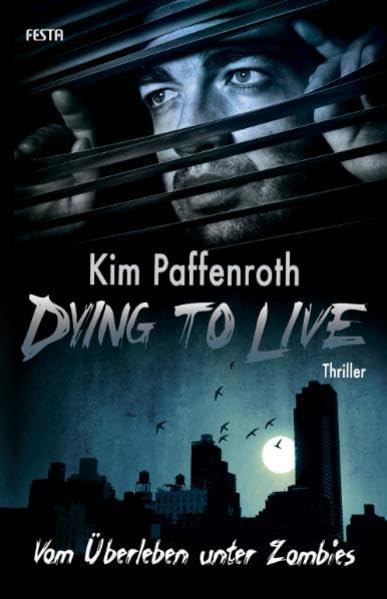_Die |Frankenstein|-Trilogie:_
Band 1: _“Das Gesicht“_
Band 2: „Die Kreatur“
Band 3: „Der Schatten“
_Das geschieht:_
In der US-amerikanischen Südstaatenmetropole New Orleans verursacht ein Serienmörder der Polizei Kopfzerbrechen: Er tötet Frauen und Männer, denen er jeweils Gliedmaßen oder Organe entfernt. Detective Carson O’Connor und Partner Michael Maddison stehen auch nach dem sechsten Fall vor einem Rätsel bzw. mit indizienleeren Händen da.
Auch auf der anderen Seite der Erdkugel werden die Morde mit Besorgnis zur Kenntnis genommen. Ins tibetische Kloster Rombuk und damit in die größtmögliche Einsamkeit hat sich jene Kreatur zurückgezogen, die einst der ebenso geniale wie skrupellose Wissenschaftler Viktor Frankenstein aus Leichenteilen schuf. Das „Monster“, wie es einmal genannt wurde, ist inzwischen zweieinhalb Jahrhunderte alt aber weiterhin gut bei Kräften. Es nennt sich Deucalion, hat hart und erfolgreich an seiner Bildung gearbeitet, sich mit seinem grotesken Äußeren abgefunden und ist mit Körper und Geist im 21. Jahrhundert angekommen.
Dies trifft auch auf Frankenstein zu, der zum ultrareichen Konzernboss Helios mit guten politischen Kontakten geworden ist. Ihn verdächtigt Deucalion der Mordserie im Süden der USA. Um ihn zu stoppen, reist er nach New Orleans. Dort gerät er rasch ins Visier von O’Connor und Maddison, die verständlicherweise wenig geneigt sind, an die Existenz einer alten Gruselmär zu glauben. Doch die Not schafft bekanntlich seltsame Bettgenossen: Als seltsame, anscheinend künstliche Wesen ihr Unwesen zu treiben beginnen, offenbart sich ein diabolischer Plan: Frankenstein will eine neue, ‚verbesserte‘ Menschenrasse ins Leben rufen, deren Meister natürlich er selbst sein soll. Ihn aufzuhalten ist schwierig, denn Frankenstein ging bereits erfolgreich in die Massenproduktion und schickt seine Geschöpfe aus, um jene zu jagen und zu töten, die sich ihm in den Weg stellen …
_Ein Kult auf modernen (Ab-)Wegen_
Verrückter Wissenschaftler will die Welt nach seinem Gusto verändern und bedient sich dafür kapital krimineller Methoden, worauf sich ein hoffnungslos unterlegenes Grüppchen aufrechter Gesellen aufmacht, genau dies zu verhindern: Eine Geschichte wird uns hier kredenzt, die wir schon oft gelesen oder als Film umgesetzt gesehen haben. Das geht in Ordnung, wenn sie rasant und ohne Längen erzählt wird, wofür die Namen Koontz & Anderson grundsätzlich garantieren.
Aufmerksamkeit soll in diesem Fall erfolgreich erregt werden, indem besagte Geschichte mit einem Romanklassiker verquickt wird, der über seine literaturgeschichtliche Bedeutung hinaus zu einem festen Bestandteil der Populärkultur geworden ist: Ein echter Kult, der nicht gemacht wurde, sondern aus eigener Kraft wuchs. Baron Frankenstein, der sich gegen Gott versündigte, als er dessen Monopol als Schöpfer von Leben missachtete, und seine Kreatur, die an ihrer Herkunft verzweifelte und ohne Erfolg versuchte, als Mensch unter Menschen einen Platz zu finden, bewegen die Fantasie seit dreihundert Jahren. Die Ankündigung ihres neuerlichen Auftritts stellt bereits ein gewisses Grundinteresse sicher: Was werden sie dieses Mal erleben, da sie im 21. Jahrhundert aufeinandertreffen?
Eigentlich nichts Neues, muss man feststellen. Frankenstein und sein Geschöpf führen ihre Auseinandersetzung fort, die vor vielen Jahren für beide beinahe tödlich geendet hätte. Weiterhin weigert sich Frankenstein einzusehen, dass er intelligente Wesen nicht im Labor ‚bauen‘ darf, um ihnen, ist dieses ‚Experiment‘ gelungen, seinen Willen aufzuzwingen. Das „Monster“, das dieses Schicksal am eigenen Leib erfahren musste, bemühte sich bisher vergeblich, Frankenstein dies klarzumachen. Jetzt geht es ihm darum, seinen ‚Meister‘ zu stoppen.
|Action statt Anspruch: Horror im Höchsttempo|
Der Konflikt beschränkt sich nicht mehr auf Frankenstein und seine Kreatur. Koontz (sein Name wird im folgenden Text allein genannt, da er die treibende Kraft hinter diesem neuen „Frankenstein“-Projekt war) erweitert die Bühne. Die ganze Welt ist nunmehr Spielplatz des globalisierten Barons geworden, was seine Verfolger zwingt, sehr reiselustig zu werden. „Das Gesicht“ fügt sich der Dramaturgie eines „Hit & Run“-Games. Immer geschieht etwas, kaum gibt es jemals einen Moment der Ruhe. Aus Jäger werden Gejagte, wobei die Rollen rasch getauscht werden können. Koontz beherrscht dieses Konzept gut genug, dass kaum jemals der Gedanke beim Leser aufkommt, ob es denn wirklich notwendig ist, dieses Hin und Her auf mehrere Bände auszuwalzen.
Tiefgang dürfen wir folgerichtig nicht erwarten, auch wenn ihn uns Koontz manchmal vorgaukeln möchte, wenn es Frankensteins Monster hier und da über sein Schicksal und seinen Status in dieser grausamen, kalten Welt sinnieren lässt. Es sind trivialisierte Echos jener philosophischen Grundsatzdiskussionen, die Mary W. Shelley, die Autorin des ursprünglichen Romans, Frankenstein und sein ‚Kind‘ vor drei Jahrhunderten führen ließ. „Das Gesicht“ ist dagegen ein moderner Horror-Thriller mit Copkrimi-Einsprengseln, der sich auf die bekannten und bewährten Elemente beider Genres verlässt.
|Unsterblicher Vater-Sohn-Konflikt|
Wie würde ein Frankenstein-Monster – wäre es real – in der modernen Welt leben? Die neue „Frankenstein“-Trilogie basiert zu einem guten Teil auf dieser Frage bzw. den möglichen Antworten. Natürlich gilt es zuvor zu unterscheiden zwischen der zwar hässlichen aber hochintelligenten Kreatur, die Mary Wollstonecraft Shelley 1819 schuf, und dem relativ tumben, schnaubenden Hollywood-Monster, das vor allem in den 1930er Jahren von Boris Karloff gemimt wurde.
Koontzes Deucalion ist Shelleys Kreatur, was bereits die selbstironische Namenwahl belegt: „Deucalion“ war in der griechischen Mythologie ein Sohn des Prometheus, der wiederum als Schöpfer der Menschen und Tiere verehrt wurde. Als „modernen Prometheus“ bezeichnete Shelley Victor Frankenstein, den sein Geschöpf lange Zeit als „Vater“ betrachtete.
Das ist Vergangenheit, „Vater“ und „Sohn“ sind sich schon lange spinnefeind. Deucalion hasst Frankenstein – nicht zwangsläufig, weil der ihn wider die Naturgesetze bzw. Gott in eine Welt gebracht hat, die ihm nur Furcht und Hass entgegenbrachte, sondern weil er sich zum einen feige weigerte, Verantwortung für seine unglückliche Schöpfung zu übernehmen, während er zum anderen seine unheilvollen Experimente fortsetzte. Das eigentliche Monster ist folgerichtig Frankenstein.
Deucalion hat zu sich selbst und seine Nische in dieser Welt gefunden. Vorbei sind die Zeiten, in denen ihn ängstliches, ungebildetes Volk mit Fackeln und Mistgabeln jagte oder er sich als kurioses Scheusal auf Jahrmärkten prostituieren musste. Die Welt ist politisch korrekter geworden. Deucalion zieht noch immer die Blicke auf sich, aber er muss sich nicht mehr verstecken, sondern kann, wenn es nötig ist, ganz modern von Tibet in die USA reisen.
|Frankenstein: Ein Erfolgsmodell|
Frankenstein hat inzwischen nur als Wissenschaftler und Machtmensch dazugelernt. Er kann es in Sachen Langlebigkeit mit seiner Kreatur aufnehmen, sodass auch er auf das Wissen von und die Erfahrungen aus Jahrhunderten zurückzugreifen vermag. In der globalisierten Gegenwart, für die er geboren zu sein scheint, hat ihm seine rücksichtlose Gleichgültigkeit den Aufbau eines milliardenschweren Konzerns ermöglicht. Sein grundsätzliches Interesse ist jedoch geblieben: Frankenstein baut weiterhin künstliche Menschen. Ständige Experimente haben ihn gelehrt, welche ‚Konstruktionsfehler‘ er vermeiden sollte. Seine aktuellen Geschöpfe haben nichts mehr mit dem plumpen, klobigen Deucalion gemeinsam. Sie verschwinden in der Menschenmenge, und genau das sollen sie auch, denn Frankenstein, bei Shelley noch eine durchaus tragische Gestalt, ist unter Koontzes Feder endgültig zum intelligenten „mad scientist“ mutiert, der die Welt erobern bzw. mit seinen neuen, vollkommenen Menschen bevölkern will.
|Cops zwischen Mythos und ‚Realität’|
Überlebensgroße Gestalten benötigen normalmenschliche Begleiter, in die sich der Leser/die Leserin projizieren kann. Diese Rollen übernehmen die Polizisten O’Connor und Maddison, harte US-Cops, die in Wort und Tat praktisch alle aktuellen sowie die meisten zeitlosen Klischees verkörpern, die Film, Fernsehen & Unterhaltungsliteratur jemals erschaffen haben. Detective O’Connor ist ein eisenhartes Frauenzimmer, das ständig beim Chef aneckt, kleine Ganoven gern gleich auf offener Straße vertrimmt und selten im Büro beim Papierkram anzutreffen ist. Natürlich ist sie hübsch, damit es hier und da ein wenig prüdamerikanisch knistern kann. Maddison ist in diesem Roman das Yang zum O’Connorschen Yin; originell soll vermutlich wirken, dass er in diesem Duo den zurückhaltenden Part übernimmt.
Plumpwitz kommt zum Einsatz, wenn Koontz zwei unsympathische Polizistenkollegen „Jonathan Harker“ und „Dwight Frye“ nennt: Der eine ist Graf Draculas erstes Opfer in Bram Stokers berühmtem Roman, der andere heißt nach dem Schauspieler, der in dem klassischen „Frankenstein“-Filmen von 1931 Frankensteins buckligen Laborgehilfen mimte. Solche ‚Einfälle‘ passen gut zu „Dean Koontz’s Frankenstein“, der nichts Neues, Originelles schafft, sondern stets nur imitiert.
|Exkurs: Frankensteins schwere Wiedergeburt|
Ihre neue „Frankenstein“-Geschichte hatten sich Koontz und Anderson ursprünglich für das USA Cable Network einfallen lassen, dem sie als Grundlage für den Pilotfilm zu einer ganzen „Frankenstein“-TV-Serie dienen sollte. Koontz wurde als Ausführender Produzent angeheuert. Ihm zur Seite stand niemand Geringerer als Meisterregisseur Martin Scorsese. Allerdings überwarf sich Koontz bald mit seinem Auftraggeber und verließ das Projekt. „Frankenstein“ wurde 2004 unter der Regie von Marcus Nispel („The Texas Chainsaw Massacre“, „Freitag der 13te“ – das Remake) mit Vincent Perez als Monster und Thomas Kretschmann als Meister verfilmt. Das Ergebnis ist keine Sternstunde des phantastischen Films, bietet aber solide gestaltetes und visuell überdurchschnittliches Handwerk.
Dieser Film erschien in Deutschland als DVD unter dem Titel „Frankenstein – Auf der Jagd nach seinem Schöpfer“. Eine Serie folgte aufgrund der Streitigkeiten, die sich auch nach Koontzes Abgang fortsetzten, nicht mehr. Der sparsame Koontz hat seine Ideen deshalb recycelt und zu einer Romanserie umgearbeitet.
_Autoren_
Dean Ray Koontz wurde am 9. Juli 1945 geboren. Er studierte Englisch und arbeitete bis in die späten 1960er Jahre als Lehrer für eine High School nahe Harrisburg. In seiner Freizeit begann Koontz zu schreiben, doch erst in den 1970er Jahren machte er sein Hobby zum Beruf. In diesen Jahren versuchte er sich in vielen Genres, schrieb außer Horror auch Sciencefiction, Krimis oder Liebesschnulzen, wobei er sich oft hinter Pseudonymen verbarg.
Seinen Durchbruch verdankte Koontz dem Roman „Demon Seed“ (1973, dt. „Des Teufels Saat“ bzw. „Security“), der zwar wenig innovativ aber erfolgreich verfilmt wurde. Sein Publikum liebt Koontz für die simplen aber stringent entwickelten Plots, die überzeugend ‚menschlich‘ wirkenden Figuren und das Geschick, mit dem der Autor diese in solide inszenierte unheimliche Abenteuer verwickelt. Da sich Koontz gern bewährter Klischees bedient, sind seine Romane als Vorlagen für Filme beliebt. „Watchers“ (dt. „Brandzeichen“), „Whispers“ (dt. „Höllenqualen“ bzw. „Flüstern in der Nacht“) oder „Hideaway“ (dt. „Das Versteck“) wurden allerdings unfreiwillig kongenial verfilmt: als unterhaltsame aber völlig unoriginelle B-Movies.
Als Produzent anspruchslosen Lesefutters hat Koontz inzwischen Bestsellerstatus erreicht. Von der Kritik werden seine zahlreichen, oft überhastet und unfertig wirkenden, sich in endlosen Verfolgungsjagden erschöpfenden Werke selten positiv gewürdigt. Seine Leser teilen diese Vorbehalte nicht. Koontz weiß, was er an seinen Fans hat, und versorgt sie regelmäßig mit Informationen auf der [sehr professionellen Website]http://www.deankoontz.com .
Kevin J. Anderson (geb. 27. März 1962) gehört zu den bekannten und gern gelesenen Autoren des Genres Sciencefiction, was vor allem seinem Fleiß, seinem Hang zu simpel gestrickten und bewährten Plots sowie der Verwendung einfacher Worte in ebensolchen Sätzen zu verdanken ist. Diese Fähigkeiten machen ihn zum idealen, weil zuverlässigen Lieferanten von Romanen zu Filmen und Fernsehserien; Anderson produzierte u. a. Lesefutter für anspruchsarme „Star Wars-“ und „Akte X“-Fans. Außerdem verfügte er über die Kühnheit, Fortsetzungen bzw. Prequels zu Frank Herberts klassischer „Dune“-Saga zu verfassen, die nicht nur ebenso umfangreich sind, sondern zur Freude des Verlags sehr viel schneller auf den Buchmarkt geworfen werden können als die Originale. Selbst ausgedacht hat sich Anderson die Second-Brain-Space-Opera „Saga of Seven Suns“, die es auf bisher sieben Bände (plus eine Vorgeschichte) gebracht hat. Über sein quasi stündlich wachsendes Werk informiert Anderson auf dieser Website: [www.wordfire.com]http://www.wordfire.com
|Taschenbuch: 382 Seiten
Originaltitel: Dean Koontz’s Frankenstein, Book One – Prodigal Son (New York : Bantam Dell, a division of Random House, Inc. 2005)
Übersetzung: Ursula Gnade
ISBN-13: 978-3-453-56504-3|
[www.randomhouse.de/heyne]http://www.randomhouse.de/heyne
_Dean Koontz bei |Buchwurm.info|:_
[„Die Anbetung“ 3066
[„Seelenlos“ 4825
[„Schattennacht“ 5476
[„Meer der Nacht“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=5942
[„Meer der Finsternis“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=6119
[„Todeszeit“ 5423
[„Todesregen“ 3840
[„Irrsinn“ 4317
[„Frankenstein: Das Gesicht“ 3303
[„Kalt“ 1443
[„Der Wächter“ 1145
[„Der Geblendete“ 1629
[„Nacht der Zaubertiere“ 4145
[„Stimmen der Angst“ 1639
[„Phantom – »Unheil über der Stadt«“ 455
[„Nackte Angst / Phantom“ 728
[„Schattenfeuer“ 67
[„Eiszeit“ 1674
[„Geisterbahn“ 2125
[„Die zweite Haut“ 2648
[„Meer der Finsternis“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=6119