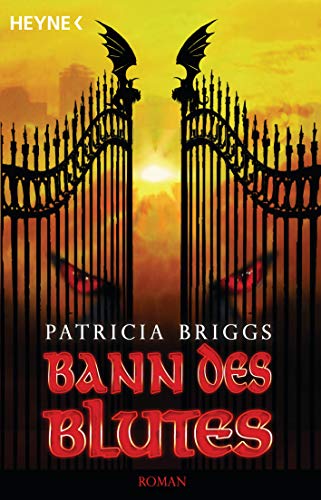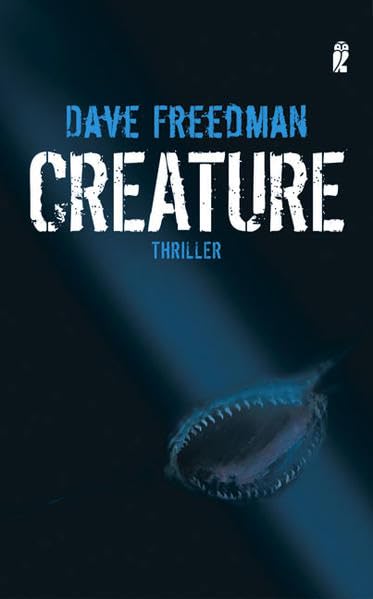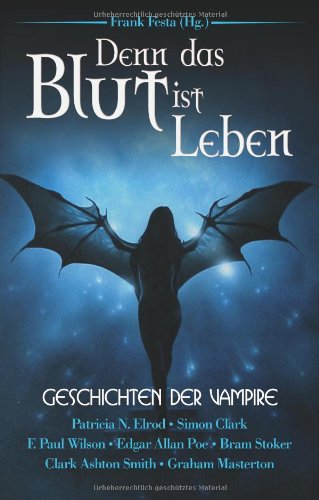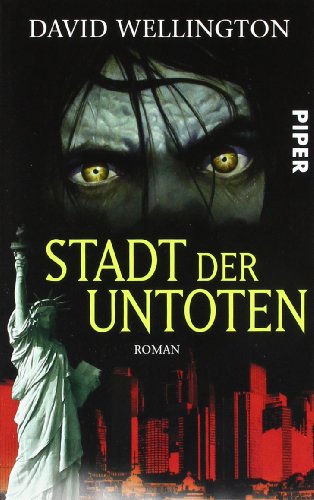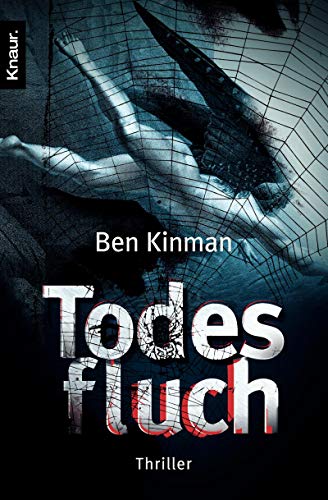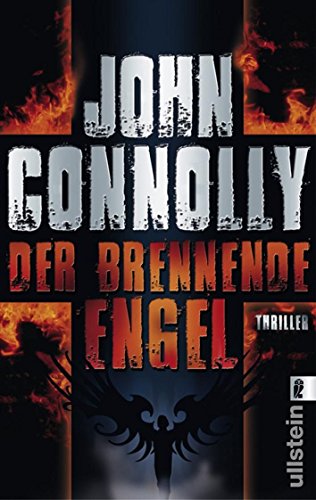Der Dark-Fantasy-Trend reißt einfach nicht ab. Aus den USA eingeschleppt, können sich auch hierzulande immer mehr vornehmlich weibliche Autoren und ihre düsteren Romanreihen etablieren. Bei der amerikanischen Autorin Kim Harrison steht nicht, wie in den meisten anderen Fällen, ein Vampir im Mittelpunkt, sondern eine Erdhexe, die mithilfe von Amuletten und Kraftlinien Magie anwendet.
Die Erdhexe Rachel Morgan ist eine chaotische, dickköpfige junge Frau, die nach ihrem Weggang vom FIB – dem Federal Inlander Bureau, das sich darum kümmert, dass das Zusammenleben zwischen den Inderlander-Wesen und den normalen Menschen geregelt wird – eine glänzende Karriere als Runnerin hingelegt hat. Gemeinsam mit ihren Partnern, dem zehn Zentimeter großen Pixie Jenks und der Vampirin Ivy, bildet sie nicht nur eine Wohngemeinschaft, sondern auch eine Runneragentur, die sich um das Auffinden von vermissten Personen und derlei kümmert.
Ein solcher Job birgt natürlich einige Gefahren: Im zweiten Band der Reihe, [„Blutspiel“, 4512 hat Rachel ihre Seele an den Dämonen Algaliarept verkauft, um Piscary, den ältesten und gefährlichsten Vampir von Cincinnati, hinter Gitter zu bringen. Dadurch hat sich das Machtgleichgewicht in der Unterwelt der Stadt verschoben. Ein gewisser Saladan versucht, seinen Teil vom Kuchen abzubekommen. Er probiert es mit Schutzgelderpressung und Drogenhandel und zieht dadurch die Aufmerksamkeit zweier Männer auf sich: Kisten ist ein getreuer Anhänger Piscarys und Trent Kalamack der Drogenbaron der Stadt, der sich hinter seinem Wohltäter-Image verschanzt.
Beide bitten Rachel um Hilfe, um Saladan aus der Stadt zu vertreiben. Während Trent nach wie vor Rachels Lieblingsfeind ist, muss sie sich Kistens Annäherungsversuche gefallen lassen – und ist dabei gar nicht mal so abgeneigt. Das allerdings führt dazu, dass ihre Mitbewohnerin Ivy reichlich verstimmt ist. Schließlich ist Kisten nicht nur ihr Exfreund, sondern sie sieht Rachel, ganz nach Vampirmanier, als ihr Eigentum an …
„Blutjagd“ schließt nahtlos an die beiden bereits veröffentlichten Bände von Kim Harrison an. Ohne Vorwissen kommt man daher nicht weit. Die Autorin nimmt sich nicht die Zeit, um Wichtiges vorneweg zu klären, wobei anzumerken ist, das dies bei der Komplexität ihrer Serie auch nur schwer möglich wäre. Woran sie ebenfalls nahtlos anknüpft, ist ihre Vorliebe für eine langatmige, leicht überladene Handlung: Was in [„Blutspur“ 3253 und „Blutspiel“ ärgerlich war, wird bei der Vielschichtigkeit, die Harrisons Serie bereits erreicht hat, manchmal zur Geduldsprobe. Erst möchte die Geschichte nicht in Schwung kommen und dann ist häufig unklar, wohin die Handlung eigentlich führen soll. Erst gegen Ende des Romans kommt richtige Spannung auf; die Autorin konzentriert sich auf einen einzigen Handlungsstrang und verfolgt nebenbei nicht noch mehrere unwichtige. Zusammen mit der stellenweise überzogenen Detailliertheit bezüglich der Geschehnisse und der Beschreibungen krankt „Blutjagd“ vor allem daran, dass die Geschichte zu lang, zu umfangreich und vor allem zu unfokussiert ist. Ein roter Faden fehlt beinahe vollständig, viele Nebensächlichkeiten werden aufgebauscht – das sind nicht gerade die besten Voraussetzungen für ein paar spannende Lesestunden.
Auch wenn die Handlung eines Buches sehr wichtig bei dessen Bewertung ist, gibt es einige Dinge, die man Harrison abseits davon zugute halten muss. Zum einen ist das der Schauplatz, an dem die Geschichte spielt. Harrison beweist nicht zum ersten Mal, wie gut sie darin ist, eine komplett andere Welt zu entwerfen, die alleine aufgrund ihrer Darstellung schon Spannung erzeugt. Vampire, Pixies, Elfen und Hexen sind sicherlich nichts Neues, aber die Autorin siedelt diese in einem recht düsteren Setting an. Die Stadt Cincinnati verfügt mit den Hollows über ein Stadtteil, in dem man vorzugsweise Inderlander, also sämtliche fantastische Wesen, antrifft. Dass deren Zusammenleben nicht immer reibungslos abläuft, ist klar, und somit ist von vorneherein für eine Menge Reibung gesorgt. Harrisons Einfallsreichtum kennt dabei keine Grenzen. Ihre Welt ist dicht besiedelt von übernatürlichen Gestalten, denen sie gerne einen humoristischen Anstrich verpasst und die durch ihre sorgfältige Ausarbeitung glänzen. Jede der Arten besitzt bestimmte Eigenarten, die durch ihre Innovativität gefallen und „Blutjagd“ trotz der Schwächen in der Storyline über den Durchschnitt hieven.
Dieselbe Sorgfalt, die Harrison den Details und dem Setting angedeihen lässt, widmet sie auch den Figuren. Rachel Morgan zeigt auch nach zwei dicken Vorgängerbänden noch keine Ermüdungserscheinungen. Sie ist eine sympathische, chaotische Hexe, die mit einer spannenden Vergangenheit glänzt, die immer noch nicht völlig ausgeleuchtet ist. Auch über die anderen Charaktere lernt man immer wieder interessante Dinge, die man noch nicht wusste. Die Zahl an Figuren ist im übrigen mittlerweile ebenfalls sehr hoch. Allerdings schafft die Autorin es, die einzelnen Charaktere so voneinander abzugrenzen, das man sie nicht verwechselt. Die verschiedenen Eigenarten und Macken sind dabei abwechslungsreich und häufig witzig. Gerade die Pixies – das heißt, Jenks und seine ziemlich große Familie – sorgen immer wieder für Lacher.
Getragen wird das Ganze von Harrisons amüsantem Schreibstil. Sie berichtet aus Rachels Perspektive und benutzt dazu eine Sprache, die weniger Wert auf Erhabenheit als auf die Vermittlung von Emotionen und Gedanken legt. Der Wortschatz ist groß, klingt aber nie hochgestochen. Am prägnantesten ist Harrisons Humor. Ihre bissigen, manchmal fast schon boshaften Witze und die flapsigen Bemerkungen von Rachel lassen die Geschichte erst richtig lebendig werden. Schlagfertige Dialoge und der angemessene Gebrauch von Stilmitteln schließen das Ganze sauber ab. Stellenweise wird man zwar an einschlägige amerikanische Frauenlektüre erinnert, die sich mit einer halbwegs kessen Protagonistin schmückt, letztendlich ist „Blutjagd“ aber wesentlich bissiger und düsterer und wirkt nie seicht oder halbherzig.
Halbherzig ist ein gutes Stichwort; die Autorin Kim Harrison ist nämlich alles andere als das. Sie ist geradezu detailversessen, was ihren Figuren und ihrer Fantasy-Welt gut tut, der Handlung aber schadet. „Blutjagd“ ist damit bislang der schwächste Band der Reihe, weist aber großes Potenzial auf. Die zwischenmenschlichen Beziehungen und einzelnen Handlungssträge pochen geradezu auf eine Fortsetzung, und tatsächlich wurden in Amerika mittlerweile sechs Bücher mit Rachel Morgan veröffentlicht, ohne dass sich bereits ein Ende abzeichnete. In Deutschland ist man noch nicht ganz so weit, aber auch hier wird laut Verlag im Januar 2009 der vierte Band „Blutpakt“ auf den Markt kommen. Dann erscheint für diejenigen, die jetzt vielleicht – nun ja: Blut geleckt haben, auch der Auftaktband „Blutspur“ als preisgünstigere Taschenbuchausgabe in überarbeitetem Coverlayout.
|Originaltitel: Every which way but dead
Deutsche Übersetzung von Vanessa Lamatsch
686 Seiten, Taschenbuch
ISBN-13: 978-3-453-53279-3|
http://www.kimharrison.net
http://www.heyne.de
_Kim Harrison bei |Buchwurm.info|:_
[„Blutspur“ 3253
[„Blutspiel“ 4512