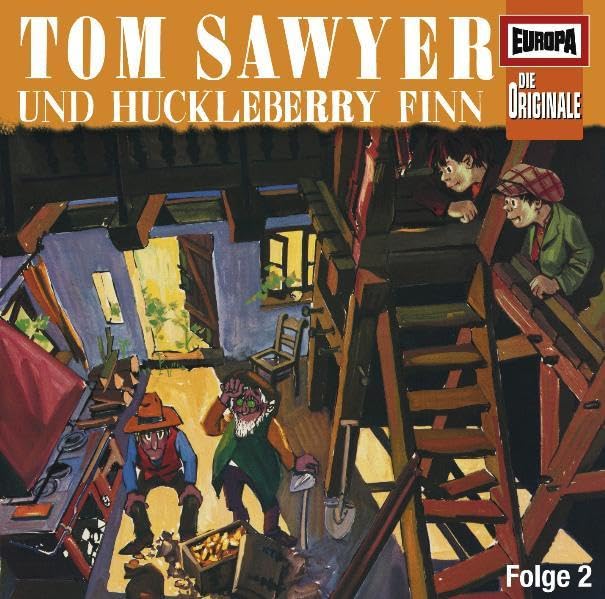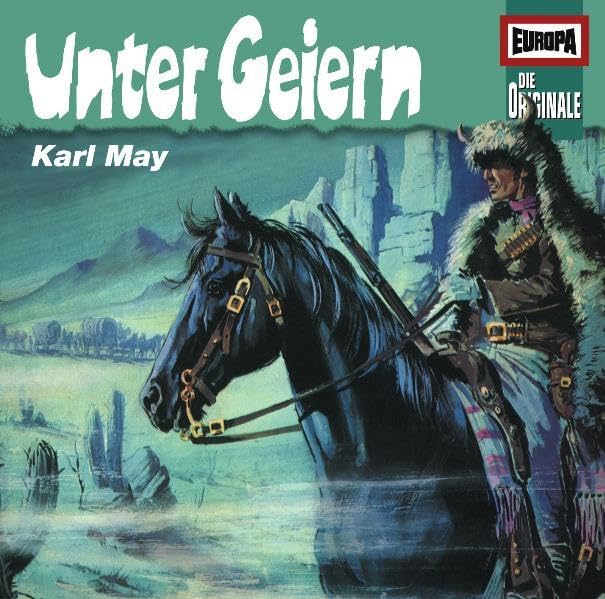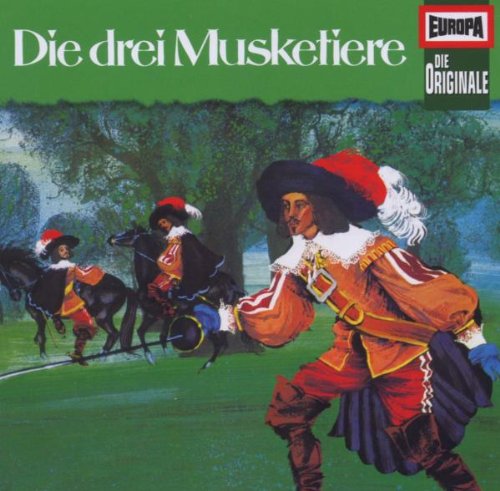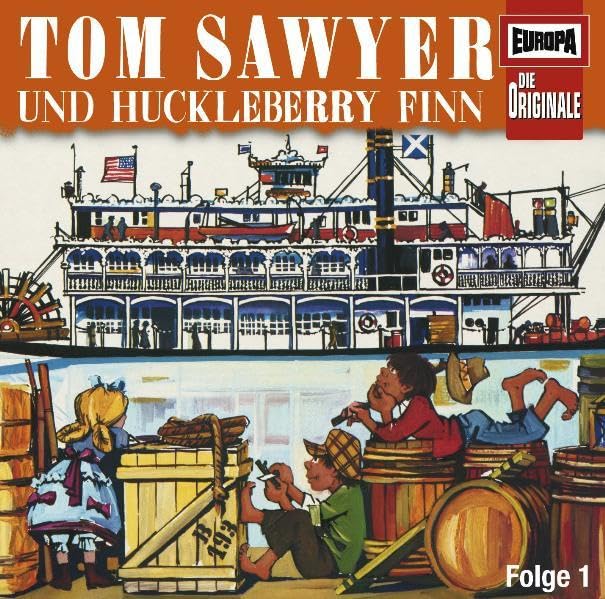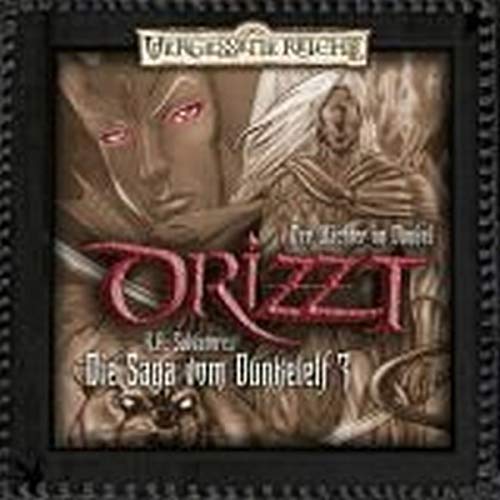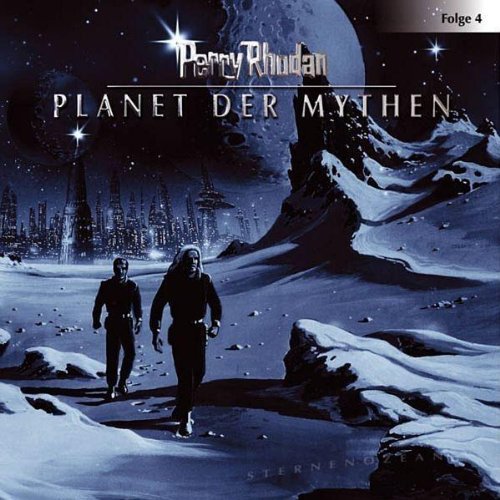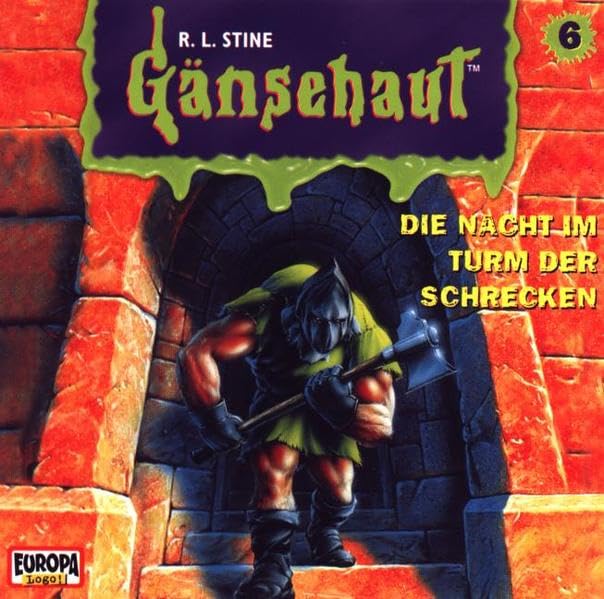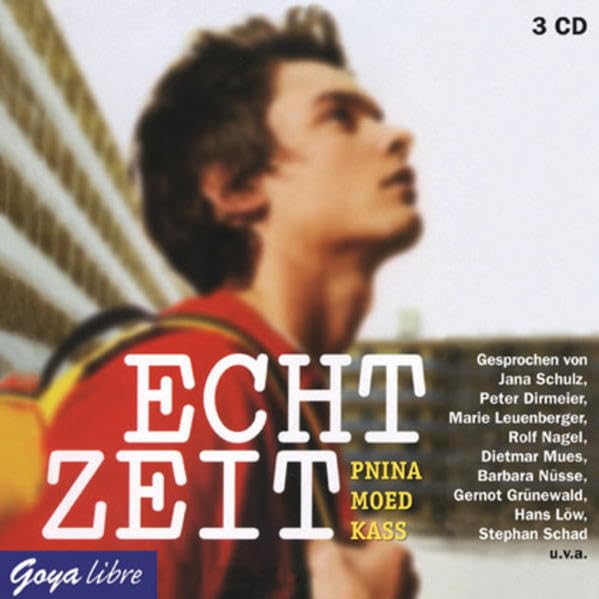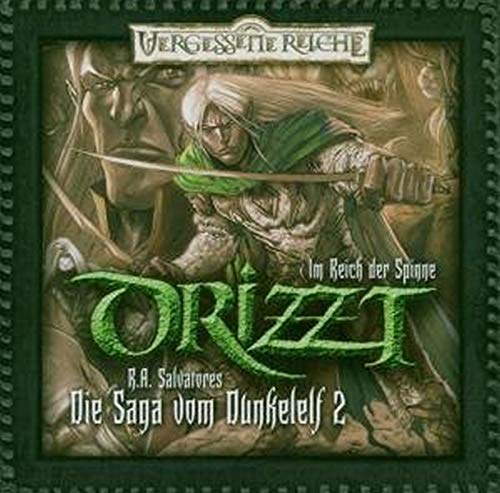_Besetzung_
Erzähler – Hans Paetsch
Der Räuberhauptmann – Herbert A. E. Böhme
Der Jäger – Rudolf Oeser
Felix – Susanne Hartau
Die alte Wirtin – Heike Kintzel
Der Drechsler – Michel Stobbe
Der Student – Sven H. Mahler
Die Gräfin – Heike Kintzel
Ein herzoglicher Offizier – Hans Meinhardt
Und die Räuber
Regie: Claudius Brac
_Story_
Seit Jahren erzählt man sich unheimliche Dinge über den Spessart. Der finstere Wald wird bis weit über die Grenze gefürchtet und geächtet, denn dort sollen sich bereits einige grausame Vorfälle zugetragen haben. Als der junge Goldschmied Felix zusammen mit einem Drechsler in die Gegend kommt und völlig entkräftet im dort gelegenen Wirtshaus nächtigt, sollen sie alsbald zu spüren bekommen, welche Geheimnisse die Region verbirgt. Noch in derselben Nacht wird einer Kutsche eine Falle gestellt, damit die darin untergebrachte Gräfin ebenfalls in der Herberge eine Notunterkunft mieten muss. Doch dies ist noch nicht das Ende des Planes: Die Gräfin selber soll von der kompromisslosen Räuberbande entführt werden. Bevor es jedoch unter starkem Druck der Verbrecher zur Übergabe kommt, hat Felix eine Idee. Er selber schlüpft kostümiert in die Rolle der Edeldame und macht den verwirrten Ganoven auf diese Art und Weise den Garaus.
_Meine Meinung_
Eigentlich hatte sich meine Kritik an der Fehlbesetzung Susanne Hartaus’ nach der Rezension zu „Die Schatzinsel“ wieder beruhigt, denn schon dort war die Dame in der Rolle des jungen Jim Hawkins unangenehm und unglaubwürdig aus der Reihe getanzt. Doch anscheinend hat dies damals niemanden gestört, so dass die Sprecherin auch in „Das Wirtshaus im Spessart“ wieder eine männlich Rolle auferlegt bekam, die sie zwar etwas besser bearbeitet als noch in besagtem Piratenabenteuer, aber wirklich überzeugen kann sie in der Besetzung des jungen Knaben Felix letztendlich doch nicht. Dafür kommt ihre Weiblichkeit schlichtweg zu sehr durch.
Im Gegensatz dazu ist die Geschichte eine echte Wucht und dazu verdammt spannend inszeniert und erzählt. Schritt für Schritt entführt uns Regisseur Claudius Brac in den sagenumwobenen Spessart, tief hinein in eine zwielichtige Welt voller Gauner und Landstreicher, die jedoch auch in regelmäßigen Abständen vom Adelsgeschlecht des Landes heimgesucht wird. Der Mann hat sich dabei sehr strikt an die Originalvorlage von Wilhelm Hauff gehalten und von Kapitel zu Kapitel das Mysterium um das seltsame Wirtshaus weitergesponnen, bis es schließlich mittendrin zur Auflösung und einigen unvorhersehbaren Konsequenzen kommt.
Der Regisseur lässt sich nicht ein einziges Mal in die Karten schauen und übernimmt die eigenwilligen Wendungen der Vorlage absolut detailgetreu, agiert aufgrund der Kürze der Spielzeit aber noch ein ganzes Stück zielstrebiger und temporeicher, was gerade beim sehr direkten Einstieg schnell für Verwirrung sorgt. Man hat sich nämlich hier noch nicht einmal so richtig mit den Hauptfiguren vertraut gemacht, da ist man such schon mitten in einem geheimnisvollen, von langer Hand geplanten Komplott gefangen, welches der Story all ihren Nährstoff verleiht.
Dies beginnt allerdings erst einmal mit einigen Zufällen, denen der Goldschmied und der Drechsler bei ihrer Ankunft im Wirtshaus eher ungewollt auf die Spur kommen – doch ihnen bleibt keine andere Wahl, denn es ist nur zu offensichtlich, dass sich der hermetisch abgeriegelte Gasthof über Nacht in eine schutzlose Räuberhöhle verwandeln wird. Anschließend schmieden die beiden dann Pläne, das Attentat auf die Gräfin zu vermeiden; sie verbünden sich mit den Anhängern der edlen Dame und gehen gut vorbereitet in den Kampf mit den Räubern, allerdings wird ihnen hierbei schon klar, dass sie der elitären Räubermeute auch zu siebt (neben den beiden Hauptfiguren haben sich auch ein berüchtigter Jäger und ein Student mit Felix verbündet) unterlegen sind, so dass ihnen keine andere Wahl bleibt, als den Forderungen ihrer Gegner nachzukommen. Doch Felix reagiert mit einer unerwarteten List und hilft seinen Kumpanen dabei, die Gräfin in Sicherheit zu bringen. Aber nun ist er selber in großer Gefahr und muss die Rache der genarrten Räuber befürchten – und die machen selbst vor so einem jungen Knaben nicht Halt.
Brac und sein Team haben mit diesem deutschen Literaturklassiker ein echtes Schmuckstück für ihr Hörspiel adaptiert und es auch dem Wert entsprechend sehr spannend und auch ein wenig komplex gestaltet. Dem Hörer werden nach einem recht flotten Einstieg erst nach und nach die Zusammenhänge klar, doch sobald sich die Kutsche mit der Gräfin nähert und man eine Vorstellung davon bekommt, was genau die Räuber im Spessart treiben könnten, entwickelt sich die Hörspiel-Fassung aus dem Hause |Europa| zu einem spannenden Mix aus Abenteuer- und Kriminalgeschichte, der durch die humorvolle Darstellung noch zusätzlich aufgewertet wird. Lediglich die erneute Fehlbesetzung der weiblichen Männerrolle durch Susanne Hartau darf als Wermutstropfen gewertet werden; ansonsten ist „Das Wirtshaus im Spessart“ aber ein weiteres Highlight aus der bereits dritten Staffel der Reihe „Europa-Originale“ und als solches, vor allem eben wegen des tollen Spannungsaufbaus, uneingeschränkt zu empfehlen.
http://www.natuerlichvoneuropa.de/