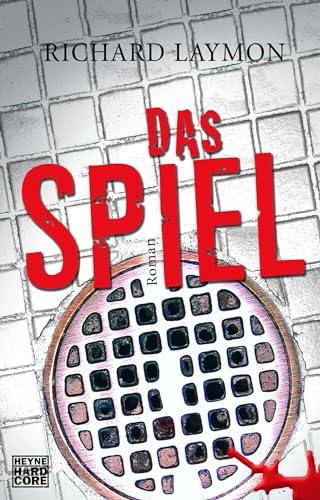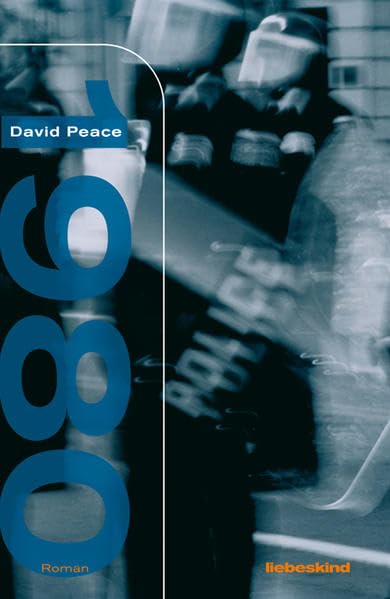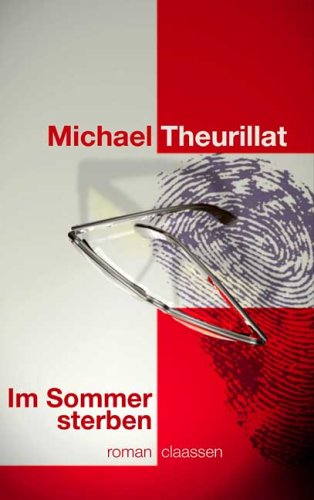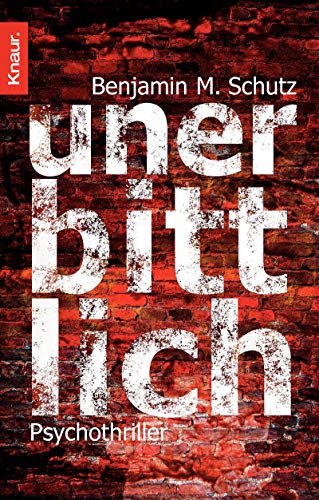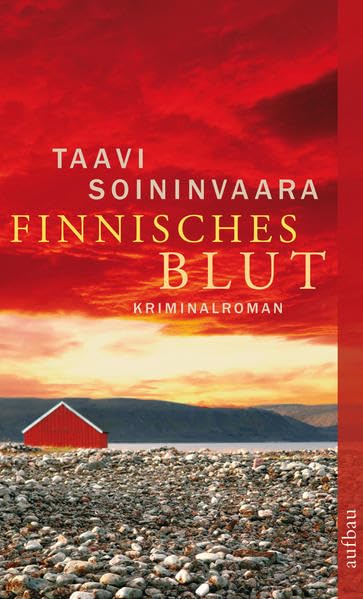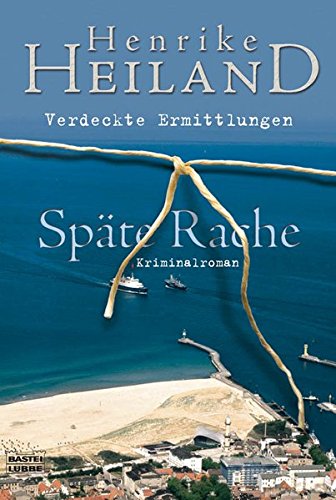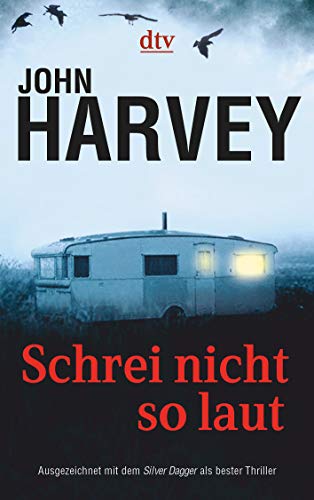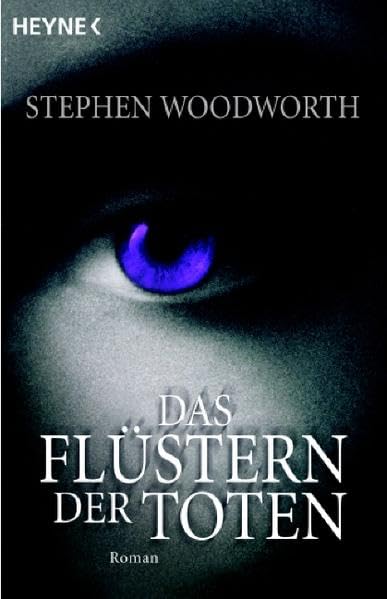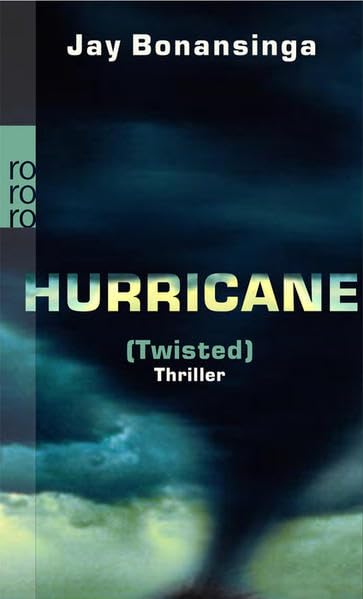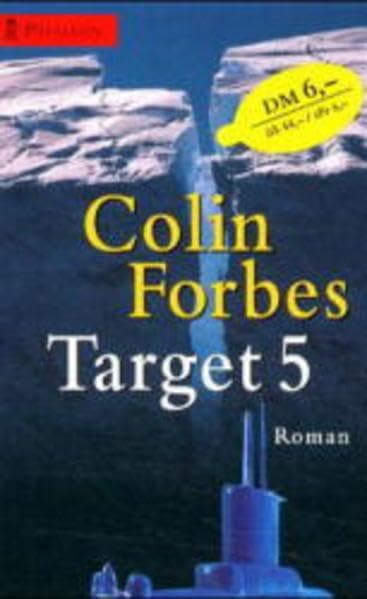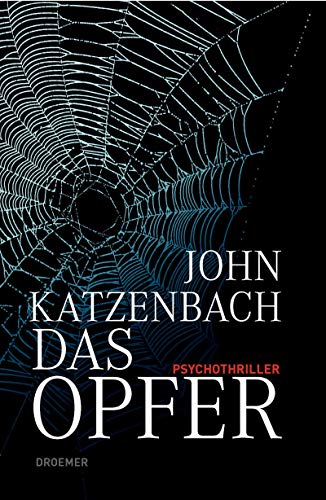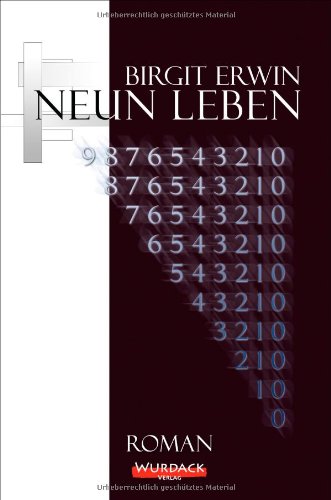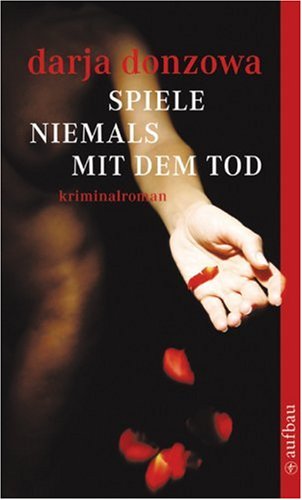Jane Kerry ist eine junge Bibliothekarin, die ein geordnetes Single-Leben führt. Eines Tages entdeckt sie auf ihrem Arbeitsplatz einen Briefumschlag mit ihrem Namen darauf. Er enthält einen Fünfzigdollarschein und die Aufforderung zu einem Spiel. Der Absender nennt sich „Master of Games“, kurz „MOG“. Er hinterlässt einen Hinweis auf den Roman „Schau heimwärts, Engel“, in dem Jane einen weiteren Brief findet, diesmal mit hundert Dollar und wiederum einem neuen Hinweis.
Jane ist einerseits erfreut über das Geld, das sie gut gebrauchen kann, andererseits aber auch beunruhigt über den mysteriösen „MOG“. Beim Stöbern in der Bibliothek lernt sie den sympathischen Uni-Dozenten Brace Paxton kennen, der sie beim Briefe-Fund beobachtet. Mit seiner Hilfe entschlüsselt sie das nächste Rätsel und der hilfsbereite Brace begleitet sie zum Hinweisort. Was als verrücktes Spiel beginnt, nimmt immer beängstigendere Formen an. Der Unbekannte hinterlässt in Janes Wohnung Hinweise und scheint sie ständig zu beobachten. Doch auch das Geld verdoppelt sich mit jedem Brief – Janes Aufgaben, die sie dafür erledigen muss, werden zunehmend gewagter, aber in ernsthafte Gefahr gerät sie nie. Brace, mit dem sie sich auf eine Liaison einlässt, bittet sie eindringlich, dieses Spiel zu beenden.
Aber Jane verstrickt sich immer tiefer in das undurchschaubare Verhältnis zu „MOG“. Sie brennt darauf, seine Identität zu lüften und fühlt sich auf perverse Art durch sein Interesse geschmeichelt. Gleichzeitig zweifelt sie an Braces Absichten: Ist er wirklich so harmlos, wie er vorgibt? Oder hat er sogar etwas mit dem Spiel zu tun? Allmählich kommt Jane an einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Und erst jetzt ahnt sie, mit welch gefährlichem Gegner sie es zu tun hat …
Es ist der dritte Band von Richard Laymon, der innerhalb der |Heyne-Hardcore|-Reihe erscheint, und die Messlatten liegen mit den Bestseller-Vorgängern [„Rache“ 2507 und „Die Insel“ hoch. Erfreulicherweise lässt sich jedoch ohne Zweifel sagen, dass „Das Spiel“ den vorangegangenen Romanen nicht nachsteht, sie sogar noch übertrifft.
|Spannung auf höchster Stufe|
Der Plot ist einfach, geradezu simpel und auch nicht wirklich neu. Trotzdem gelingt es Laymon, eine zeitweise beinah unerträgliche Spannung aufzubauen, die den Leser von Beginn bis Ende fesselt. Es ist die alte Geschichte vom Katz-und-Maus-Spiel zwischen einem mysteriösen Unbekannten mit perversen Vorlieben und einem unschuldigen Protagonisten, hier einer jungen, unbedarften Frau. Es beginnt harmlos, klingt wie ein seltsamer Scherz und von einer Bedrohung kann beim ersten Brief noch keine Rede sein. Ein Bekannter mit eigenartigem Humor, ein heimlicher Verehrer – es gibt viele Möglichkeiten, wer hinter dieser Nachricht stecken könnte, sodass sich Jane zunächst keine Sorgen macht.
Die Steigerung erfolgt schleichend. Janes erste Aufgaben sind vergleichsweise unspektakulär, sie gerät dabei nicht in Gefahr und kommt an leicht verdientes Geld. Zudem reizt es sie, dass der Unbekannte ausgerechnet sie für sein Spiel ausgewählt hat und ihre Neugierde ist geweckt. Erst nach und nach wird offensichtlich, dass sich hinter „Mog“ mehr verbirgt als ein verschrobener Spaßmacher. Janes Belohnungen erhöhen sich rasant, doch auch der geforderte Einsatz nimmt immer waghalsigere Formen an. Ehe sie sich versieht, steckt Jane mittendrin in einem Spiel, das sich ihrer Kontrolle entzogen hat.
„Mog“ scheint sie ständig zu beobachten und findet Mittel, in ihre Wohnung einzusteigen. Gleichzeitig aber fühlt sich Jane zunächst nicht bedroht durch ihn, und bis auf seine Nachrichten hinterlässt er keine Spuren. Der Wunsch nach Antworten und die Freude über das Geld sind stärker als ihre Vernunft, bis sie plötzlich registrieren muss, dass sie es mit einem scheinbar übermächtigen Gegner zu tun hat. Widersetzt sie sich den Regeln, riskiert sie „Mogs“ Rache. Jane hat keine Chance, die Polizei einzuschalten, zu viel hat sie sich nach einigen Aufgaben selber zuschulden kommen lassen, und es ist sehr fraglich, ob man ihr Glauben schenkt – eher würde man sie für eine Spinnerin halten, die sich in etwas hineingesteigert hat.
Die Intensität der Spannung wird zusätzlich durch Braces Anwesenheit erhöht. Der sympathische Englisch-Dozent taucht kurz nach Beginn des Spiels auf und steht Jane hilfreich zur Seite. Aber obwohl sie sich rasch zu seinem Charme und seinem guten Aussehen hingezogen fühlt, bleibt sie misstrauisch. Steckt Brace eventuell mit „Mog“ unter einer Decke? Ist er selber der unheimliche Drahtzieher? Kann sie ihm trauen oder bedeutet er eine Bedrohung …?
|Sympathische Hauptfigur|
Im Mittelpunkt steht eine unspektakuläre und gerade deswegen sympathische Frau, die schnell zur Identifikationsfigur wird. Jane Kerry ist Mitte zwanzig, glücklich in ihrem routinierten und nicht besonders aufregenden Bibliotheksjob und neigt wegen ihrer leicht molligen Figur zur Schüchternheit. Das undefinierbare Interesse von „Mog“ verwirrt sie und erst recht die Bekanntschaft mit Brace. Ihre letzten Beziehungen nahmen unglückliche Enden; umso schwieriger ist es für Jane zu glauben, dass sich ausgerechnet ein begehrter Uni-Dozent für sie interessiert. Ihre Selbstironie, etwa wenn sie sich nackt vor dem Spiegel betrachtet und ihr kritische Gedanken zu ihrer Figur einfallen, lockern die angespannte Atmosphäre immer wieder angenehm auf.
Ausführlich wird man in ihr Seelenleben eingeführt, man freut sich, leidet und hofft mit ihr. Gut nachvollziehbar sind ihre ersten Reaktionen auf das „Spiel“, ihre Neugierde, ihre Faszination und natürlich ihre Begeisterung über den unverhofften Geldsegen. Parallel dazu teilt man ihr Misstrauen über Brace. Nicht nur ihre früheren schlechten Erfahrungen mit Männern, sondern auch sein gleichzeitiges Auftauchen mit „Mogs“ erster Nachricht sind dafür die Auslöser. Einerseits empfindet auch der Leser Brace Paxton als charmanten Mann, andererseits mehren sich mit der Zeit die Indizien dafür, dass er nicht der ist, der er zu sein vorgibt. Lange Zeit bleibt seine Rolle unklar, und so wie Jane schwankt man in der Beurteilung immer wieder hin und her.
|Mehr Psychoterror statt Gewalt|
Die Bücher der |Heyne-Hardcore|-Reihe zeichnen sich durch überdurchschnittliche Härte aus, die sich im Horror- und Thrillergenre meist in Gewalt widerspiegelt. Sowohl bei „Rache“ als auch bei „Die Insel“ waren brutale Einlagen keine Seltenheit, sodass die Erwartungen hier ähnlich liegen. Tatsächlich aber hält sich Laymon diesmal angenehm zurück mit exzessiven Details. Erst jenseits von Seite 300 wird der Leser mit einer grausamen Schilderung geschockt. Hier stößt man gemeinsam mit Jane auf splattergespickte Szenen, die für Zartbesaitete sicher schwer erträglich sind. Allerdings sind es nur wenige Sätze und kurze Beschreibungen, und diese sind wiederum schon fast satirisch zu sehen, so überzeichnet wird die Gewalt.
Abgesehen von ein paar Seiten liegt der Fokus des Romans eindeutig auf psychischem Horror statt auf Darstellung von Gemetzel, und das ist eine seiner großen Stärken. In einer Manier, die ganz an die Filme von Hitchcock erinnert, gerät die Protagonistin in eine schier unausweichliche Lage, in der es kein Zurück mehr gibt und sie zum Spielball eines finsteren Unbekannten wird. Wer Laymon kennt, der weiß, dass es hier keine Garantie für ein glückliches Ende gibt und er nicht vor gemeinen Wendungen zurückschreckt. Das macht den Ausgang und die gesamte Handlung so aufregend unberechenbar.
Mit großer Eindringlichkeit beschreibt Laymon die Mutproben, die Jane zu bestehen hat, und die sie nachts an unheimliche Orte führen: auf einen Friedhof, in eine zweifelhafte Bar oder in ein verfallenes Haus. Jedes Mal, wenn Jane glaubt, dass „Mog“ sich wohl kaum eine Steigerung einfallen lassen wird, kommt es eine Spur härter. Auch sein Tonfall wird aufdringlicher, büßt immer mehr von seinem eloquenten Charme ein, klingt zunehmend lüstern und unverschämt, und als Jane spürt, dass sie in der Falle sitzt, ist es zu spät um auszusteigen …
|Leichte Schwächen|
Kleine Mankos liegen in der Glaubwürdigkeit, was das Verhalten von Jane Kerry angeht. Zwar hat sich Laymon hier im Vergleich zu „Rache“ und „Die Insel“ gesteigert, vor allem, was Sexgedanken in den unpassendsten Gefahrenmomenten angeht, denn davon ist hier kaum etwas zu merken. Trotzdem ist es manchmal zweifelhaft, wie bereitwillig sich Jane auf das Spiel einlässt und den Anweisungen von „Mog“ folgt. Das gilt nicht für den Beginn, denn da erscheint alles noch harmlos, und auch nicht für das Ende, denn da muss sie schon aus Angst vor Rache gehorchen. Aber in der Mitte gibt es mehrere Stellen, an denen man sich unweigerlich fragt, warum sie sich nicht mehr fürchtet vor diesem Fremden, der in ihre Wohnung einsteigt. Stattdessen sehnt sie sich sogar phasenweise neue Zeichen von ihm herbei und verfolgt seine Anweisungen ohne großes Zögern.
Gegen Ende stört ein paar Mal, dass Jane in Extremsituationen zu locker bleibt und humorvolle Sprüche auf Lager hat und sie gewisse grauenvolle Dinge, die sie sehen musste, scheinbar ohne größere Traumata verkraftet. Für eine junge, zurückhaltende Bibliothekarin, die in Bars noch ihren Ausweis zur Volljährigkeitsbeglaubigung vorzeigen muss, erscheint die Wandlung zur energischen Gegenspielerin, die den Kampf mit „Mog“ aufnimmt, etwas zu übertrieben. Rückblickend betrachtet, erscheint es außerdem als zu konstruiert, dass Jane zu Beginn des Spiels bei manchen Rätseln zufällig an Hilfestellungen kommt, ohne die sie „Mogs“ Hinweise wohl kaum entschlüsselt hätte. Der Gesamteindruck wird von diesen Schwächen aber glücklicherweise kaum getrübt.
_Insgesamt_ liegt hier ein hochspannender Psychothriller vor, der einen neuen Höhepunkt innerhalb von Laymons in Deutschland veröffentlichem Schaffen bildet. Wem die Vorgänger „Rache“ und [„Die Insel“ 2720 bereits gefielen, der dürfte von diesem Werk begeistert sein. Das Hauptaugenmerk liegt auf Psychoterror statt auf blutigem Gemetzel, abgesehen von sehr kurzen Splattereinlagen. Von kleinen Unglaubwürdigkeiten abgesehen, überzeugt dieser Roman auf ganzer Linie und bietet fesselnde Unterhaltung für alle Thrillerfans.
_Der Autor_ Richard Laymon wurde 1947 in Chicago geboren und ist einer der meistverkauften Horrorautoren der USA. Er studierte englische Literatur und arbeitete unter anderem als Lehrer und Bibliothekar, ehe er sich dem Schreiben widmete. Im Jahr 2001 verstarb er überraschend früh und hinterließ eine Reihe von Romanen, die vor allem wegen ihrer schnörkellosen Brutalität von sich Reden machten. Nur ein kleiner Teil davon ist bislang auf Deutsch erhältlich. Zu seinen weiteren Werken zählen u. a. „Rache“, „Parasit“, „Im Zeichen des Bösen“ und [„Vampirjäger“. 1138
Mehr über ihn gibt es auf seiner offiziellen [Homepage]http://www.ains.net.au/~gerlach/rlaymon2.htm nachzulesen.
http://www.heyne-hardcore.de