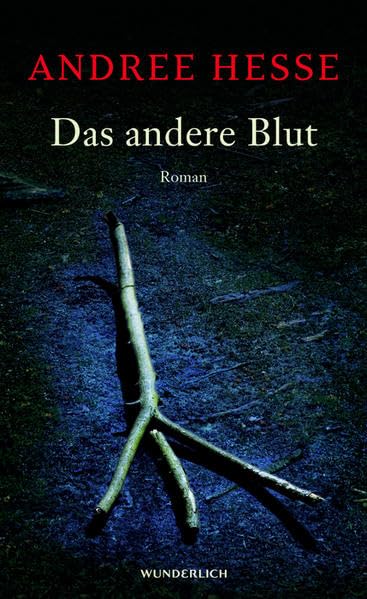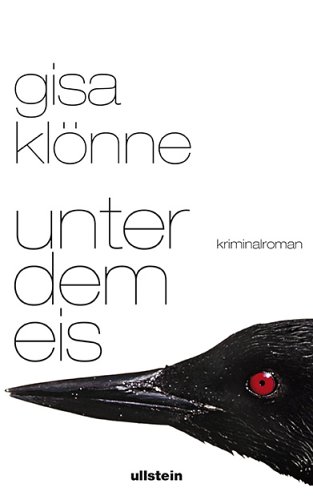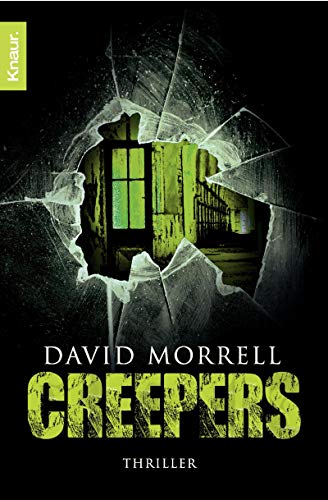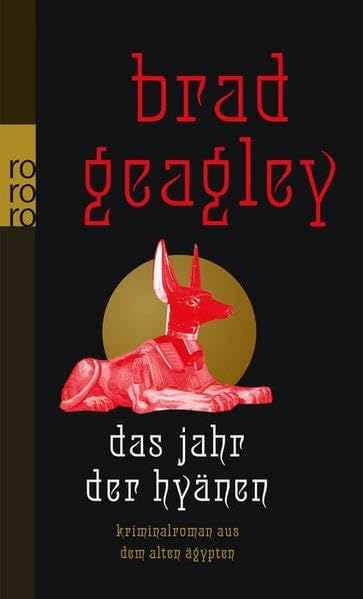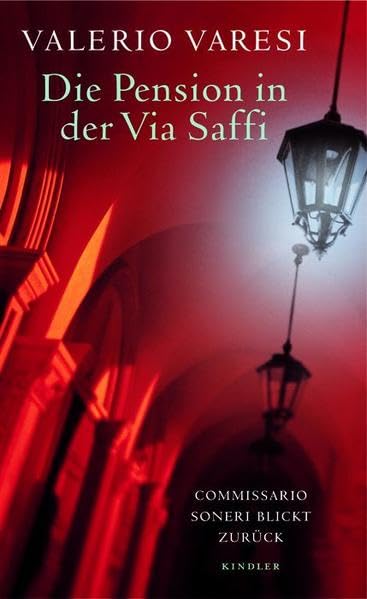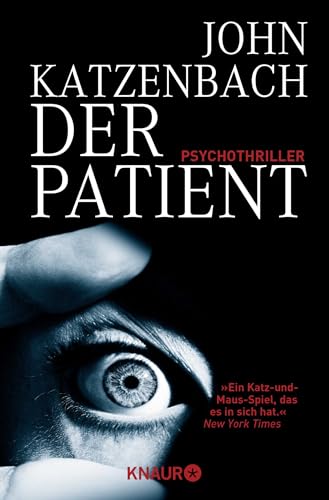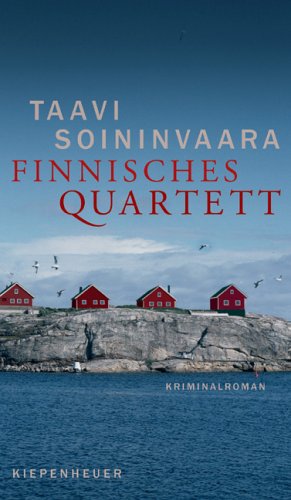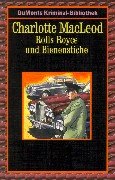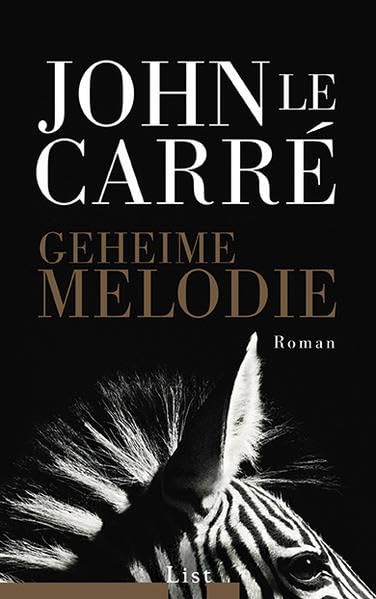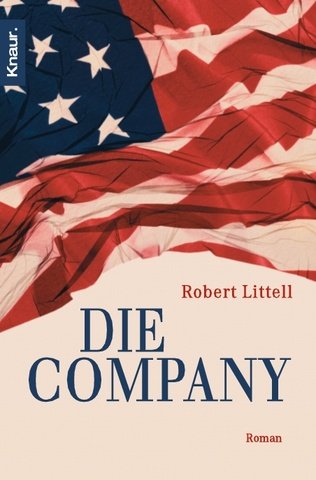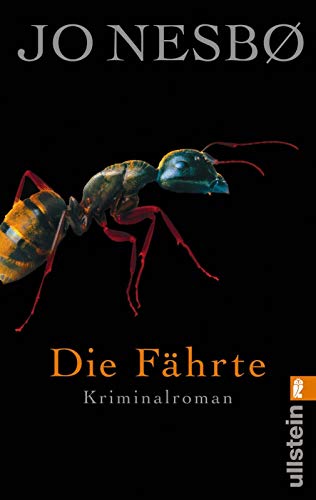_Anke Ahle und die Unkenntnis der Formel-1-Regeln_
Die Fachwelt der Formel 1 ist nicht unbedingt überrascht, dass der französische Nachwuchsfahrer Jean-Luc Dalesasse 1996 einen Formel-1-Vertrag bei dem britischen Williams-Team unterschreibt. Deren Topfahrer und Vorjahres-Weltmeister Joe Cheap war zu Ferrari gewechselt.
Dalesasse kommt mit dem raubeinigen technischen Leiter John nicht gut klar, reklamiert bei ihm viele Schwächen des Fahrzeugs, doch der Ingenieur will davon nichts hören. Auf Dauer muss er sich aber sehr wohl mit den technischen Aussagen von Dalesasse auseinandersetzen, spätestens nachdem der Rennfahrer in seinem ersten Grand Prix gleich den vierten Platz einfährt!
Es dauert nicht sehr lange, bis Jean-Luc seinen ersten Formel-1-Sieg feiert und zum Jäger des in der WM erneut führenden Joe Cheap wird.
Auch beim Grand Prix von Monte Carlo läuft alles prima: Dalesasse startet von ganz vorne und fährt einen grandiosen Sieg ein. Der Fürst von Monaco gratuliert ihm, doch direkt danach muss der Racer nebst Teamchef zur Rennleitung. Ihnen wird eröffnet, dass die Benzinprobe des Williams verbotene Zusatzstoffe beinhalte. Der Sieg und die 10 WM-Punkte werden Jean-Luc gestrichen.
Jean-Luc wittert Sabotage und fühlt sich ein Rennen später, beim Grand Prix von Spanien, bestätigt: Wieder auf die Pole Position gefahren, reicht ihm eine Frau Augentropfen, die jedoch zu einer mittelfristigen Sehstörung führen. Die Frau sagt nur, er dürfe wegen Sabotage nicht starten und gibt sich später als die – man höre und staune – Pressesprecherin des Konkurrenzteams Ferrari aus. Tatsächlich kann Jean-Luc nicht starten, und stattdessen springt ein Testfahrer für ihn ein und startet an dessen Stelle von Startplatz 1 (hierzu später mehr: dies ist in der Formel 1 überhaupt nicht möglich). Wie die Unbekannte prophezeite, verunglückt der Ersatzfahrer durch eine defekte Bremsscheibe und verliert sein Leben.
Sue, so heißt sie, ist die Tochter eines englischen Bremsanlagenherstellers, der Großteile der Formel 1 belieferte. Ein Jahr zuvor verunglückte bereits ein Fahrer tödlich durch einen Bremsdefekt. Sues Vater wurde als jener hingestellt, der dies ggf. zu verantworten hat, so dass dieser sich aus dem Rennsport zurückzog. Sue indes ist der Meinung, dass der 1995 verunglückte Fahrer nur deshalb aus dem Weg geräumt werden sollte, damit man ihn loswerde: Bei einer Kündigung im ersten Jahr hätten 20 Millionen Sponsorengelder zurückgezahlt werden müssen, bei „Tod“ gab es keine Klausel. Und man wollte einen Top-Piloten!
Warum aber soll dann auch plötzlich Top-As Jean-Luc Dalesasse durch eine Sabotage aus dem Rennzirkus wieder verschwinden? Gemeinsam mit Sue recherchiert er und fährt trotz der Angst vor Sabotage weitere Rennen, stets den WM-Titel ehrgeizig vor Augen …
Anke Ahle ist als Autorin bislang wenig bekannt. Das Buch verrät über sie, dass sie 1969 in Gummersbach geboren wurde und aus einer motorsportbegeisterten Familie stammt. Bisher veröffentlichte sie mehrere wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Archäologie, lebt aktuell in Köln und betreibt mit ihrem Ehemann einen Online-Versandhandel für Bücher und CDs.
_Schlechter Eindruck_
Fangen wir mit dem unschönsten Teil des Buches an, der Unkenntnis von Regeln der Formel 1: ich verweise auf die Situation, dass Jean-Luc Dalesasse beim GP von Spanien auf Startplatz 1 steht, er kurz vor dem Rennen quasi „ausfällt“ weil er Sehstörungen durch manipulierte Augentropfen hat. Statt seiner sitzt plötzlich ein Ersatzfahrer des Teams im Auto, zudem auf dem Startplatz 1. Schlimm genug, dass er dann bei einem Unfall stirbt. Leider verdirbt Anke Ahle kurzzeitig den Lesespaß durch diese an den Haaren herbeigezogene Situation, insbesondere bei der Berücksichtigung des Formel-1-Reglements anno 1996:
a) Ein Rennfahrer kann laut Reglement nicht kurz vor Startbeginn „ersetzt“ werden.
b) Ein Ersatzfahrer oder „dritter Fahrer“ (siehe z. B. Alexander Wurz oder Anthony Davidson …) müsste wie z. B. 2005 oder 2006 Rennrunden zur Qualifikation drehen. Dies war 1996 in der Form nicht vorgesehen, und wenn, dann dürfte er höchstens von seinem erfahrenen Startplatz starten, nicht aber ersatzweise die Pole Position einnehmen. Aber 1996 durften zudem nur zwei Autos je Team starten, und selbst Fahrer zwei behält seine Startposition und rückt nicht auf.
Wer sich nicht sonderlich für Rennsport interessiert, wird diesen fatalen Schnitzer überlesen, wer aber in unserem Schumi-Land Formel 1 kennt und versteht, stolpert sofort über diesen Fauxpas, der zunächst den Spaß am Weiterlesen leicht hemmt. Anke Ahle hätte es sich viel einfacher machen können: Testfahrten in xyz; wie auch immer konstruiert, wird Dalesasse nicht im Monoposto sitzen und an seiner Stelle der „Testfahrer“, der dann in der Tat durch die genannte „Sabotage“ tödlich verunglückt. Das wäre logisch, das wäre glaubhafter.
_Eindrücke_
Trotz der harschen Worte zu dieser Problemstelle, die das Lesen zunächst mehr in dann bald verfliegenden Ärger umschlagen lässt, bleiben der Roman und der Hintergrund, warum Dalesasse auch durch Sabotagen gefährdet ist, hochinteressant. Zumindest das … In jedem Fall, und das Wort passt, ist der Roman von Anke Ahle sehr intelligent konstruiert! Auch hier ein „zumindest DAS …“.
Auffällig ist auch ihr flüssiger, angenehmer Schreibstil. Leider sind viele Situationen aber zu nüchtern beschrieben bzw. es schwankt: Zum Ambiente von Monte Carlo fallen ihr prägnante Worte ein, bei den anderen Rennstrecken geht sie staubtrocken zur Story über. Alle Szenarien sind oberflächlich und leider schwach an Eindrücken.
Ein Motorsportfreund wird daher in vielen Lesepassagen die typische Rennatmosphäre gänzlich missen. Andererseits: Anke Ahle verzettelt sich nicht in breiten Umschreibungen der Rennszenerie, so dass sich auch ein in Sachen Motorsport Unbedarfter angesprochen und zum Lesen animiert fühlen kann. Es ist diese Wie-man-es-macht-macht-man-es-verkehrt-Situation.
Klar ist, dass der Roman weniger für einen Motorsportfan geeignet ist, auch wenn – abgesehen von dem beschriebenen Patzer – Anke Ahle durchaus allgemeine Motorsportkenntnisse besitzt und diese auch umsetzt. Aber die Darsteller bleiben ein wenig uncharismatisch, da ist für den rennsportbegeisterten Leser „kein echter Benzingeruch in der Luft“. Wer indes unvoreingenommen und an Motorsport wenig interessiert ist, wird ganz klar eine solide, intelligent konstruierte und spannende Geschichte auf 223 Seiten entdecken. Kenner der Szene werden sich indes die Haare raufen.
_Fazit_
Was macht diesen Roman aus? Er spricht Motorsportfans alleine durch den Titel an.
Und dann die Enttäuschung: Die Darsteller sind farblos, die Story erinnert eher an eine zusammengezimmerte Chronologie. Das reicht im Grunde bereits, den Roman nicht mit Freude zu lesen.
Aber dann kommt noch die Unkenntnis der Autorin Anke Ahle hinzu: In einem Kapitel beschreibt sie, dass der Star der Formel 1 unmittelbar vor dem Start durch manipulierte Augentropfen nicht starten kann und dann „hopplahopp“ der Testfahrer in den Wagen springt und auch noch von der Pole Position startet. DAS gibt es im Motorsport nicht, es ist schlicht an jedem Reglement vorbei zusammenphantasiert und verärgert den kompetenten Leser.
Wer sich trotz solcher Schnitzer durch das Buch weiterquält, wird eine intelligente, aber schlecht realisierte Story entdecken. Das nenne ich Geldverschwendung, und ich wäge sorgfältig ab, bevor ich ein Buch unterm Strich schlicht miserabel nenne …
http://www.kbv-verlag.de