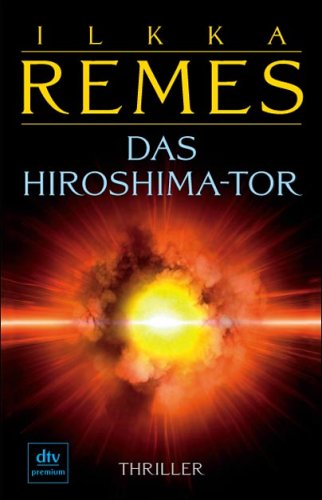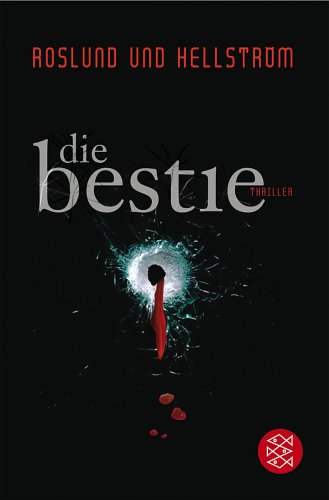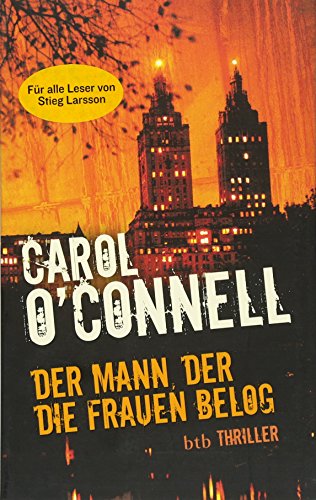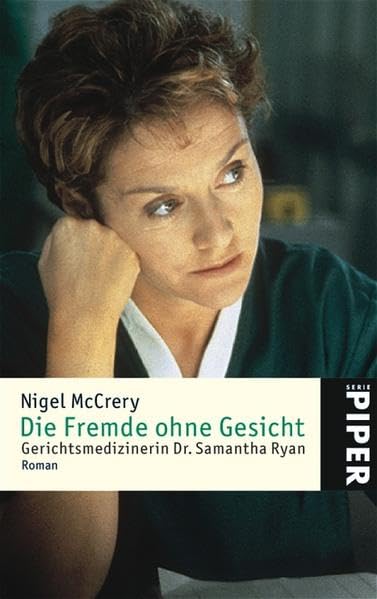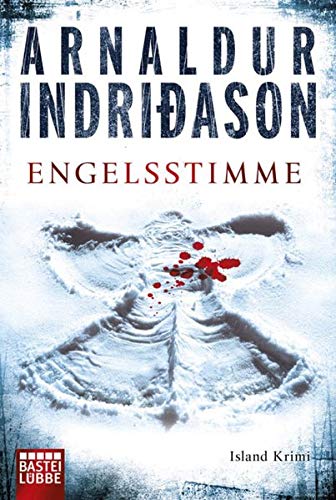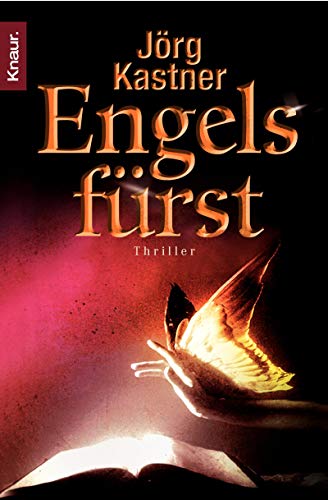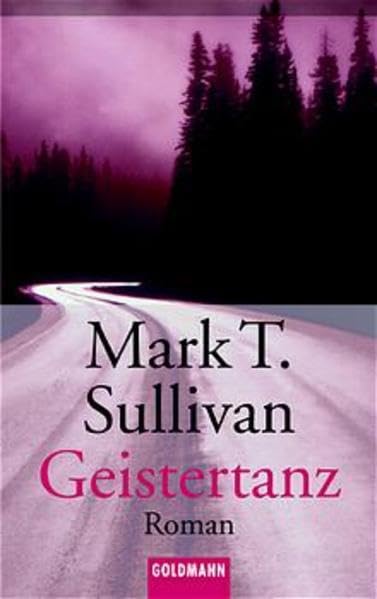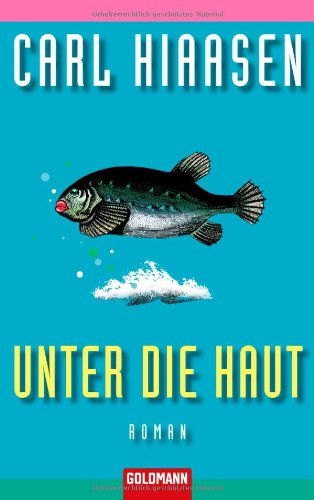Nach [„Ewige Nacht“ 2039 öffnet der finnische Erfolgsautor Ilkka Remes in seinem zweiten auf Deutsch übersetzten Hochspannungsthriller das „Hiroshima-Tor“, welches die ganze Menschheit bedrohen kann. In packender und rasanter Weise schildert er die Hetzjagd zweier großer Nationen nach einem schier unglaublichen Geheimnis …
Auf der Pariser Brücke Pont Marie wird Tanja das Opfer eines Handtaschenraubs, doch enthält ihre Handtasche mehr als nur einen Lippenstift und einen Handspiegel – Tanja sprintet dem Dieb also hinterher. Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse, die Handtasche wird von der Brücke aus in die Seine geworfen und Tanja springt angesichts des wertvollen Tascheninhalts hinterher. Allerdings ist Tanja nicht die Einzige, die hinter dieser Handtasche her ist, denn sie wird später tot geborgen, ihr wurde die Kehle aufgeschlitzt.
Timo Nortamo arbeitet für eine Antiterroreinheit in Brüssel und sucht dort für seine Frau Soile und den gemeinsamen Sohn Aaro ein Haus, doch ahnt Timo noch nicht, dass seine Frau, die als Physikerin am Schweizer CERN arbeitet, bereits eine Affäre mit einem Kollegen hat; dementsprechend wenig Freude zeigt sie angesichts des auserwählten Hauses. Noch bei der Hausbesichtigung wird Timo durch einen wichtigen Anruf gestört, denn der Bau eines Atomkraftwerkes und einer Endlagerungsstätte wurde ernsthaft sabotiert, aber damit nicht genug, erfährt Timo Nortamo bald auch von den seltsamen Ereignissen in Paris, die für ihn bald das Ende seiner Karriere bei der Antiterrorgruppe bedeuten werden.
Nicht nur zwei verschiedene Nationen jagen dem Inhalt der ominösen Handtasche hinterher, sondern auch Timo Nortamo, der auf eigene Faust ermittelt und dabei einige Grenzen überschreitet. Sein einziges Ziel ist es, die Echtheit der Unterlagen aus Tanjas Handtasche zu beweisen, die die finnische Präsidentin in Verruf bringen können. Eine Schnitzeljagd durch halb Europa geht los, die noch einige Opfer verlangen wird …
Ilkka Remes beweist von Anfang an, dass er ein Meister des Spannungsbogens ist. Bereits die erste Szene im Buch beginnt fulminant, als nämlich Tanja die wertvolle Handtasche entrissen und sie bei der Rettungsaktion ermordet wird. Schon diese erste Szene wirft etliche Fragen auf, die den Leser bewegen und an das Buch fesseln; doch damit nicht genug, eröffnet Remes weitere Handlungsstränge, von denen einige offenbar nur dazu dienen, seine Leser zu verwirren und auf eine falsche Fährte zu locken. Nur mühsam gelingt es, sich durch die komplizierten Handlungsebenen zu manövrieren und in diesem Labyrinth den richtigen Ausgang zu finden. Einige düstere Mächte sind an dieser Geschichte beteiligt, von denen nicht alle direkt mit der sagenumwobenen Handtasche und ihrem geheimnisvollen Inhalt zu tun haben.
So muss einmal festgehalten werden, dass „Das Hiroshima-Tor“ ein absolut atemberaubender Thriller ist, den man nur schwer aus der Hand legen kann und der über die ganze Strecke der 439 Seiten fesselt. Auf der anderen Seite muss man nach dem Zuklappen des Buches für sich erst einmal alle Handlungsfäden entwirren und genau auseinander halten, in welche Schublade eigentlich welche Handlungsebene gehörte, wer also direkt mit dem eigentlichen Thema des Buches zu tun hatte und wer sozusagen bloß als Rahmengeschichte und zur Verwirrung diente. Diese nebensächlichen Handlungsebenen blähen das Buch unnötig auf, was Remes eigentlich nicht nötig hat, da er überzeugend beweist, dass er für genug Spannung sorgen kann. Meiner Meinung nach hätte er ruhig geradliniger schreiben können. Insbesondere die gesamte Geschichte rund um die finnische Präsidentin ist im Nachhinein völlig überflüssig, sie bringt die eigentliche Handlung nicht voran und spielt sich größtenteils neben den entscheidenden Erlebnissen ab. Das trübt im Nachhinein schon etwas den Lesegenuss, weil das richtige Aha-Erlebnis, bei dem am Ende alle Handlungsfäden zusammengeführt werden, zwangsläufig ausbleibt.
Thematisch hangelt sich Ilkka Remes bedenklich nah an einem von Dan Brown bereits ausgelutschten Problem entlang, was hier als ziemlich müder (und leider auch überzogener) Abklatsch beim Leser ankommt, da einen das eigentliche Thema das Buches kaum vom Hocker reißen kann. Interessant ist allerdings der Weg, auf dem Remes sich diesem hochexplosiven Thema nähert, da hier menschliche Schicksale im Mittelpunkt stehen, die dafür sorgen, dass man beim Lesen einen dicken Kloß im Halse hat. Hier wird man als Leser gezwungen, sich mit einem wichtigen und erschreckenden Ereignis der Geschichte auseinander zu setzen, das zwar bereits etliche Jahre zurückliegt, uns aber auch heute noch betrifft. Eines muss man Remes lassen, er versteht es, seine Leser nicht nur zu unterhalten, sondern sie auch zum Nachdenken anzuregen.
Gelungen sind auch die wissenschaftsethischen Fragen, die Ilkka Remes in diesem Zusammenhang aufwirft. Zwei talentierte und hochintelligente Physikerinnen mit sehr unterschiedlichen Ansichten stehen sich hier gegenüber, von denen die eine – nämlich Heli – in Wissenschaftskreisen unter „ferner liefen“ gehandelt wird, weil sie zu wenig (bis gar nicht) publiziert, während die andere – Soile – zwar viele Artikel veröffentlicht, von Heli deswegen aber verachtet wird, weil diese der Meinung ist, dass Soile sich mit diesen Artikeln selbst verkaufen würde. Die Frage, was Wissenschaft eigentlich darf und auch die Frage nach der Verantwortung eines jeden Wissenschaftlers ist stets aktuell und wird es auch immer bleiben, sodass es sich absolut lohnt, darüber genauer nachzudenken. Schade nur, dass Remes am Ende etwas zu dick aufträgt und eine Märtyrerfigur kreiert, die kein würdiges Ende für diesen spannenden Thriller darstellt.
Die beiden konträren Positionen der Wissenschaftsethik werden dabei durch die beiden weiblichen Hauptrollen repräsentiert, sodass sich auch die Sympathien verteilen, je nachdem, welche Position man selbst zu dieser Frage einnimmt. Während Heli allerdings eine sehr radikale Position einnimmt, ist Soile der Meinung, dass man Wissenschaft nicht aufhalten kann, sie ist Forscherin aus Leidenschaft und möchte ihre Ergebnisse auch veröffentlichen, selbst wenn sie irgendwann eventuell einmal Schaden anrichten könnten. So richtig sympathisch werden einem beim Lesen eigentlich beide Damen nicht; die eine handelt zu überzogen und unrealistisch für eine hochintelligente Physikerin, während die andere durch ihre Untreue auch nicht gerade punkten kann.
Im Zentrum der Erzählung steht glücklicherweise Timo Nortamo, den man bei seinen Nachforschungen gerne durch ganz Europa begleitet, da man ihm stets wünscht, dass er Erfolg haben möge bei seiner Mission. Nortamo ist in diesem Thriller wirklich arg gebeutelt; während der Leser bereits weiß, dass seine Frau Soile eine Affäre hat, muss Timo selbst erst einmal verkraften, dass er von einer Minute auf die andere seinen Job verloren hat und er sich durch den Hauskauf schrecklich verschuldet hat. Durch die sympathische und interessante Hauptfigur gewinnt das Buch sehr; die Abschnitte über Timo Nortamo sind es, die uns bei der Stange halten und immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringen, da Ilkka Remes in all seinen anderen Handlungsebenen stets auf Verwirrung aus ist.
Unter dem Strich ist Ilkka Remes mit dem „Hiroshima-Tor“ durchaus ein überzeugender Thriller gelungen, der insbesondere in Sachen Spannung punkten kann. Wenn man das Buch einmal angefangen hat, kann man es eigentlich nicht mehr aus der Hand legen, da Remes einen immer wieder auf eine falsche Spur bringt und dadurch für Verwirrung sorgt. Leider ist dies auch schon ein Kritikpunkt, der festzuhalten ist, denn Remes eröffnet zu viele Handlungsstränge, die am Ende nicht konsistent zusammengeführt werden. Auf den einen oder anderen Nebenschauplatz hätte ich durchaus verzichten können, dann wäre das Buch wahrscheinlich sogar noch packender gewesen. Insgesamt gefällt das „Hiroshima-Tor“ allerdings sehr gut, insbesondere durch die vielen Aspekte, die den Leser zum Nachdenken anregen.
http://www.ilkka-remes.de/