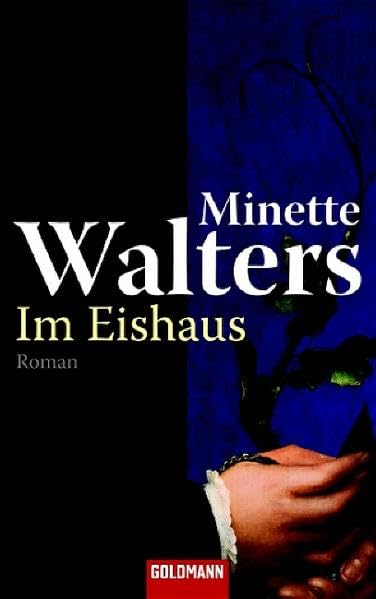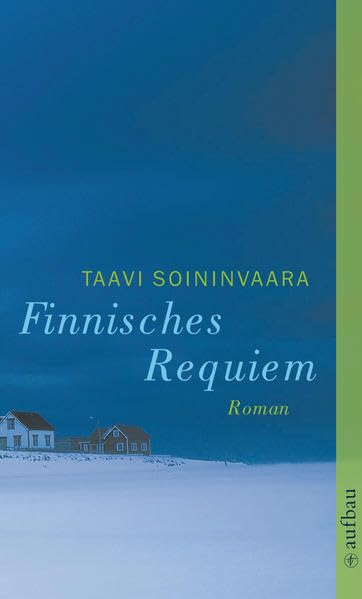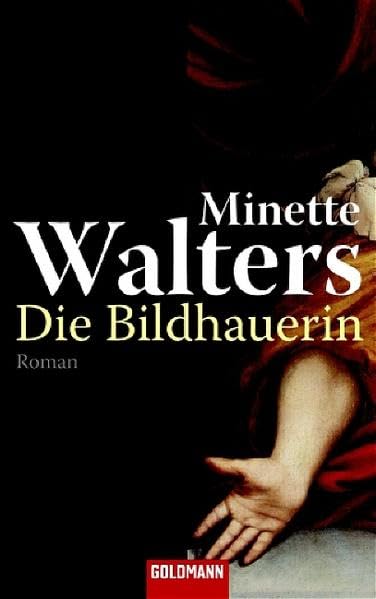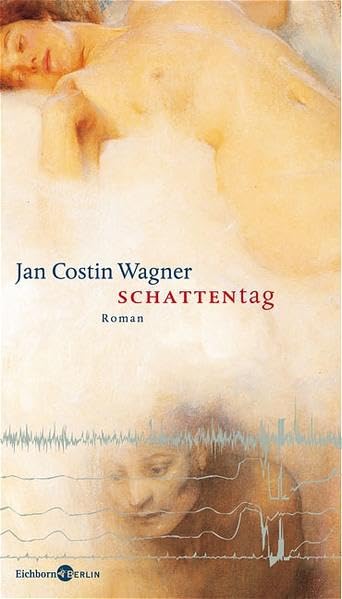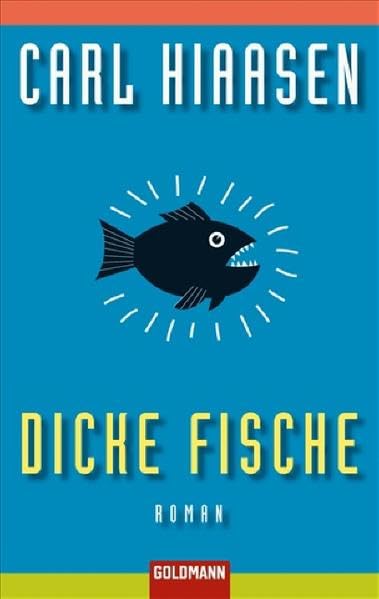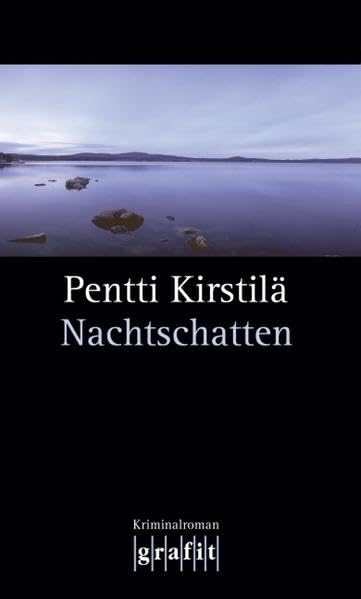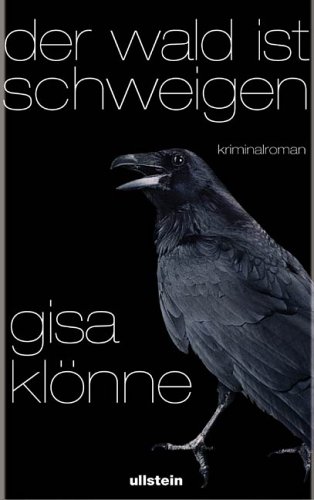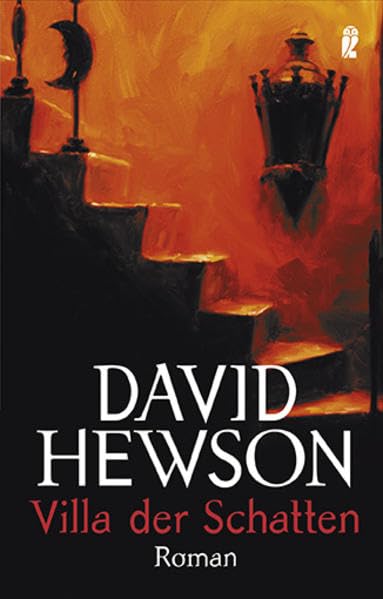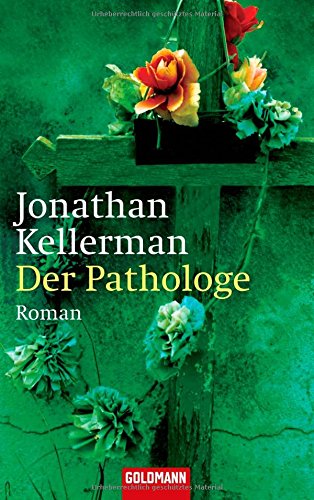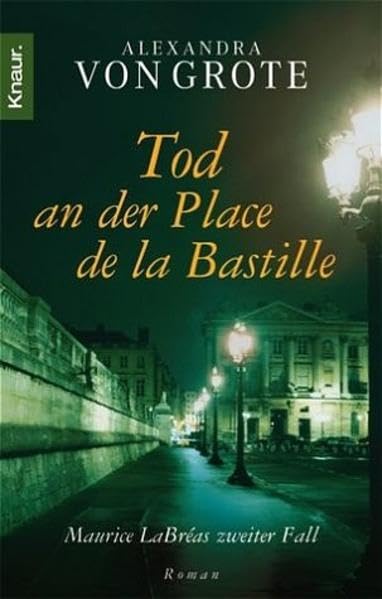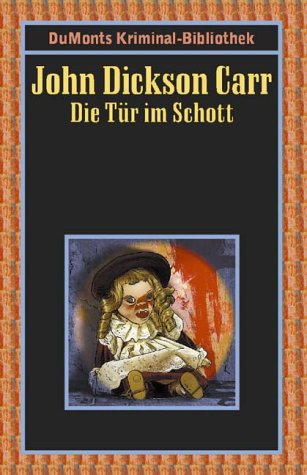Zu schade, dass ich den ersten Teil von „Blutzeichen“, „Bruderherz“ betitelt, noch nicht kenne. Ein Umstand, den ich nach dem Konsum von „Blutzeichen“ schleunigst ändern werde, da die literarische Niederschrift seelischer Abgründe aus der Feder von Blake Crouch fesselnder nicht sein könnte. Meine Herren! Selten zuvor habe ich ein Buch derart verschlungen und dabei mehr als nur Blut und Wasser geschwitzt.
Andrew Thomas, Schriftsteller, geriet im Erstling in die psychopathischen Fänge seines Zwillingsbruders Orson, denen er nur mit viel Glück entrinnen konnte. Orson ist tot und Andrew mittlerweile in Alaska abgetaucht, da er für die begangenen Morde verantwortlich gemacht und polizeilich gesucht wird. Eines Tages erfährt Andrew, dass seine Ex-Freundin bestialisch ermordet wurde und in ihm keimt ein böser Verdacht: Orsons Helfer muss zurück sein, um die Arbeit seines Mentors zu vollenden. Luther Kite ist wieder da, und er wird seinen Weg unbarmherzig zu Ende gehen, wenn sich ihm niemand in selbigen stellt.
So weit die Rahmenhandlung des schweißtreibenden Nervenkitzlers, uns spätestens nach dem ersten Drittel des Buches nicht mehr aus seinen Pranken entlässt. Dabei lässt die Eiseskälte, mit der Luther seine Arbeit verrichtet, ein ums andere mal die Magensäfte brodeln. Es sei also zartbesaiteten Personen abgeraten, sich auf „Blutzeichen“ einzulassen.
Nach einem relativ besinnlichen Beginn dreht Crouch im Verlauf des Buches erbarmungslos an der Spannungsschraube. Wann und wie wird der Psychopath zuschlagen? Was wird Andrew dem entgegen setzen können und wird er am Ende sein Leben lassen müssen? In düsterer, nein, abgrundtief finsterer Atmosphäre graben sich die Seiten ins Gedächtnis und man kämpft unweigerlich gegen den inneren Schweinehund an, der einem das Ende des Tages befiehlt, da man am nächsten Morgen in aller Herrgottsfrüh zur Arbeit muss. Ich konnte den Kampf eigentlich immer gewinnen, verschlang „Blutzeichen“ gierig bis zum Ende der Storyline. Und die hat es in sich …
Blake Crouch versteht es blind, eine psychologisch bedrückende Atmosphäre zu erschaffen, die im filmischen Sinne Meisterwerken wie etwa David Finchers „Sieben“ in nichts nachsteht. Desillusionierende Alltagsszenarien, Düsternis, Regen und ein Held, der scheinbar übermächtigen Gegebenheiten immer einen Schritt hinterherzuhinken droht. Nichts kann Luther aufhalten! Oder etwa doch?
„Blutzeichen“ ist eines dieser Bücher, die ich Thrillerfans blind ans Herz legen kann. Die Zeichen und Worte spielen geschickt auf der Klaviatur des Grauens und wälzen sich flächendeckend in der Bildsprache des Ekels. Hier ist ein kleiner Minuspunkt zu verzeichnen. Denn auch wenn ich die plastische Darstellung von exzessiver Gewalt als durchaus sinnvoll und dramaturgisch wirksam empfinde, denke ich dennoch, dass „Blutzeichen“ für das Gros der Leserschaft eine deutliche Spur zu heftig ist. Denn „Blutzeichen“ ist ein Paradebeispiel für literarische Grausamkeit und Brutalität in Wort und Schrift.
Wer einen starken Magen hat, nachts gut schlafen kann und mal wieder Bock auf eine wirklich deftige Thriller-Schlachtplatte hat, sollte die paar Kröten auf jeden Fall ausgeben und sich in eine Parallelwelt des Grauens schießen lassen, der man am besten in einem Lesemarathon am Stück erliegt. Ein Tipp noch am Rande: Kauft euch auch gleich noch den Erstling „Bruderherz“. Selbiges werde ich jetzt jedenfalls auch tun!
http://www.ullsteinbuchverlage.de/ullsteintb/