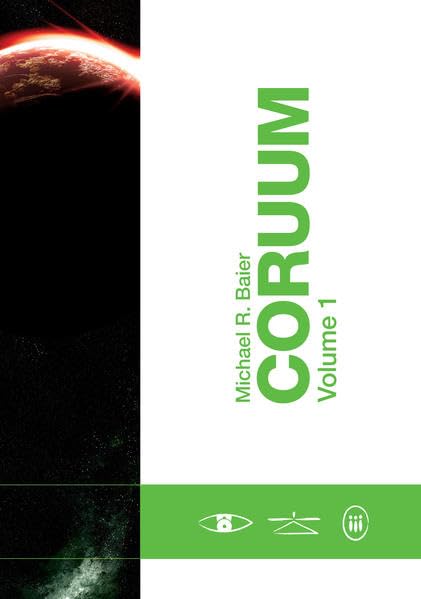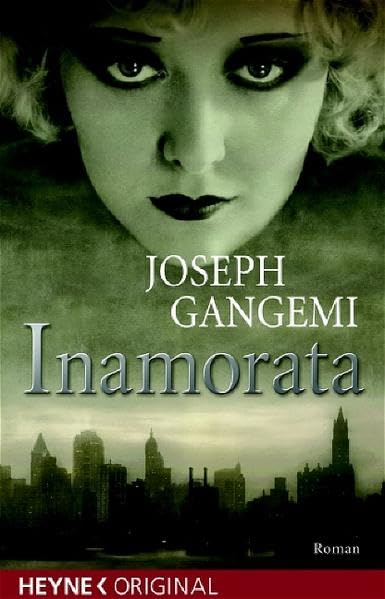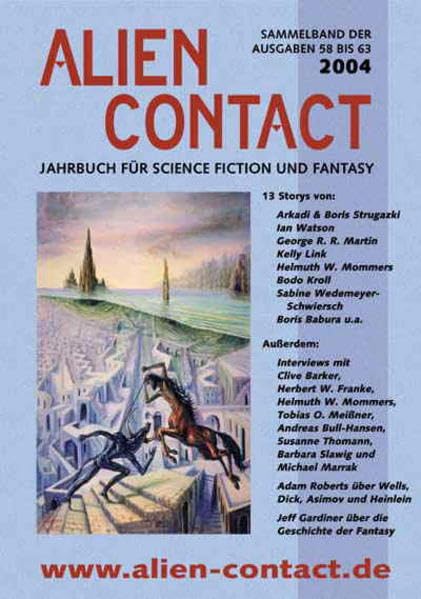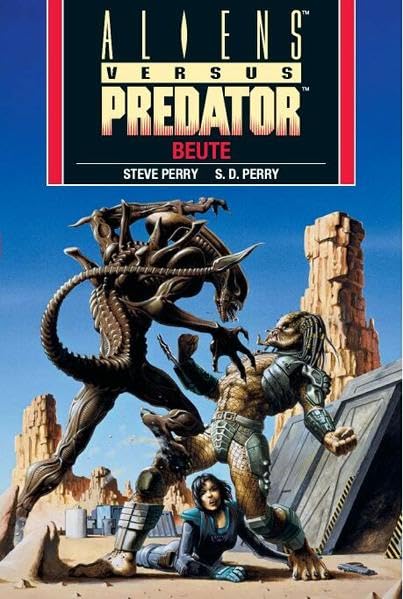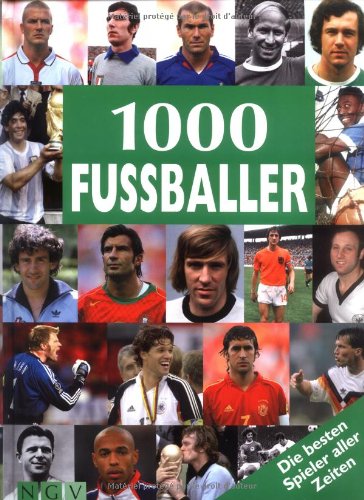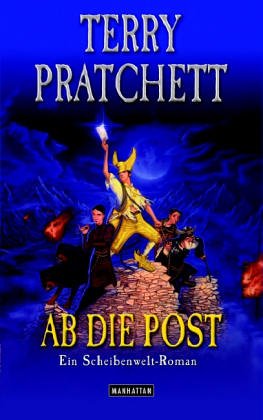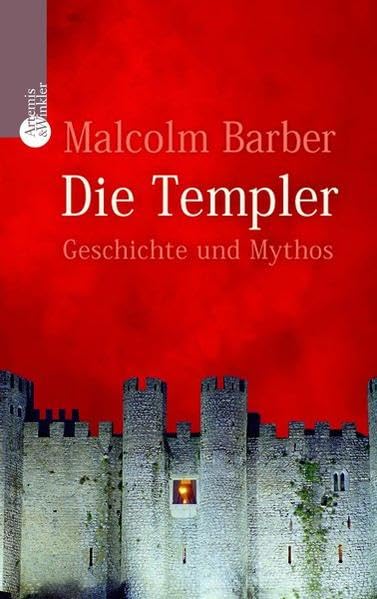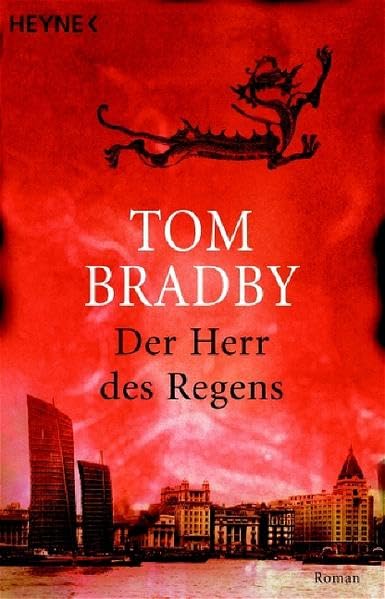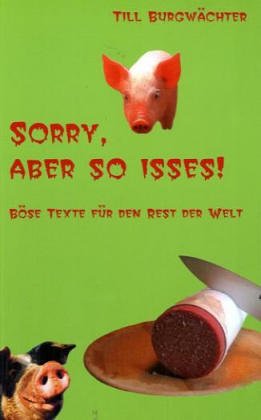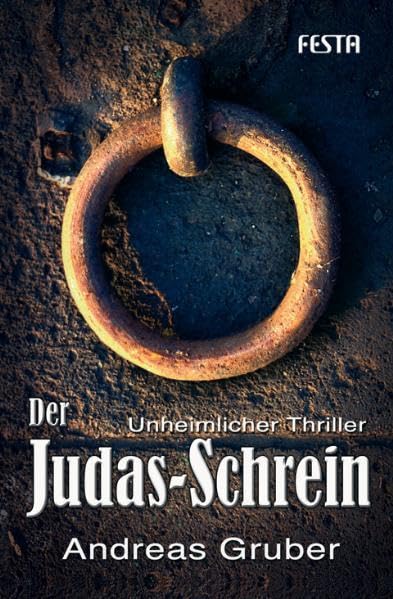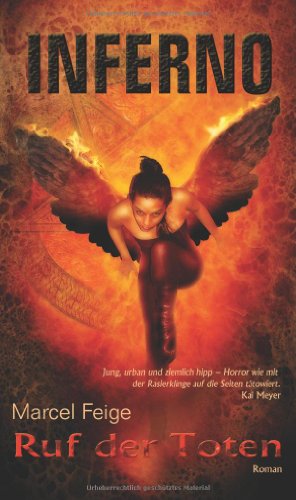Bereits während seiner Studentenzeit hat Michael R. Baier die Idee zu „Coruum“ gehabt und diese nach und nach weiterentwickelt, bis er dann schließlich eine komplette Trilogie hat reifen lassen, die auch den Beinamen YLIS (Your Life In Space) trägt. Weil ihm die Herausgabe seines Romans (natürlich) ein sehr großes Anliegen war, sich aber erst einmal kein Vertrieb gefunden hat, hat sich der Autor ein Herz gefasst und „Coruum“ in Eigenreigie – allerdings auf tausend Exemplare limitiert – selber auf den Markt gebracht. Daher ist bei Interessenten, von denen es bei diesem vorzüglichen Science-Fiction-Trip sicherlich genügend geben sollte, Eile angesagt; zum einen, weil die Bücher sonst vergriffen sind, bevor man sich auf die Suche macht, und andererseits, damit sich schon bald jemand findet, der die Trilogie großflächig vertreibt und so auch einem breiteren Publikum zugänglich macht. Potenzial ist nämlich definitiv geboten.
_Story_
Ein Forscherteam entdeckt bei einer Serie von Ausgrabungen eine seltsame Maya-Stele, auf der die Archäologen neben bekannten Hieroglyphen auch fremde Symbole finden. Bevor man diese jedoch näher erforschen kann, kommt es zu einem tragischen Zwischenfall, bei dem Dr. Pete Williams, der Entdecker der Stele, ums Leben kommt.
Karen Whitewood, die Leiterin des Projekts, bindet aufgrund der prekären Situation ihren alten Freund Donavon MacAllon in die Untersuchungen ein. MacAllon, ein alter Studienkollege von Kareen, gilt nämlich als einer der weltweit fähigsten Experten auf dem Gebiet altertümlicher Schriften und Kalendersysteme und ist sofort Feuer und Flamme für diesen Einsatz, zumal er auch auf persönlicher Ebene eine ganz besondere Verbindung zu Karen hat.
Das Team entdeckt schließlich eine uralte, geheime Kammer und stöbert dort eine hochmoderne Bibliothek auf, die Donovan und Karen vor ein kolossales Rätsel stellt. Außerdem wissen sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass durch ihren Eingriff in diesen Raum eine Hologrammbotschaft losgeschickt wird, die in einer anderen Welt für Aufruhr sorgen soll. Doch weil auch das CIA an den seltsamen Funden interessiert ist, schöpfen die beiden bereits Verdacht, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht …
Währenddessen herrscht in der Region des Roten Nebels Alarmbereitschaft. Dort ist nämlich eine Botschaft von einem bis dato unbekannten Planeten eingetroffen. In diesem Gebiet leben drei mächtige Verbände nebeneinander, die allerdings vollständig unterschiedliche Interessen verfolgen. Im Mittelpunkt stehen dabei die konträren Ansichten des Zentrums, einer Handelsorganisation, der zudem die Kampfeinheit Z-Zemtohy angeschlossen ist, und der Sieben Königshäuser, die sich auf die Forschung und das Bilden einer Militätmacht spezialisiert haben. Quasi als neutraler Vermittler steht zwischen ihnen die Kirche, die zwar in Form eines Ritterordens auch eine Art Heer etabliert hat, im Grunde genommen aber eher die Rolle der intellektuellen Schicht einnimmt.
Als nun diese mysteriöse Botschaft eintrifft, droht der Frieden zwischen den drei Mächten endgültig zu zerbrechen. Sowohl die Fraktion der Königreiche als auch Entsandte des Zentrums erpressen aus Vertretern der Kirche das Wissen um die unbekannte Erde und machen sich auf den Weg zu dem plötzlich ins Bewusstsein gerückten Planeten. Beide haben ähnliche Ziele, wobei besonders das Zentrum die Hinterlassenschaften der eigenen Vergangenheit auf der Erde beseitigen möchte. Vor Ort eskaliert schließlich der Konflikt zwischen den außerirdischen Parteien, und mitten in der Auseinandersetzung zwischen Zentrum und den Sieben Königshäuser drohen Donavon, Karen und ihr Forschungsteam zu hilflosen Spielbällen der verfeindeten Mächte zu werden …
_Meine Meinung_
Wie so oft, wenn ein Autor auf einen eher einfachen Schreibstil zurückgreift, setzten sich auch zu Beginn dieses ziemlich langen ersten Teils der „Coruum“-Saga erste Bedenken in Gang, denn schließlich ist die Schreibtechnik ja zur Erschaffung eines spannenden Plots von einer nicht zu unterschätzenden Bedeutung. Hinzu kommt, dass sich Michael R. Baier mächtig viel Zeit lässt, um den Hauptcharakter Donavon vorzustellen und dessen Beschreibung als ‚echten, traditionellen Schotten‘ bisweilen etwas langatmig wirkt, gerade wenn man bedenkt, dass das Erzähltempo auf den ersten Seiten schlichtweg rasant ist und die hier kreierte Spannung sofort wieder ihren Effekt einbüßen muss.
Richtig in Fahrt kommt die Geschichte daher erst nach circa hundert Seiten und somit auch erst ab dem Moment, an dem die fremden Mächte in die Handlung eingreifen. Spätestens hier wird dann aber auch klar, welches komplexe Konstrukt sich Baier für seine Erzählung ausgedacht hat und wie tiefgreifend die vielfältigen Konflikte zwischen den einzelnen Völkern tatsächlich sind. Schon fühlt man sich wieder besänftigt und versteht, warum es mitunter etwas länger dauert, bis man dann mit allen Charakteren und Gruppierungen vertraut gemacht wurde, und warum auch schon mal die Hälfte des Buches verschlungen werden muss, um die komplexe Vorgeschichte halbwegs zu begreifen.
Und dennoch fällt es auch im weiteren Verlauf des Buches nicht gerade leicht, die einzelnen Verstrickungen auf Anhieb zu verstehen und einzuordnen, was der Spannung von „Coruum“ aber in diesem Falle erheblich zugute kommt. Der Autor lässt sich sehr viele Freiräume, durch die wiederum eine Vielzahl von Optionen für die Fortsetzung der Handlung entsteht, und trotzdem wird das Ganze nie zu verworren, weil Baier die nötige Ruhe mitbringt und die einzelnen Puzzlestücke nach und nach miteinander verbindet. Sollte also beim Leser irgendwie Hektik entstehen bzw. das Verständnis verloren gehen, liegt das sicherlich nicht an der Art und Weise, wie der Autor die Geschichte voranfließen lässt.
Das Entscheidende an „Coruum“ ist aber die Vielzahl von neuen Elementen, die Baier in die bekannten Elemente seiner Science-Fiction-Story einbettet. Gerade die Darstellung der menschenähnlichen Weltraumwesen ist ihm hierbei vorzüglich gelungen. Zwar findet man auch hier eine arg kriegerische Rasse Außerirdischer vor, doch ihre überaus humanen Züge und die sehr eigenwillige Kultur sind Neuland, ebenso wie die Einbeziehung einer Kirche als gebildete, höhere Macht, der aber in dieser Geschichte weitestgehend die Hände gebunden sind. Zudem hat „Coruum“ auch Thrillercharakter, was sich durch die Vorgeschichte der einzelnen Völker ergibt. Michael R. Baier vermischt hier verschiedene Versatzstücke aus Science-Fiction, Fantasy, historischem Roman und Mystery-Thriller zu einer fortschrittlichen Einheit, die in ihrer Verbindung überraschend gut funktioniert – wahrscheinlich, weil die ausschweifenden Darstellungen nie in irgendeiner Weise abgehoben oder unnatürlich erscheinen.
Trotz der zahlreichen Verbindungen ist die Geschichte nämlich sehr bodenständig und lässt sich nie als reine Science-Fiction identifizieren; der Bezug zur Realität ist dafür einfach zu oft gegeben, und das ist ein zusätzlicher Reiz, deren Wirkung erstaunlich groß ist.
Auch wenn der erste Roman noch sehr viele Fragen aufwirft, kann man sich bereits gewiss sein, dass hier noch etwas Großes auf den Leser wartet. Nach fast 600 Seiten hat der Plot gerade erst so richtig begonnen, und durch das recht abrupte und gemeine Ende ist der Wunsch, sehr bald mehr über „Coruum“ in Erfahrung zu bringen, recht groß. Bis dahin bleiben erst einmal nur ein Blick auf die [Homepage]http://www.coruum.com des Projekts und ein sehr überzeugender Eindruck als ‚Trost‘. Eine Information dazu am Rande: Diese erste Auflage ist fast ausverkauft und wird ab März neu lektoriert und neu gedruckt sowie mit leicht verändertem Cover auf den Markt kommen.
Michael Baier hat es jedenfalls geschafft, den Leser mit einfachen erzählerischen Mitteln und einer klug verflochtenen Erzählung aus der Reserve zu locken. Nach der Pflicht folgt jetzt hoffentlich schon bald die Kür!