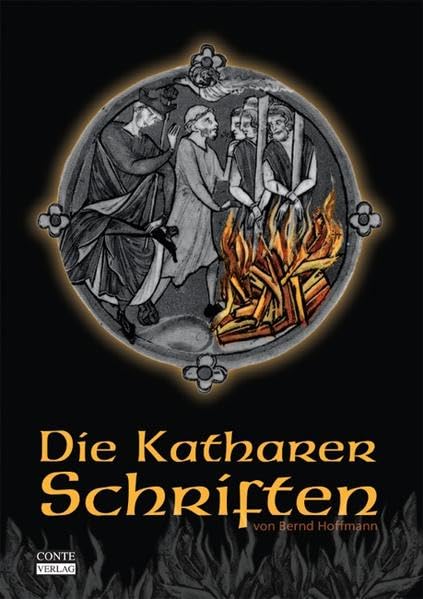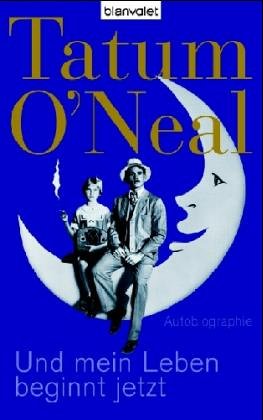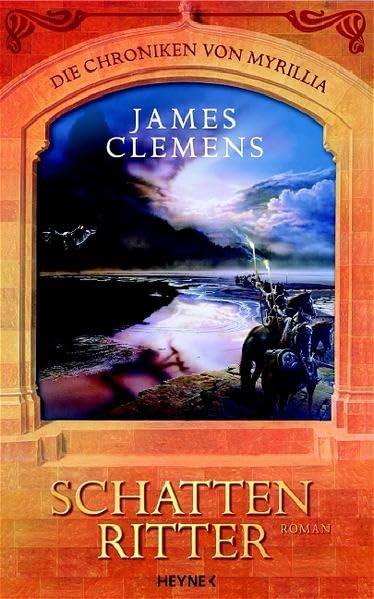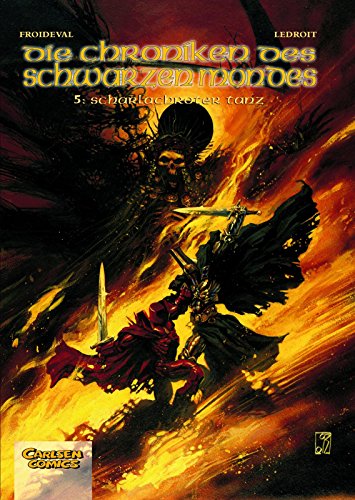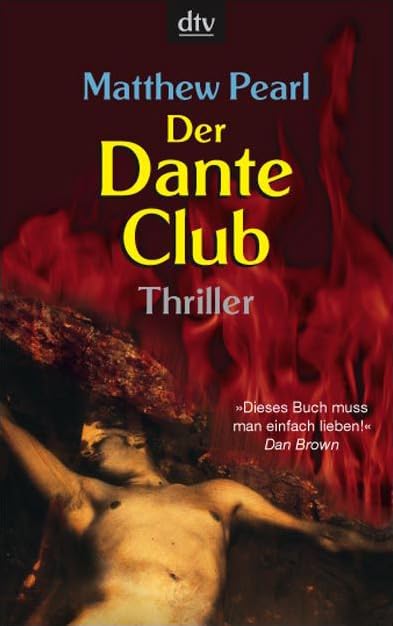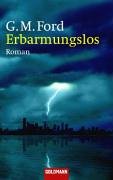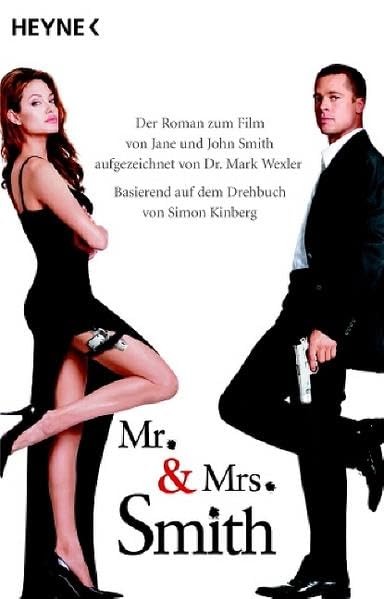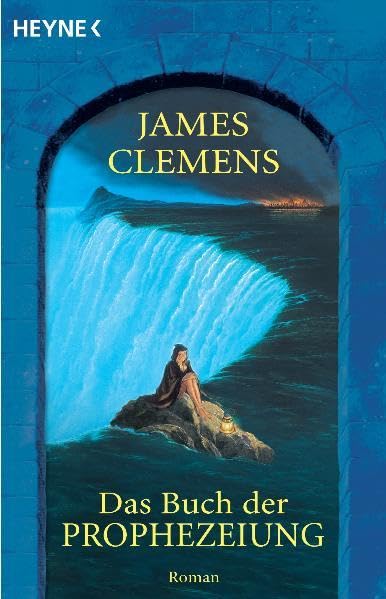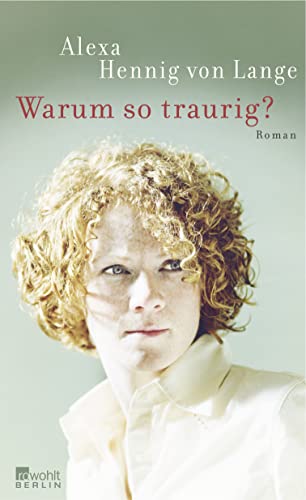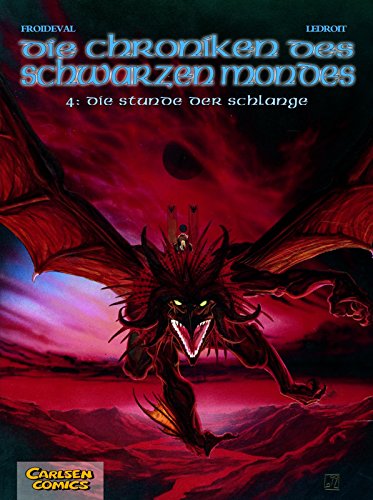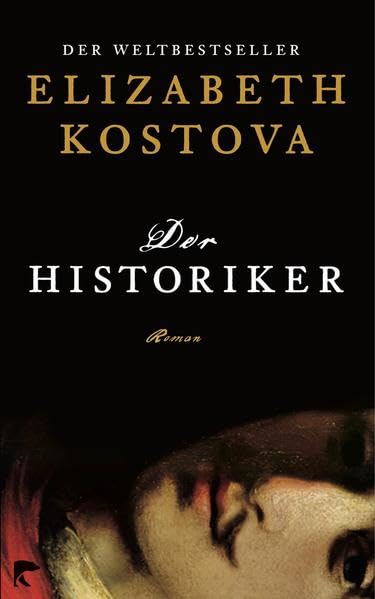_Verlagsinformationen zu Buch und Autor:_
|Die Welt, ein Narrenturm – Teil eins der polnischen Bestseller-Trilogie um den schlesischen Medikus Reinmar von Bielau, in dem wir erfahren, dass er sich auf der Flucht befindet, einerseits der Liebeskunst wegen, aber auch vor der Inquisition.
Schlesien, im Jahr des Herrn 1422: Reinmar von Bielau »hieb seinem Grauschimmel die Fersen in die Weichen, ritt im Galopp über die blühende Heide auf die waldbestandene Anhöhe zu, hinter der er segenbringende, ausgedehnte Wälder vermutetete«.
Der junge Medikus, von seinen Freunden auch Reynevan genannt, ist auf der Flucht vor seinen Häschern. Der Liebe wegen, genauer gesagt, weil er in flagranti erwischt wurde, mit der schönen Adele von Sterz, Eheweib des sich gerade auf einem Kreuzzug gegen die feindlichen Hussiten befindenden Gelfrad von Sterz. Doch auch die Inquisition könnte sich für ihn interessieren, denn was man im heimatlichen Öls nach seinem stürmischen Abgang bei ihm findet, ist neben medizinischen Schriften so manches, das zumindest den Verdacht auf Hexerei aufkommen lassen könnte.
Der sündige Möchtegern-Lancelot hat also ernsthafte Probleme, vor allem, weil ihm Adele nicht aus dem Kopf gehen will.
So durchquert er auf dem Weg nach Breslau das damalige Mittel-Europa, begegnet dabei allerlei Volk, und auch der Narrenturm der Inquisition bleibt ihm nicht erspart, von dessen Warte aus die Welt bis heute einem einzigen Hauen und Stechen gleicht. Doch halt: Hatten die Chiliasten nicht vorausgesagt, die Welt würde im Februar des Jahres 1420 untergehen?
Andrzej Sapkowski, geboren 1948, ist Literaturkritiker und Schriftsteller. Sein Fantasy-Zyklus über den Hexer Gerald erreicht in Polen inzwischen Millionen-Auflagen und wurde 1998 mit dem Literaturpreis der wichtigsten polnischen Wochenzeitung ›Polityka‹ ausgezeichnet. Die Fortsetzung von ›Narrenturm‹, ›Bozy bojownicy‹ (dt.: ›Gottesstreiter‹), erschien 2004, beide Bände landeten auf Anhieb auf der Bestsellerliste und wurden mehr als hunderttausend Mal verkauft. Andrzej Sapkowski lebt in Lodz und arbeitet derzeit am dritten Band, ›Lux perpetua‹.|
_Leseprobe aus »Narrenturm« von Andrzej Sapkowski:_
PROLOG
Das Ende der Welt brach Anno Domini 1420 doch nicht herein. Obwohl vieles darauf hindeutete, dass es käme.
Die düsteren Prophezeiungen der Chiliasten, die den Weltuntergang ziemlich präzise – nämlich für das Jahr 1420, den Monat Februar und den Montag, der auf den Festtag der heiligen Scholastica folgte – angekündigt hatten, erfüllten sich nicht. Die Tage der Strafe und der Rache, die dem Herannahen des Königreiches Gottes vorangehen sollten, kamen nicht. Obwohl sich die tausend Jahre erfüllt hatten, wurde Satan nicht aus seinem Kerker befreit, und er trat auch nicht hervor, um die Völker an allen vier Enden der Welt zu betören. Weder gingen sämtliche Sünder dieser Welt und alle Feinde Gottes durch Feuer und Schwert, Hunger und Hagel, die Hauer der Bestie, den Stachel des Skorpions zugrunde, noch durch das Gift der Schlange. Vergeblich harrten die Gläubigen der Ankunft des Messias auf dem Tábor, dem Schafberg, auf dem Oreb, Sion und dem Ölberg, vergeblich harrten die |quinque civitates|, die fünf auserwählten Städte, als die Pilsen, Klattau, Laun, Schlan und Saaz galten, auf die Wiederkunft Christi, wie sie die Prophezeiung Jesajas verkündet hatte. Das Ende der Welt brach nicht herein. Die Welt ging nicht unter und brannte nicht. Zumindest nicht die ganze.
Trotzdem ging es recht kurzweilig zu.
Köstlich, diese Biersuppe, in der Tat. Dick, würzig und reichlich geschmalzt. So eine habe ich lange nicht mehr gegessen. Ich danke Euch, werte Herren, für die Bewirtung, ich danke auch dir, Schankwirtin. Ihr fragt, ob ich ein Bier verachten würde? Nein, gewiss nicht. Wenn Ihr erlaubt, dann mit Vergnügen. |Comedamus tandem, et bibamus, cras enim moriemur|.
Der Weltuntergang kam also 1420 nicht, auch nicht ein Jahr später, nicht zwei, nicht drei, und auch nicht vier Jahre später. Die Dinge nahmen, wenn ich so sagen darf, ihren gewohnten Verlauf. Die Kriege dauerten an. Die Seuchen mehrten sich, die |mors nigra| wütete, Hunger breitete sich aus. Der Nächste erschlug und beraubte seinen Nächsten, begehrte dessen Weib und war überhaupt des Menschen Wolf. Den Juden bescherte man von Zeit zu Zeit ein kleines Pogrom und den Ketzern ein Scheiterhäufchen. An Neuheiten hingegen war dieses zu vermelden: Skelette hüpften mit lustigen Sprüngen über die Friedhöfe, der Tod schritt mit seiner Sense über die Erde, der Inkubus stahl sich des Nachts zwischen die zitternden Schenkel der Jungfrauen, und dem einsamen Reiter sprang in der Einöde eine Striege in den Nacken. Der Teufel mischte sich sichtbar in die Alltagsangelegenheiten ein und strich unter den Leuten umher, |tamquam leo rugiens|, brüllend wie ein Löwe, und Ausschau haltend, wen er verschlingen könnte.
Viele berühmte Leute starben in jener Zeit. Ja gewiss, es wurden auch viele geboren, aber es ist wohl so, dass man die Geburtsdaten in den Chroniken nicht verzeichnet und sich dann auch ums Verrecken keiner daran erinnert, außer den Müttern vielleicht, und Ausnahmen machten wohl nur Neugeborene mit zwei Köpfen oder wenigstens mit zwei Pimmeln. Aber was den Tod anlangt, ja, das ist ein sicheres Datum, wie in Stein gehauen.
Im Jahre 1421, am Montag nach dem Mittfastensonntag Oculi, verstarb in Oppeln nach sechsundsechzig verdienstvollen Jahren Johann, appellatus der Weihwedel, ein Herzog aus dem Geschlecht der Piasten und episcopus Wloclaviensis. Vor seinem Tode hatte er der Stadt Oppeln eine Schenkung von sechshundert Mark gemacht. Es heißt, ein Teil dieser Summe sei, dem letzten Willen des Sterbenden gemäß, an das berühmte Oppelner Hurenhaus »Zur Roten Gundel« gegangen. Die Dienste dieses Liebestempels, der sich hinter dem Kloster der Minderbrüder befand, hatte der Bischof, der ein Lebemann war, bis zu seinem Tode in Anspruch genommen – wenn auch gegen Ende seines Lebens nur mehr als Beobachter.
Im Sommer des Jahres 1422 hingegen – das genaue Datum ist mir entfallen – starb in Vincennes der englische König Heinrich V., der Sieger von Azincourt. Ihn nur knapp zwei Monate überlebend, starb der König von Frankreich, Karl VI., der schon seit fünf Jahren vollkommen verrückt war. Die Krone forderte der Dauphin, Karl, ein, der Sohn jenes Irren. Aber die Engländer erkannten seine Rechte nicht an. Denn seine eigene Mutter, die Königin Isabella, hatte schon längst erklärt, er sei ein Bankert, der außerhalb des Ehebettes mit einem Manne von gesundem Menschenverstand gezeugt worden sei. Da ein Bankert den Thron nicht erben kann, wurde ein Engländer zum rechtmäßigen Herrscher und Monarchen Frankreichs, der Sohn Heinrichs V., der kleine Heinrich, der gerade mal neun Monate alt war. Regent in Frankreich wurde der Oheim des kleinen Heinrich, John Lancaster, der Herzog von Bedford. Dieser hielt gemeinsam mit den Burgundern Nordfrankreich – mit Paris –, den Süden beherrschte der Dauphin zusammen mit den Armagnacs. Zwischen den beiden Reichen heulten die Hunde neben den Leichen auf den Schlachtfeldern.
Im Jahre 1423 aber verstarb am Pfingsttage im Schlosse Peñíscola unweit von Valencia Pedro de Luna, der avignonesische Papst, ein verdammter Schismatiker, der sich bis zu seinem Tode und entgegen den Beschlüssen zweier Konzilien Benedikt XIII. nannte.
Von den anderen, die in jener Zeit starben und an die ich mich noch erinnere, verschied Ernst der Eiserne von Habsburg, Fürst der Steiermark, Kärntens, der Krain, Istriens und Triests. Es starb Johann von Ratibor, Herzog aus Piasten- und P¡rzemysliden-Geschlecht gleichermaßen. Jung verstarb Wenzeslaus, der dux Lubiniensis, es starb Herzog Heinrich, der gemeinsam mit seinem Bruder Johann Herr von Münsterberg war. In der Fremde verschied Heinrich, dictus Rumpoldus, Herzog von Glogau und Landvogt der Oberlausitz. Nikolai Tr±ba verstarb, Erzbischof von Gnesen, ein ehrenwerter und fähiger Mann. In der Marienburg starb Michael Küchmeister, der Hochmeister des Ordens der Allerheiligsten Jungfrau Maria. Auch Jakob PÍczak, genannt Fisch, der Müller von Beuthen, starb. Ha, ich muss zugeben, der ist etwas weniger bekannt und berühmt als die oben Genannten, aber er hat ihnen gegenüber den Vorteil, dass ich ihn persönlich kannte und manchmal mit ihm gebechert habe. Mit den früher Erwähnten ist das irgendwie nie zustande gekommen.
Auch in der Kultur nahmen wichtige Ereignisse ihren Lauf. Es predigte der beseelte Bernhardin von Siena, es predigten Jan Kanty und Johannes von Capestrano, es lehrten Johannes Carlerius de Gerson und Pawel Wlodkowic, Christine de Pisan und Thomas Hemerken a Kempis schrieben gelehrte Werke. Vav¡rinec von B¡rzezová verfasste seine wunderschöne Chronik. Andrej Rubljow malte seine Ikonen, es malte Masaccio, es malte Robert Campin. Jan van Eyck, der Hofmaler Johanns von Bayern, schuf für die St.-Bavo-Kathedrale von Gent seinen »Altar des Mystischen Lammes«, ein überaus schönes Polyptychon, das die Kapelle des Jodocus Vyd ziert. In Florenz beendete Meister Pippo Brunelleschi die Errichtung der Kuppel über den vier Schiffen der Kirche Santa Maria dei Fiori. Wir in Schlesien waren auch nicht schlechter – bei uns hat Herr Peter von Frankenstein in der Stadt Neisse den Bau der sehr stattlichen St.-Jakobs-Kirche vollendet. Gar nicht weit von hier, von Militsch, entfernt, wer noch nicht da war und sie noch nicht gesehen hat, dem böte sich jetzt Gelegenheit dazu.
In jenem Jahr 1422 beging der alte Litauer, der polnische König Jagiello, mitten im Karneval in der Burg Lida mit großem Pomp seine Hochzeit – er heiratete Sonka HolszaÒska, ein blühendes, blutjunges Mädchen von siebzehn Jahren, das demnach mehr als ein halbes Jahrhundert jünger war als er. Wie es hieß, war jenes Mädchen wohl eher ihrer Schönheit, denn ihrer Sitten wegen berühmt. Ja, und es sollte auch später noch viel Ärgernis daraus erwachsen. Jogaila aber, als hätte er völlig vergessen, wie man sich eines jungen Weibes erfreut, zog schon im Frühsommer gegen die preußischen Herren, will heißen, gegen die Ritter mit dem Kreuz. So kam es auch, dass der neue Hochmeister des Deutschen Ordens, Herr Paul von Rusdorf, Küchmeisters Nachfolger, gleich nach der Amtseinführung Bekanntschaft mit den polnischen Waffen schließen musste – und zwar eine recht stürmische Bekanntschaft. Wie es da auf dem Ehelager mit Sonka bestellt war, wird man vergeblich zu erfahren suchen, um den Deutschordensrittern den Hintern zu versohlen, war Jogaila aber immer noch Manns genug.
Eine Menge wichtiger Dinge ereigneten sich in jener Zeit auch im Königreich Böhmen. Eine große Erschütterung gab es da, viel Blutvergießen und unaufhörlich Krieg. Wovon rede ich da … Wollet einem alten Mann vergeben, Ihr edlen Herren, aber Furcht ist ein menschlich Ding, und ist schon so mancher für ein unbedachtes Wort am Hals gepackt worden. Auf Euren Wämsern, Ihr Herren, sehe ich wohl die polnischen Wappen der Na?Ícz und der Habdank, und auf den Euren, edle Böhmen, die Hähne der Herren von Dobrá Voda, und die Ritterpfeile von Strakonitz … Und Ihr, Marsjünger, seid ein Zettritz, ich erkenn’s am Bisonkopf im Wappen. Das Eurige, Herr Ritter, das schräge Schachbrett und die Greifen, kann ich nirgendwo zuordnen. Es lässt sich nicht ausschließen, dass du, Frater aus dem Orden des heiligen Franziskus, nicht alles dem Heiligen Officium zuträgst, dass Ihr es tut, Brüder von St. Dominik, ist wohl gewiss. So seht Ihr selbst, dass es mir nicht leicht wird, in einer so internationalen und auch so unterschiedlichen Gesellschaft von den böhmischen Dingen zu berichten, weil ich nicht weiß, wer hier für Albrecht und wer für den polnischen König und den Prinzen ist. Wer hier für Menhart von Hradec und Old¡rich von Roæmberk ist, und wer für Hynek Pt?Ëek von Pirkstajn und Jan Kolda von Æampach. Wer auf des Comes Spytko von MelsztyÒskis Seite steht und wer ein Anhänger des Bischofs von Oels ist. Ich habe gewiss keine Sehnsucht nach Schlägen, aber ich weiß wohl, dass ich welche einstecken werde, weil ich schon mehrmals welche einstecken musste. Wie das, fragt Ihr? Das ist so: Wenn ich sage, dass in den Zeiten, von denen ich erzähle, die tapferen Hussiten den Deutschen heftig das Wams durchgewalkt und sie in drei Kreuzzügen hintereinander zu Pulver und Staub zermahlen haben, dann währt es nicht lang, bis mich die einen aufs Haupt schlagen. Sage ich aber, dass in den Schlachten bei Vítkov, Vynehrad, Saaz und Deutsch-Brod die Häretiker die Kreuzfahrer nur mit teuflischer Hilfe besiegt haben, ergreifen mich die anderen und prügeln mich durch. Daher wär’s mir lieber zu schweigen, aber wenn ich schon reden muss, dann mit der Neutralität eines Berichterstatters – berichten, wie man sagt, |sine ira et studio|, knapp, kühl, sachlich, und ohne einen Kommentar von meiner Seite hinzuzufügen.
So sage ich denn auch nur kurz: Im Herbst des Jahres 1420 lehnte der polnische König Jogaila die böhmische Krone ab, die die Hussiten ihm angetragen hatten. In Krakau wähnte man, dass der litauische dux Witold, der schon immer gekrönt werden wollte, die Krone nehmen würde. Um aber weder den römischen König Sigismund noch den Papst über Gebühr zu ärgern, wurde Zygmunt, der Neffe Witolds und Sohn Korybuts, nach Böhmen gesandt. Er stand am Tage des heiligen Stanislaus im Jahre 1422 im goldenen Prag an der Spitze von fünftausend polnischen Rittern. Aber schon am Dreikönigstag des darauf folgenden Jahres musste das Prinzchen nach Litauen zurückkehren, so wütend waren der Luxemburger und Oddo Colonna, seinerzeit der Heilige Vater Martin V., über die böhmische Thronfolge. Aber schon 1424, am Vorabend von Mariä Heimsuchung, war der Sohn des Korybut zurück in Prag. Diesmal gegen den Willen Jogailas und Witolds, gegen den Willen des Papstes, gegen den Willen des römischen Königs. Das heißt als Aufrührer und Geächteter. An der Spitze ebensolcher Aufrührer und Geächteter. Und nicht nur Tausender, wie vorher, sondern Hunderttausender.
In Prag hingegen fraß der Umsturz, wie Saturn, seine eigenen Kinder, und eine Seite maß sich mit der anderen. Jan von Æeliva, den man am Montag nach dem Sonntag Reminiscere des Jahres 1422 geköpft hatte, wurde schon im Mai desselben Jahres in allen Kirchen als Märtyrer beweint. Kühn stellte sich das goldene Prag auch Tabor entgegen, aber hier hatte die Sense auf den Stein getroffen. Nämlich auf Jan Æiæka, den großen Kämpen. Anno Domini 1424, am zweiten Tage nach den Nonen des Juni, erteilte Æiæka den Pragern bei Malschau am Flüsschen Bohynka eine schreckliche Lehre. Viele, o gar viele Witwen und Waisen gab es nach dieser Schlacht in Prag.
Wer weiß, vielleicht bewirkten die Tränen jener Waisen, dass kurz darauf, am Mittwoch vor dem Festtage des St. Gallus in P?ybyslav nahe der mährischen Grenze Jan Æiæka von Trocnov, oder wie es später hieß, vom Kelch, verstarb. Begraben hat man ihn in Hradec Králové, und dort liegt er. Und so wie vorher die einen seinetwegen geweint hatten, weinten jetzt die anderen um ihn. Dass er sie als Waisen zurückgelassen hatte. Deswegen nannten sie sich »die Waisen« …
Aber daran erinnert Ihr Euch wohl alle noch. Weil das vor noch gar nicht so langer Zeit gewesen ist. Und jetzt sind das schon … historisch gewordene Zeiten.
Ihr wisst doch, werte Herren, woran man erkennt, ob eine Zeit historisch ist? Daran, dass vieles schnell geschieht.
Damals ereignete sich sehr vieles sehr schnell. Der Weltuntergang war, wie gesagt, nicht gekommen. Obwohl vieles darauf hindeutete, dass er kommen würde. Denn es gab – genauso, wie die Prophezeiungen es wollten – große Kriege und große Plagen für das Christenvolk, und viele Männer starben. Es schien, als wolle Gott selbst, dass der Entstehung einer neuen Ordnung der Niedergang der alten vorausginge. Es schien, als nahte die Apokalypse. Als käme die Bestie mit zehn Hörnern aus der Hölle. Als sähe man die vier Reiter im Rauch der Brände und der blutgetränkten Felder. Als ertönten jeden Augenblick die Trompeten und die Siegel würden zerbrochen. Als würde Feuer vom Himmel fallen. Als würde der Stern Wermut auf den dritten Teil der Ströme und auf die Quellen der Wasser fallen. Als würde der irre gewordene Mensch, der die Fußspuren eines anderen auf der Brandstätte erblickte, unter Tränen jene Spuren küssen.
Manchmal war es so schlimm, dass einem, ich bitte um Vergebung, edle Herren, der Arsch auf Grundeis ging.
Das war eine bedrohliche Zeit. Eine böse. Und wenn es Euer Wille ist, so werde ich davon erzählen. Um die Langeweile zu vertreiben, solange der Regen, der uns hier in der Schenke festhält, nicht aufhört.
Ich erzähle, wenn Ihr wollt, von jenen Zeiten. Von den Menschen, die damals lebten, wie auch von jenen, die damals lebten, aber keine Menschen waren. Ich erzähle davon, wie die einen, wie die anderen sich mit dem maßen, was die Zeit ihnen brachte. Mit ihrem Schicksal. Und mit sich selbst.
Diese Geschichte beginnt freundlich und ergötzlich, undurchsichtig und zärtlich – mit einer angenehmen, innigen Liebe. Aber das soll Euch, liebwerte Herren, nicht täuschen.
Lasst Euch dadurch nicht täuschen.
|Prolog aus:
Andrzej Sapkowski: [„Narrenturm“]http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3423244895/powermetalde-21
dtv premium im Großformat
740 Seiten
ISBN 3-423-24489-5
Aus dem Polnischen von Barbara Samborska.
© der deutschsprachigen Ausgabe: 2005 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG|
(In dieser Webfassung tauchen verschiedentlich Kompatibilitätsprobleme mit der Darstellung polnischer Sonderzeichen auf, die in der Buchfassung natürlich nicht auftreten.)