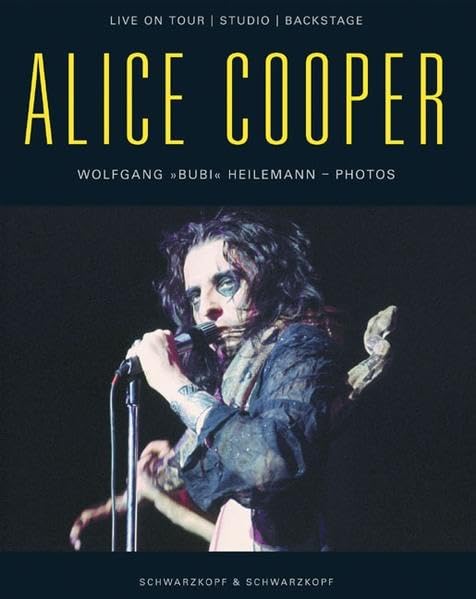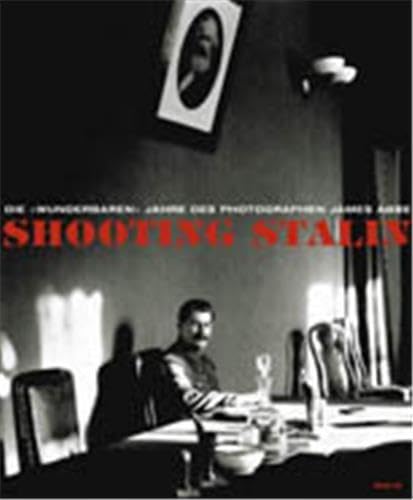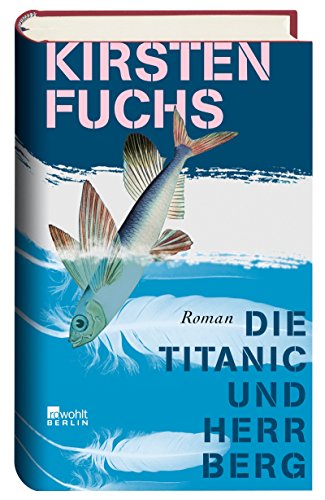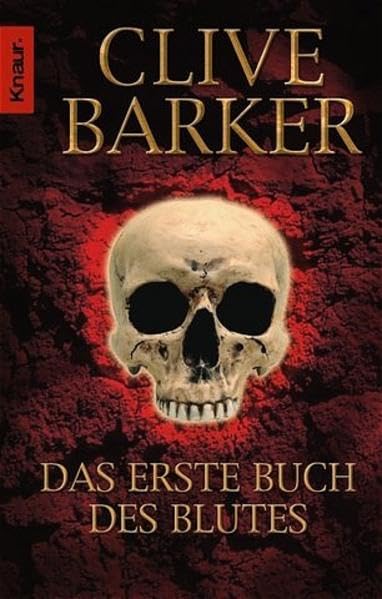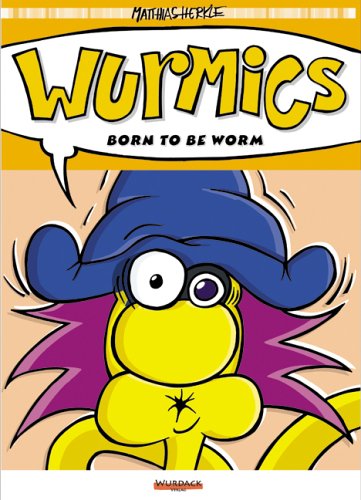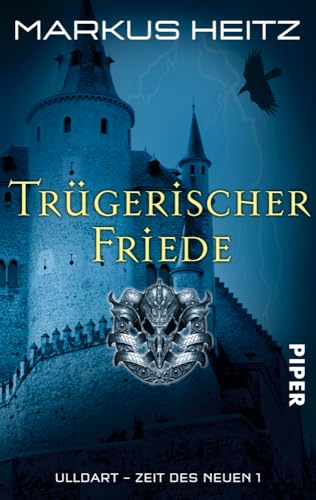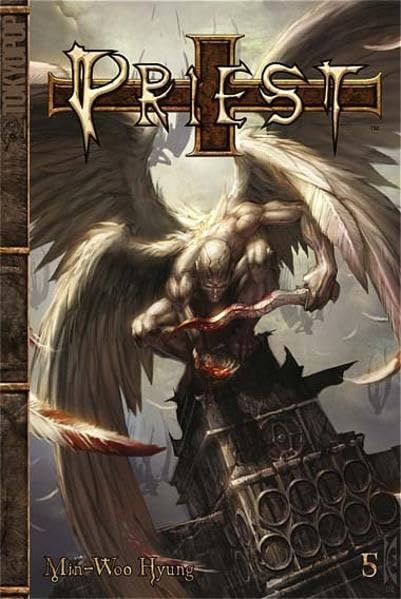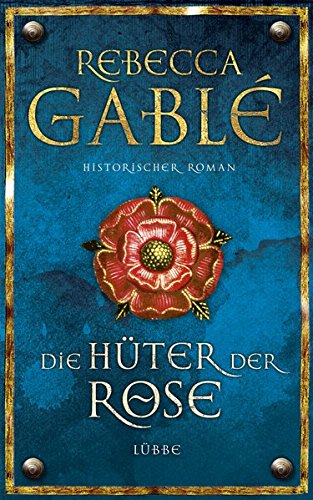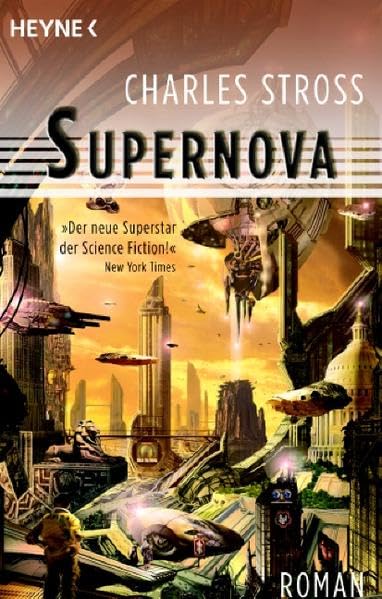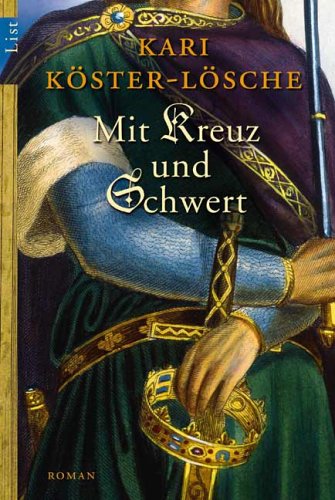Ein Kapitel aus Max Köhlers neuem unveröffentlichtem Roman „Leben lieben“.
Max Köhler wurde 1942 in Pilsen als Sohn eines deutsch-böhmischen Kaufmanns und einer südfranzösischen Kaufmannstochter geboren. Er studierte Malerei und arbeitete als Fotoreporter und Textredakteur bei Tageszeitungen. Seit 1988 lebt er als freier Maler in Schutterwald bei Straßburg.
http://www.koehler-max.de/
_Gott steh uns bei: ein Heimatmaler_
Professor Subers jüngster Bruder Fritz (auch schon vierundfünfzig Jahre alt) war Maler, genauer gesagt „Heimatmaler“. So wurde er jedenfalls in der Schlossenhausener Lokalzeitung genannt. Überflüssig zu sagen, dass der Professor ihn aus ganzem Herzen verachtete, weil er nicht die Kraft hatte, in einem bürgerlichen Beruf zu arbeiten.
Fritz war anfangs nicht sehr glücklich über den Begriff Heimatmaler, den ihm die Lokalzeitung übergestülpt hatte, fand sich aber später damit ab. Gegen Ende seines Lebens trug er ihn gar als Ehrentitel. Da der Zeitgeist alles verächtlich machte, was mit dem Begriff „Heimat“ zusammenhing, fühlte er sich verpflichtet, für die Heimat einzutreten. Er tat das nicht etwa, weil er seine Heimat liebte, ganz im Gegenteil, sie war ihm oft genug zuwider, aber er musste sich aus irgendeinem verqueren Oppositionszwang für alles einsetzen, wogegen die anderen waren, ohne zu begreifen, weshalb sie dagegen waren und er dafür. Fritz war etwas wirr im Kopf und, gelinde gesagt, sehr verträumt. Er konnte sich auf nichts konzentrieren, am allerwenigsten auf seine Bilder. Merkwürdigerweise schadete das seinen Werken nicht. Sie wirkten pointilistisch. Vermutlich war jeder Point einer seiner Konzentrationshöhepunkte.
Er war groß und hatte eine merkwürdige Art zu gehen: Sein Oberkörper blieb dabei relativ ruhig, aber krumm wie ein Fragezeichen, während er die Beine nach vorne warf, fast von sich schleuderte und sein müder verbogener Oberkörper sie ganz behutsam wieder einholte, als ob er mit seinen Beinen eine Pflicht vorgab und sein Körper keine Lust hätte, sie zu erfüllen, es dann aber doch tat, provozierend langsam wie ein renitenter Internatsschüler. Wiegend und schaukelnd eierte unser Mann vorwärts: ein arrogantes Dromedar, das seine Beine losschickte und den höckrigen Oberkörper in die kulturelle Wüste einer mittelbadischen Kleinstadt nachschleifte.
Seine ganze Körpersprache sagte: Lasst mich bloß in Ruhe, ihr seht doch, dass ich schon genug Mühe habe, mich zu bewegen, warum sollte ich also noch etwas tun, wozu ich ganz gewiss nicht in der Lage bin, denn so ungeschickt, wie ich mich bewege, erledige ich auch alles andere, verschont mich mit euren Bitten um dieses und jenes, ich schaffe es nicht.
Und tatsächlich war ihm fast alles im Leben öde Pflicht. Er konnte nicht unterscheiden zwischen Freizeit, Sport, Arbeit oder Vergnügen, ihm war alles gleich zuwider, aber er sah ein, dass er nicht den ganzen Tag im Bett liegen und lesen konnte, obwohl er dies am liebsten tat, und er sich nur von Rückenschmerzen hinlänglich aufgefordert sah, seine Liegestatt zu verlassen. Lesen im Bett war seine einzige Leidenschaft. Anfangs waren es gute Bücher gewesen, denn er hatte keinen schlechten Geschmack, was man bei diesem trägen Mann eigentlich nicht vermutetet hätte, denn auch eine so scheinbare Kleinigkeit wie ein guter Geschmack verlangt eine gewisse Anstrengung, nämlich ihn zu erwerben, aber Fritz war hier ein Naturtalent, er las von Anfang an und ohne dass ihm das einer empfohlen hätte, nur gut geschriebene Bücher. War er einmal durch Unaufmerksamkeit, Bequemlichkeit oder Nachlässigkeit an ein schlechtes geraten, war er in der Regel nicht über die erste Seite hinausgekommen.
Jawohl, Weltliteratur las er, wie er sich stolz immer wieder selbst vorsagte, denn es war ja niemand da, den er darüber hätte aufklären können, weil auch das weibliche Geschlecht ihn mied wie selbstverständlich die Männer, die mit einem Geschlechtsgenossen nichts anfangen konnten, der sein halbes Leben verschlief, verlag oder verlas.
Nur gute Bücher zu lesen, hat jedoch den Nachteil, dass einem irgendwann der Stoff ausgeht, weil es nicht unendlich viel davon gibt, und so sank Fritz nach einigen Jahren Weltliteratur eine Stufe tiefer und fing an, Tageszeitungen zu lesen, weil es davon jeden Tag Nachschub gab. Er las selbstverständlich nur die besten Zeitungen, die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, die „Süddeutsche“ und die „Neue Zürcher Zeitung“. Gerade die Zürcher Zeitung machte ihm viel Freude, weil die Schweizer Wörter verwendeten, die es im Deutschen nicht gab.
Fritz amüsierte sich eine Weile mit dem Spiel, die Tendenz eines objektiven Artikels zu erraten, aber eines Tages wurde ihm dies zu langweilig und er fing an, die Lokalzeitung von Schlossenhausen zu lesen. Spätestens hier hätte er sich eingestehen müssen, dass er süchtig nach Lesestoff war, denn las einer die Heimatzeitung, der bei klarem Verstand war? Einmal wurde die Lokalzeitung aus irgendeinem Grunde nicht geliefert und er machte sich mit schweren Entzugserscheinungen über die Gebrauchsanweisung seiner neuen Kaffeemaschine her. Er las sie von sieben Uhr morgens bis etwa zwei Uhr nachmittags und danach hätte er schwören können, dass er immer noch nichts verstanden hatte.
Von einer gewissen Unruhe getrieben, wachte er jede Nacht gegen zwei Uhr auf und wartete von da an auf das Lokalblatt, das gegen vier Uhr vierundzwanzig eintraf. Er las es dann langsam, damit er möglichst viel davon hatte, angefangen von der Nachricht, dass sich die dritte Riege des Turnvereins im „Grünen Baum“ traf, bis hin zu den Sprechstunden des Oberbürgermeisters am Donnerstagabend um acht. Er verglich das Gelesene von Zeit zu Zeit mit seiner Weltsicht, die er sich als Kind durch die Lektüre der „Micky-Maus“-Hefte erworben hatte, und fasste die Diskrepanz in unnachahmlichen Aphorismen zusammen, die ihm bei schlichteren Gemütern den Ruf einbrachten, „durchzublicken“, bei den Kassiererinnen in seinem Supermarkt dagegen Unwillen hervorriefen, weil er sie zu oft wiederholte, ohne sie zu aktualisieren.
Nachdem er alles gelesen hatte, was man in Entenhausen lesen konnte, und ihm der geringe Nutzen einer aus dem Chinesischen übersetzten Gebrauchsanweisung für Kaffeemaschinen klar geworden war, sah er sich nach neuen Gewohnheiten um und stieß dabei auf den Historischen Verein. Er besuchte eine Zusammenkunft des Ausschusses für Vorgeschichte. Hier dominierte ein älterer Herr, der keinen Satz grammatikalisch richtig zu Ende bringen konnte, was auf die Dauer doch ein wenig störte, weil man gezwungen war, zu erraten, was er meinte. Das brachte zwar eine gewisse Würze hinein, weil alle versuchten, zu erraten, was der Vorsitzende gesagt hatte, aber auf die Dauer war es doch ein wenig ermüdend.
So erriet der Ausschuss für Vorgeschichte eines Tages, dass der Vorsitzende meinte, steinzeitliche Opferstätten entdeckt zu haben, weil er Vertiefungen auf großen Felsblöcken im Schwarzwald gefunden hatte, die er für Blutrinnen hielt. Andere Historiker außerhalb des Ausschusses erklärten zwar, das seien Regenrinnen, aber der Ausschuss fand Blutrinnen einfach spannender und einigte sich mit seinem Vorsitzenden auf Blutschalen. Wer geopfert hatte, wurde nicht ganz klar, vielleicht die Kelten, aber wahrscheinlich waren es doch Steinzeitleute. Was sie geopfert hatten, wurde in langen Sitzungen beschlossen, man tendierte zu Tieropfern, ohne Menschenopfer ganz auszuschließen, aber Tieropfer waren deshalb besser, weil es sich möglicherweise bei den Opferpriestern um Vorfahren des Ausschusses für Vorgeschichte gehandelt hatte und keiner rituelle Mörder zu Verwandten haben wollte.
Manche Leute in Schlossenhausen fragten sich natürlich, womit Fritz seinen Lebensunterhalt verdiente. Solche Fragen waren ihm peinlich. Er wollte nicht zugeben, dass er die meiste Zeit des Tages nur im Bett lag und las und so erfand er die Mär vom Kunstmaler, der wenig malte, weil er viel nachdachte. Er wollte niemanden erzählen, dass er von einer sektenbesessenen Tante mit einem undurchsichtigen Vorleben einige hunderttausend Euro geerbt hatte und nicht die geringste Lust verspürte, etwas Vernünftiges zu arbeiten. Das hätte im sozialistischen Schlossenhausen böses Blut gemacht. Weil ihn aber die Leute immer unverschämter nach seiner Malerei fragten, krakelte er ein paar Bilder auf Leinwand und bastelte sich eine Theorie dazu, denn man musste als Maler eine Theorie haben, so etwas wie eine Sendung oder zumindest eine Botschaft, sonst wurde man bei den Verantwortlichen der städtischen Galerie nicht ernst genommen und hatte auch im Künstlerverein einen schweren Stand; ja, man bekam nicht einmal einen Ausweis als Künstler, mit dem man Pinsel zum halben Preis kaufen konnte.
Schlau wie Fritz nun einmal war – denn die Bequemen sind auch schlau, vermutlich, weil sie ständig darüber nachdenken müssen, wie man Beschäftigung vermeidet – erfand er die Theorie, dass man als Maler keine Theorie brauchte, sondern einfach nur das malen sollte, was einem auffiel und das dann möglichst so, dass man es wiedererkennen konnte.
Natürlich ging ein Aufschrei durch die lokale Malszene. Fritz wurde auf der Stelle geächtet und war fortan kein denkender Maler mehr, sondern ein geistig beschränkter Kunsthandwerker. Die Schwierigkeiten mit der städtischen Galerie nahmen zu, was ihn aber nicht weiter störte, denn so konnte er endgültig im Bett bleiben, weil sich keiner um ihn kümmerte, mögliche Kunden mit eingeschlossen.
Aus Langeweile brach er aber eines Tages dann doch eine heftige Auseinandersetzung mit der Leiterin der Galerie vom Zaun, einer promovierten Kunsthistorikerin, die auf der Höhe der Zeit war und Fritz deshalb als parasitäres Subjekt betrachtete. Nicht etwa, weil er im Bett lag und dort nichts tat, sondern weil er ein Mann war und malte. Es gab doch so viele unterdrückte Frauen, die auch malten. Und viel besser malten als Fritz, zeitgemäßer, minimalistischer oder gestischer. Fritz war nicht nur ein parasitärer Maler, sondern malte auch noch nach Ansicht seiner Kolleginnen (die meisten waren Hausfrauen oder Lehrerinnen) viel zu hausbacken und kundenfreundlich. Sein schlimmster Fehler aber war, dass er gut malte. Das war auf keinen Fall zu tolerieren. Musste man nicht als moderner Maler auf Konventionen pfeifen? Wer ließ sich heute noch in das Gefängnis einer guten Malerei einsperren? Mit dem Gegenteil mochte Fritz aber nicht dienen, und so versank er erleichtert, weil keine Nachfrage nach seinen Bildern herrschte, wieder in die Bettkissen, rechts die „Frankfurter Allgemeine“, links Musils „Drei Frauen“ und auf dem Nachttisch Sartres „Wörter“, wovon ihm besonders die ersten drei Seiten gefielen, auf denen der Philosoph seinen Verwandtschaftsgrad zu Albert Schweitzer beschrieb. Fritz Suber hatte das allerdings schon mindestens ein Dutzend mal gelesen, was die Brillanz dieser zweiundsiebzig Zeilen doch ein wenig milderte.
Die Kunsthistorikerin war vom Oberbürgermeister eingestellt worden, weil dieser von der Vision geplagt wurde, eine Stadt von der Bedeutung Schlossenhausens müsse ein Kunstleben haben, um leitende Angestellte und Fabrikanten herzulocken. Sein Plan sah so aus: Ist Kunst da, kommen auch leitende Angestellte. Fehlt Kunst, bleibt diese wichtige Oberschicht weg und die Stadt versinkt in Dumpfheit, ganz abgesehen davon, dass er dann zu wenig Gewerbesteuer einnahm und das Rathaus nicht umbauen konnte.
Nun mochten zwar die Dumpfen in der Stadt die leitenden Angestellten nicht, weil diese in der Regel aus Norddeutschland kamen, und Norddeutsche spätestens seit Luthers Sprachgewohnheiten und dem daraus resultierenden Dreißigjährigen Krieg in Süddeutschland etwa so gern gesehen waren wie Vegetarier in einer Metzgerei.
Aber der Oberbürgermeister verstand nichts von Kunst, weil sein Vater Bote bei der Ortskrankenkasse gewesen war und einen harten Kampf um seine Existenz hatte führen müssen. Deshalb hatte er seinen Sohn auch nicht an die Kunst heranführen können. Nur der Kalender der Krankenkasse hatte im Elternhaus des Oberbürgermeisters an Malerei erinnert. Deshalb wusste der Oberbürgermeister nicht, dass ein kunsthistorisches Studium zur Beurteilung von neuen Kunstentwicklungen wenig taugt, weil ein Kunsthistoriker nur rückwärts blicken kann, wie schon der Name sagt. Das löste natürlich das Dilemma nicht: denn wen sollte er sonst die lokale und internationale Kunstszene beobachten lassen? Er kam einfach nicht auf die Idee, jemanden zu beauftragen, der etwas Geschmack hatte, denn das Beamtengesetz verlangte für eine höhere Stelle ein abgeschlossenes Studium. Es war klar, dass man guten Geschmack nicht einfach studieren konnte, noch dazu, wenn die Professoren auch keinen guten Geschmack gehabt hatten. Außerdem: Wie hätte wohl der Oberbürgermeister jemanden mit gutem Geschmack erkennen können? Da er selbst keinen hatte, konnte er auch nicht sehen, wenn jemand ihn hatte. Und wieso einer Oberbürgermeister werden konnte, der keinen Geschmack und kein Urteil besaß, führte Suber zu tiefgreifenden Überlegungen, an deren Ende die entautorisierten Eliten nach dem verlorenen Kriege standen.
Fritz schien es, als ob eine sich fortpflanzende Fernwirkung des verlorenen Krieges unsere Nation zur Mittelmäßigkeit zwingen würde. Unsere neuen Eliten wollten, so sah es Fritz, nach dem Kriege um keinen Preis der Welt mehr auffallen; nach all den „Auffälligkeiten“ des von uns angezettelten und verlorenen Weltkrieges sicher kein ganz unverständlicher Wunsch. Da unsere neuen Eliten keine Philosophen gewesen seien und auch keine Zeit zum Nachdenken gehabt hätten, seien sie auf den Gedanken gekommen, einfach das Gegenteil von dem zu tun, was die Nationalsozialisten getan hätten. Das aber hätte in eine Sackgasse geführt, weil nicht alles falsch gewesen sei, was die Braunen gesagt oder getan hatten. Wenn beispielsweise ein Nationalsozialist gemeint habe, ein Reh sei braun, könne es nach dem Krieg nicht automatisch grün werden, weil wir den Krieg verloren haben.
Hans Thoma konnte nicht deswegen zum schlechten Maler werden, weil nach dem Krieg alles anders war. Wenn man Thoma verachtete, weil die Nazis ihn verehrt hatten, beging man doch, so schien es Fritz, genau denselben Fehler wie die Nazis, die seine Malerei zur Staatskunst erhoben hatten: Nach dem Krieg gehörte es zur politischen Korrektheit in Westdeutschland, über den Heimatmaler Thoma milde zu lächeln, als habe er es nicht besser gekonnt, weil er eben ein schlichter Junge aus dem Hotzenwald gewesen sei. Keinesfalls war es erlaubt, so zu malen wie er, sonst wurde man vom Kunstbetrieb geschnitten. Das sah dem Mal- und Ausstellungsverbot der Nazis ziemlich ähnlich. Eigentlich war es nur die andere Seite derselben Medaille: „Kunst wird von Staats wegen verordnet – wer anders denkt, wird ausgegrenzt“. Man musste dankbar sein, dass man nicht in ein Arbeitslager kam, wenn man wie Thoma malte. Doch eigentlich landete man ja im Arbeitslager. Da niemand die Bilder kaufte, die im Stil von Thoma gefertigt waren, weil sie politisch unkorrekt waren, musste man letztendlich arbeiten gehen und sich um eine Stelle als ungelernter Arbeiter bemühen, da man ja nichts anderes gelernt hatte als zu malen wie Thoma. Da auf den Akademien nicht gelehrt wurde, zu malen wie Thoma, hatte man es sich wie ein dissidierender Ostblockmaler selbst beibringen müssen. Wagte man sich mit diesen Bildern an die Öffentlichkeit, wurde man zwar nicht verhaftet, aber gnadenlos ausgepfiffen. Man geriet sozusagen in die Sippenhaft des Ausgepfiffen- und Verachtetwerdens. In einem Konzentrationslager hätte man wenigstens Gleichgesinnte neben sich gehabt. Als Thoma-Nachfolger hingegen blieb einem in Westdeutschland nach dem Krieg nur die Einzelhaft der Einsamkeit.
Angefangen hatte dieses geistige Zwangskorsett mit der Gesinnungs-Schnüffelei der Entnazifizierungsbehörden, die einfach die Gesinnungs-Schnüffelei der Nazis kopierten, nur anders herum. Wer blond und blauäugig war, tat fortan gut daran, sich umzufärben, wer den Heimatmaler Hans Thoma liebte, hielt am besten den Mund.
Fritz hätte es übrigens gerne gesehen, wenn sich Ministerialbeamte oder Feuilletonisten wie Enzensberger um diese Fragen gekümmert hätten. Dass sie dazu beharrlich schwiegen, das Problem nicht aufgriffen, ja es anscheinend gar nicht erkannten (sonst hätten sie sich ja dazu geäußert, und man hätte davon gehört), ärgerte ihn maßlos.
Man ist erstaunt, dass sich ein so träger Mann wie Fritz überhaupt ärgern konnte. Ärgern verlangt doch auch einen gewissen Einsatz. Aber er konnte sich über vieles ärgern. Das steigerte sich, weil er ja mit niemanden reden konnte, zu regelrechten Wutanfällen. Sprach er dennoch einmal mit einer Zufallsbekanntschaft, hörte er nicht zu, sondern hing weiter seinen Gedanken nach. So konnte es passieren, dass er mitten in einem harmlosen Gespräch plötzlich einen Wutanfall bekam, der seine Gesprächspartner erschreckte, weil sie nicht begriffen, wie er zustande gekommen war, jedenfalls nur schwer auf die gegenwärtige Situation bezogen werden konnte.
Man könnte nun auch vollkommen berechtigterweise fragen, was Fritz die Eliten nach dem Kriege angingen, er war ja weder Ministerialbeamter noch Dichter. Aber wir müssen einfach feststellen, dass er sich diese Gedanken machte. Er hatte die Angewohnheit, sich um Dinge zu kümmern, die ihn nichts angingen und andererseits Themen zu vernachlässigen, die eindeutig seine Sache waren, wie etwa die, höflich zu sein und sich um seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Das war ja gerade der Ärger, den er in Schlossenhausen verursachte. Er fühlte sich für Dinge zuständig, für die er nicht zuständig war.
Den Oberbürgermeister und den Kulturamtsleiter von Schlossenhausen fesselte zu der Zeit, als die Frage auftauchte, was eigentlich Kunst in Schlossenhausen sei, noch ein anderes Problem, nämlich die Frage, woher sie selbst kamen. Der Oberbürgermeister wollte seinen Vater vergessen machen, weswegen er immer viel zu elegante Kleidung trug, die er für vornehm hielt, aber natürlich gerade damit auf seine bescheidene Herkunft aufmerksam machte, und der andere prahlte ständig mit seinen Ahnen, weil er wusste, dass ihm etwas fehlte, er wusste nur nicht, was es war, aber er ahnte, dass es mit seiner Herkunft zusammenhing. Jedem zufälligen Gesprächspartner erläuterte er, dass er von Luthers Schwiegervater abstamme, was ihm zwar niemand so recht glauben wollte, aber bei Aufsteigern einen großen Eindruck hinterließ, weil es sich so schwer nachprüfen ließ. Wie um alles in der Welt prüfte man nach, ob man von Luthers Schwiegervater abstammte? Kein Wunder, dass Genealogen und Wappenmacher in Schlossenhausen unerwartet Aufträge bekamen, die sie selbstverständlich zur Zufriedenheit der Auftraggeber ausführten.
Irgendwie muss der Kulturamtsleiter aber doch Angst vor ernsthaften Recherchen bekommen haben, denn nach einigen Jahren wandelte er die Geschichte von seiner Herkunft etwas ab. Sie hörte sich dann so an: Meine Vorfahren waren ausnahmslos Pfarrer. Pause. Selbstverständlich nur bis zur Reformation. Hahahaha. Diesen Sketch führte er ungefähr dreimal am Tag auf und hielt sich dabei für zurückhaltend, weil er auf die ständige Erwähnung seines Onkels verzichtete, der Bischof gewesen war und angeblich Hitler dreimal energisch widersprochen hatte.
Die Leiterin der Städtischen Galerie lobte auf Wunsch des Oberbürgermeisters einen Kunstwettbewerb aus, bei dem sie von vorneherein wusste, wer ihn gewinnen würde, nämlich Gerda Breuer, die Freundin der Frau des Oberbürgermeisters, jene schüchtern-zurückhaltende Malerin, die so breiig ausufernd malte und dabei alle Konventionen, die vor 1945 gegolten hatten, missachtete. Um auch sicherzustellen, dass Gerda den Wettbewerb gewann, stellte Kocher-Meier eine Jury zusammen, die aus dem ehemaligen Professor und einer Studienkollegin von Gerda bestand, ganz abgesehen davon, dass der Oberbürgermeister selbstverständlich auch für Breuer war, weil er ein paar Bilder von ihr erworben hatte. Er hatte sie nicht etwa gekauft, weil seine Frau die Freundin von Gerda war, nein, so weit ging sein Vertrauen in die Fähigkeiten seiner Frau nicht, begabte Persönlichkeiten an sich zu binden, sondern weil sein Freund, der Textilunternehmer Reser, es ihm geraten hatte.
Reser verstand zwar auch nichts von Bildern, aber er hatte als Unternehmer Glück gehabt und wollte dieses Glück nun irgendwie „weitergeben“, wie er sich ständig im „Schlossenhausener Tageblatt“ ausdrückte, und dabei von wechselnden, aber immer wohlmeinenden Reportern mit den entsprechenden Fragen versorgt wurde („Sie tun ja unheimlich viel für die Kunst. Weshalb tun Sie das? Das müssten Sie doch eigentlich als erfolgreicher Unternehmer gar nicht“). Gleichzeitig wollte Reser natürlich beweisen, dass er ein vornehmer Mensch war, was sich aus seiner Tätigkeit nicht ohne Weiteres ergab, denn er sammelte in großem Stil alte Lumpen ein und ließ sie in riesigen Werken zu neuen Textilien verarbeiten. Eigentlich hätte das den Grünen in der Stadt gefallen müssen, aber ein Grüner ist auch ein Querdenker, deshalb monierten sie, dass Reser bei diesem Recycling Chemikalien verwandte. Vermutlich hätte er sich abends in eine Spinnstube setzen müssen, um aus seinen alten Lumpen neue Fäden zu ziehen. Es war schwer in Schlossenhausen, den Grünen zu gefallen. Manche versuchten es deshalb erst gar nicht. Irgendwie hatte man bei den Grünen immer das Gefühl, dass sie etwas anderes meinten, als sie beklagten. Etwa so, wie man zum Friseur geht, wenn man Krach mit seinem Vorgesetzten hat.
Reser war entzückt von Gerda. War sie nicht im besten Alter und wunderhübsch? Und so scheu! Und sie malte! Gegen die Konventionen, wie es nach dem Krieg der Brauch war! Hatte er nicht zufällig eine Menge Bilder von ihr? War sie nicht die Kunstlehrerin seiner Kinder? Gab sie ihnen nicht wunderbare Noten? Konnte sie nicht einen Kunstpreis vertragen? Würde das nicht ihren Marktwert steigern? Hatte man als erfolgreicher Unternehmer nicht die Macht und die Freude, einen Preis zu vergeben? Wozu war man schließlich mit dem Oberbürgermeister befreundet und Präsident der Industriekammer? Was ergab das alles für einen Sinn, wenn man nicht Freude daraus zog, oder, wie es Reser ausdrückte, seine geschenkte Freude an andere weitergab?
Außerdem war Gerda in derselben Partei wie der Oberbürgermeister. Da es sich um eine sozialistische Partei handelte, war ein Kampfbund gegen die konservative Reaktion unvermeidlich. Man würde es den bürgerlichen Privilegierten schon zeigen, darin waren sich alle einig, die schlecht erzogene Eltern gehabt hatten. Hatte der Vater des Oberbürgermeisters nicht auch unter den Großkapitalisten oder zumindest unter deren bösen Strukturen gelitten? Hatten diese Kapitalisten ihn nicht unterdrückt und auf Botengänge geschickt, so dass er nie die Möglichkeit hatte, Leiter der AOK-Nebenstelle Rammersweier zu werden? Obwohl er weiß Gott das Zeug dazu hatte?
Aber er, der Oberbürgermeister, hatte sich mit eisernem Fleiß aus seiner Misere des Kunstunverständnisses und schlechten Benehmens herausgearbeitet. Eiserner Fleiß, das war das Zauberwort, mit dem er es diesen Typen wie Fritz Suber, dem Maler, schon zeigen würde. Was tat Suber eigentlich den lieben langen Tag außer spinnen? Wovon lebte er? Er hatte ihm noch keine Bilder abgekauft. Tat das überhaupt jemand? Verdammter Schnösel! Tat nichts, hatte nichts, aber riss das Maul auf! Er selbst hatte sich alles erarbeitet, zwar nicht mit seinen eigenen beiden Händen, aber mit seinen eigenen beiden Gehirnhälften! Und der? Tat nichts und legte sich mit einer promovierten, fleißigen und anstelligen Kunsthistorikerin an, die er, der Oberbürgermeister, eingestellt hatte! War das nicht so etwas ähnliches wie Beleidigung? Beleidigung eines Oberbürgermeisters? Er vertrat schließlich nicht nur sich selbst, sondern auch die Bevölkerung, den Souverän.
Irgendwie musste man diesem Kerl beikommen. Man könnte einfach die Zeit für sich arbeiten lassen. Irgendwann würde ihm schon die Puste ausgehen. Und wenn er Geld hatte, konnte das ja auch nicht ewig reichen. Irgendwann ging auch das größte Vermögen zu Ende. Oh, genähtes Elend! Warum hatte sein Vater kein Vermögen zusammengerafft, dann hätte er es nicht jetzt tun müssen. Obwohl ihm als Oberbürgermeister die Hände gebunden waren. Vielleicht könnte Reser? Vielleicht könnte man …
Mit der gespielten Munterkeit, wie sie Leute zuweilen an sich haben, die ihren Beruf hassen, rief Oberbürgermeister Vetter in die Telefonmuschel: „Doris, Schätzchen, könntest du mir Hans geben?“ Er legte den Hörer auf und lehnte sich zurück. Reser war der Richtige: Mit ihm könnte er so eine Sache durchziehen.
„Hans, du alter Drecksack, was machst du heute Abend?“
„Keine Ahnung“, sagte Reser, „vermutlich muss ich zuhause bleiben, weil ich die letzten drei Tage Termine hatte.“
„Komm doch mit deiner Frau zu uns.“
„Kann ich machen, warte mal, ich schau nur eben in den Terminkalender.“
„Brauchst gar nicht zu schauen“, frotzelte der Bürgermeister, „du hast schon einen Termin bei mir.“
„Stehen nur die Lions drin.“
„Die kannst du schwänzen. Da müsste ich auch hin.“
„Okay.“
„So um acht.“
„Gut.“
„Bis dann.“
Vetter legte auf. Seine Sekretärin stürzte herein. „Sie müssen heute Abend zur Bürgervereinigung Nord-West!“
„Nee“, sagte der Oberbürgermeister.
„Sie haben es fest versprochen“, jammerte Doris, „und ich auch, mindestens dreimal hat Kindler angerufen, ob es auch klappt“.
„Kann nix dafür.“
Vetter hob in gespieltem Bedauern die sorgfältig manikürten Finger, spreizte sie geziert und fuhr sich mit ihnen betont theatralisch durchs gefärbte Haar, wobei er den Kopf affektiert zurückwarf. Er fand es ab und zu lustig, den Neurotiker zu geben, aber Doris war heute nicht nach Lachen zumute; sie hatte diese Szene auch schon zu oft gesehen, um beeindruckt zu sein. Sie gehörte zu seinem Standartrepertoire. Außerdem fand sie, dass sich Neurotiker anders benehmen, nämlich so, wie sich der Oberbürgermeister benahm, wenn er normal war.
„Reser kommt. Er hat nur heute Zeit.“ Vetter fragte sich, wie viel sie mitgehört hatte. Nur den Anfang oder alles? Eigentlich war es ihm egal. Politik ist Politik. Das musste sie langsam wissen, dass hier Notlügen benötigt wurden.
Doris hatte das ganze Gespräch mitgehört. Sie wusste schon seit langem, dass der Oberbürgermeister log. Es machte ihr nichts mehr aus. Am Anfang hatte es sie gestört, wenn er sie mit seinem jungenhaften Lächeln anschwindelte. Heute nahm sie das mit dem selben Gleichmut hin, wie sie das Wetter hinnahm. Sie wollte auch nicht ewig seine Sekretärin bleiben. Sie hatte eine schöne Stimme, die vielleicht eine Kleinigkeit zu dünn geraten war, und sie wollte mehr Zeit mit Singen verbringen, vielleicht sogar Berufssängerin werden. Sie hatte schon eine CD aufgenommen und tingelte an Wochenenden mit lokalen Kapellen über die Dörfer. Das machte ihr viel Freude. Eigentlich lebte sie nur dafür. Der Oberbürgermeister mit seinen Terminen konnte ihr gestohlen bleiben. Irgendwie spürte er das auch. Er hatte deshalb schon seine Fühler nach Ersatz ausgestreckt, damit Doris ihn nicht mit ihrer Kündigung überraschen konnte. Denn „The Games must go on“, wie er ständig witzelte.
Doris sammelte ein paar Notizen auf dem Schreibtisch ein, überhörte die beleidigende Bemerkung Vetters („Was macht das Gezirpe, Inge?“) und ging in das Vorzimmer. Aus diesen dürren Notizen musste sie formvollendete und höfliche Briefe machen. Vetter überließ ihr viel, sogar die Formulierungen. Doris rief den Vorsitzenden der Bürgergemeinschaft Nord-West an.
„Es tut mir leid, Herr Kindler, aber der OB kann heute leider nicht kommen. Das Ministerium hat angerufen. Er muss nach Stuttgart.“
„Er hat es doch so fest versprochen“, jammerte Kindler. „Viele werden nur wegen ihm kommen. Was soll ich denen sagen?“
„Sagen Sie die Wahrheit“, grinste Doris.
Kindler schwor sich, am Abend beim OB vorbeizufahren und in seine Garage zu schauen, ob der grüne Mercedes drinnen geparkt war. Aber gleich darauf wusste er, dass er es nicht tun würde. Aber einmal würde er den Bürgermeister beim Lügen erwischen und es weitererzählen, darauf konnte sich dieser Gockel verlassen. Kindler ahnte nicht, dass die meisten in Schlossenhausen schon wussten, dass der Oberbürgermeister log. Meistens waren es nur höfliche Notlügen gewesen, aber in letzter Zeit dehnte der OB diese Notlügen ein bisschen arg weit aus. Kindler dachte an seinen Onkel, den Friseur, der dem Bürgermeister die Haare färbte. Ein Mann, der sich die Haare färbt, ist irgendwo auch ein Gauner, brummelte Kindler in sein fliehendes Kinn und machte sich auf den Weg in den Festsaal, wo er seinen Mitgliedern erklären würde, dass der Oberbürgermeister ein Arschloch sei und deshalb nicht kommen könne. An ihm blieb immer alles hängen.
|Das verwendete Bild stammt von Max Köhler.|©