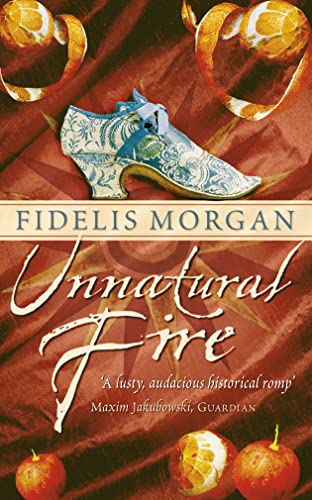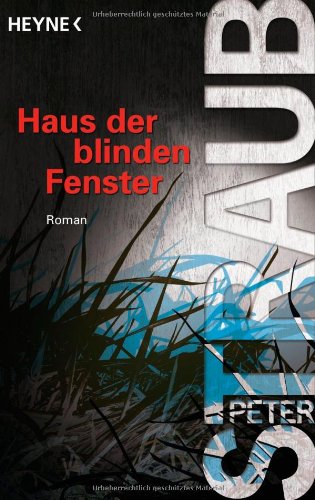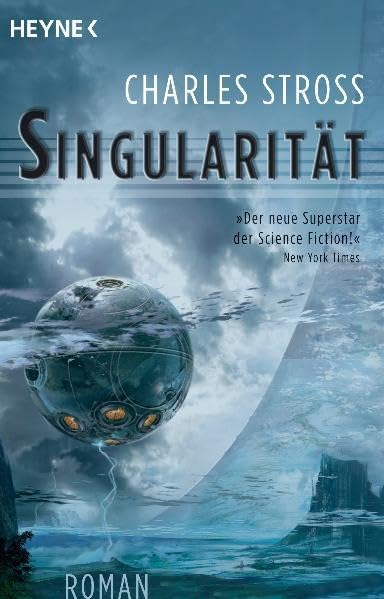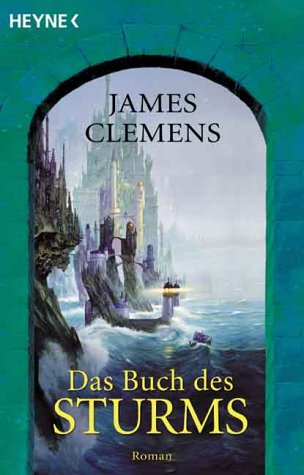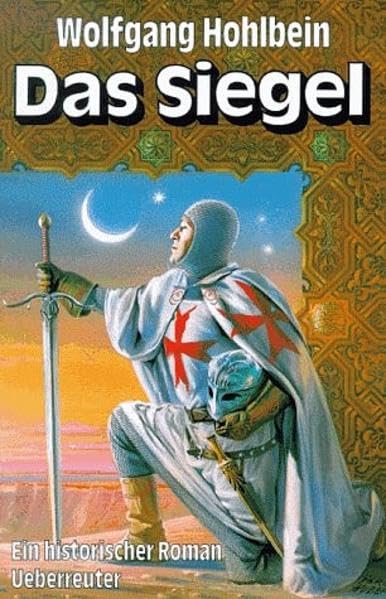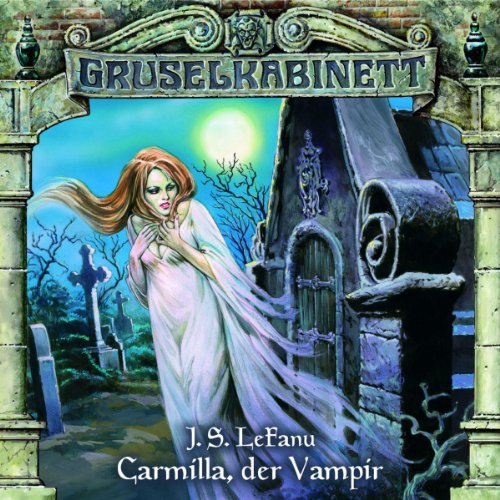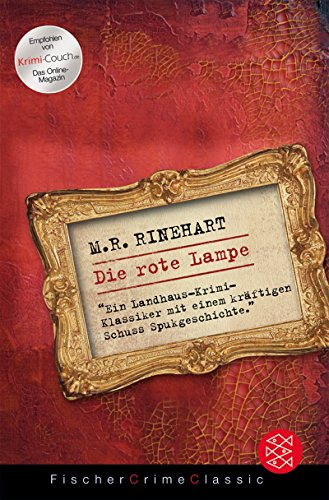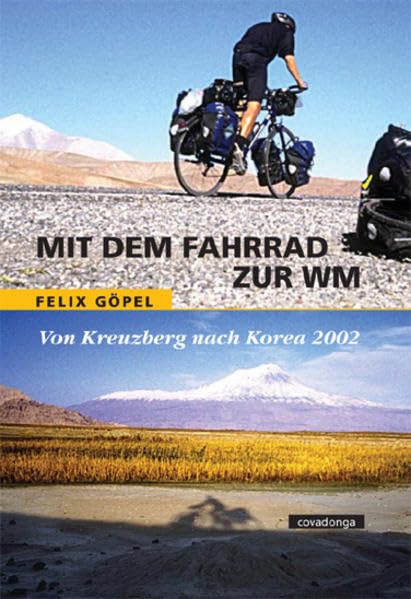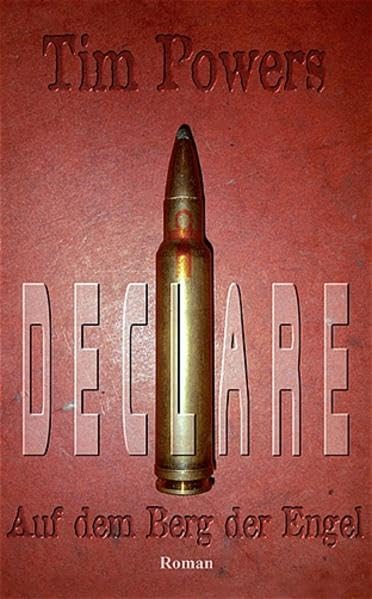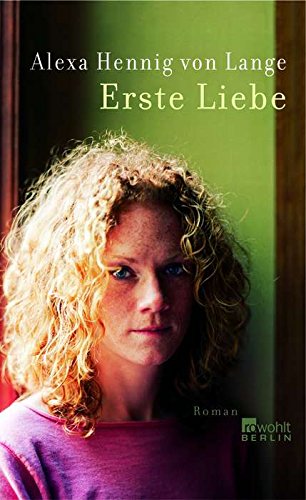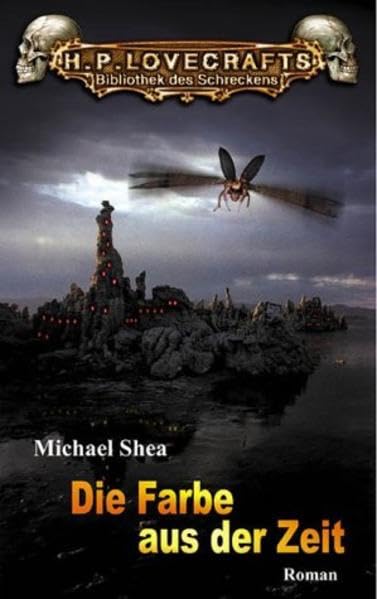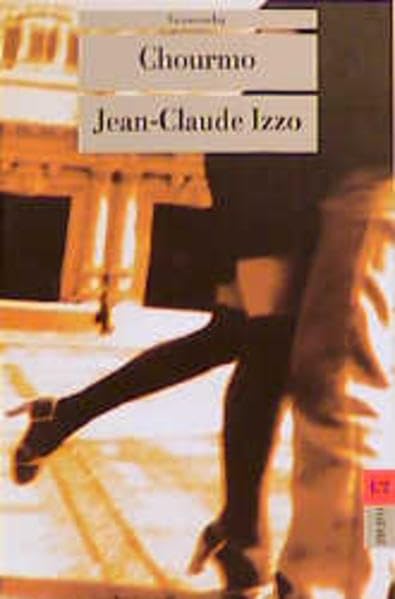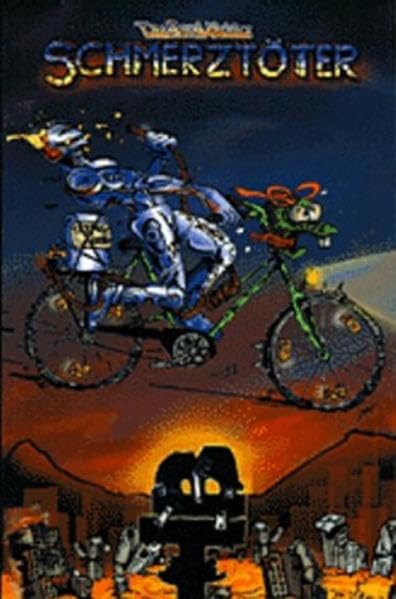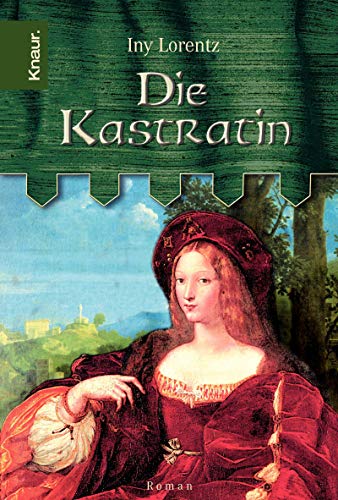_Die Autorin_
Fidelis Morgan wurde durch einen Streich des Schicksals in einem roten Zigeunerwagen in der Nähe von Amesbury geboren. Wann dieses denkwürdige Ereignis exakt vor sich gegangen ist, ist anscheinend ein gut gehütetes Geheimnis, doch es muss wohl in den 50er Jahren gewesen sein. Sie ist als Tochter eines Zahnarzts im Raum Liverpool aufgewachsen und hat einen Abschluss in „Drama and Theatre Arts“ von der Birmingham University. Dort hat auch ihr Interesse an der Restaurationsperiode und insbesondere ihrem Theater seinen Ursprung genommen. Heute ist Fidelis Morgan eine recht erfolgreiche Schauspielerin. Obwohl sie auch in britischen Fernsehproduktionen wie u.a. „Jeeves & Wooster“, „Big Women“, „Mr. Majeika“, „As Time Goes by“ und „Dead Gorgeous“ aufgetreten ist, liegt ihr Erfolg doch hauptsächlich am Theater. Besonders gerühmt wurde ihre Arbeit am Glasgow Citizens Theater. Neben der Schauspielerei hat sie auch an der Adaption von Romanen für die Bühne mitgearbeitet. Bevor sie begann, historische Romane zu schreiben, hat sie bereits fachliche Abhandlungen über Theater und Schauspieler der Geschichte, insbesondere der Restaurations-Periode, veröffentlicht.
„Unnatural Fire“ war Fidelis Morgans erster Roman und zugleich ist er der erste Band einer Serie von vier historischen Kriminalromanen um zwei eher ungewöhnliche Detektivinnen. Die nachfolgenden drei sind: „The Rival Queens“, „The Ambitious Stepmother“ und „Fortunes Slave“. Weitere Bücher dieser Reihe scheinen momentan nicht geplant zu sein. Für alle, die sich nicht an die englische Originalausgabe trauen, ist unter dem Titel „Die Alchemie der Wünsche“ eine deutsche Übersetzung des hier behandelten ersten Teils erschienen (siehe unten).
_Alchemie und Mord_
Unsere Geschichte spielt im London des Jahres 1699: Anastasia Ashby de la Zouche, Baroness Penge und Countess of Clapham, eine ehemalige Geliebte von Charles II., durchlebt schwere Zeiten: Nicht nur, dass ihr betrügerischer Ehemann ihr mitsamt des Familiensilbers nach Amerika entwischt ist, außerdem plagen die Gräfin auch akute Geldsorgen. Fast alle versetzbaren Möbel ihres Hauses sind bereits verhökert und von den ehemals zahlreichen Dienern ist ihr nur noch der eher exzentrische, alte Godfrey geblieben. Dem Schuldturm entkommt sie nur noch, in dem sie ihre Gabe, Skandale auszuschnüffeln, einem Zeitungsverleger anbietet. Gemeinsam mit Alpiew, ihrer einstmaligen Kammerzofe, will sie nun für die Zeitung die Schmutzwäsche der Reichen und Bedeutsamen durchsuchen.
Doch eines Tages erscheint eine Dame, die Alpiew und die Gräfin anheuert, ihrem eigenen Mann nachzuspionieren, den sie verdächtigt, eine Geliebte zu haben. Die beiden folgen dem vermeintlich betrügerischen Ehemann Beau Wilson einen Tag lang und werden Zeuge, wie der Mann im übelsten Viertel der Stadt entführt wird, nur um am nächsten Tag vergnügt pfeifend wieder vor seiner eigenen Haustür zu stehen, als sei nichts passiert. Als sie ihm am zweiten Tag nachspionieren, trifft er tatsächlich mit einer Frau zusammen, von einem zärtlichen Stelldichein kann aber keine Rede sein, denn die Gräfin stolpert kurz darauf über seine Leiche und die Frau entkommt in das Dunkel der Nacht.
Als die Behörden die Ehefrau des Ermordeten festnehmen, bietet diese dem weiblichen Spürnasenteam eine reiche Entlohnung, wenn es Beweise ihrer Unschuld oder – noch besser – den wahren Mörder finden könnte.
Und damit beginnt die Schnitzeljagd der beiden unwahrscheinlichen „Detektivinnen“ durch das historische London, durch alchimistische Labore, Theater, französische Restaurants, Gefängnisse und dunkle Spelunken. Während für Mrs. Wilson im Gefängnis die Zeit immer knapper wird, können die Countess und Alpiew einige Ungereimheiten in Beau Wilsons Leben entdecken, und in einem alchimistischen Labor finden sie bald darauf das Hausmädchen Betty tot auf, deren Leiche im Dunkeln leuchtet. Und Bettys letzter Hinweis auf ihren Mörder ist die Zahl 33.
_Zwei alte Schachteln räumen auf_
Selten sind mir zwei außergewöhnlichere Hauptfiguren in einem historischen Roman untergekommen. Wer liest, die Hauptfiguren eines historischen Kriminalromans seien eine Gräfin und ihre Ex-Zofe, hat vermutlich – genau wie ich – instinktiv gewisse Vorstellungen von den beiden: jung, vermutlich ziemlich hübsch, aber keineswegs auf den Kopf gefallen. Nun, zumindest mit den ersten beiden Vermutung hat man weit gefehlt. Die Countess, die die 60 bereits seit einer geraumen Zeit überschritten hat, hat ein etwas heruntergekommenes Äußeres, ein faltiges Gesicht und die zerzauste rote Perücke rutscht ihr dauernd vom Kopf. Alpiew ist mit circa 40 auch nicht mehr taufrisch und ihr bestechendstes äußerliches Merkmal ist ihre im wahrsten Sinne des Wortes „herausragende“ Oberweite. Aber auf den Kopf gefallen sind sie denn nun wirklich nicht, und wenn sie auch nicht alles wissen, so beweisen sie doch immer wieder einen gesunden Verstand und zeigen sich vor allem stets aufs Neue „bauernschlau“.
Auch die sonst fast schon unvermeidlich erscheinende Liebesgeschichte, die schon so manchen guten Krimi auf Barbara-Cartland-Niveau heruntergezogen hat, hat sich Fidelis Morgan klugerweise gleich ganz gespart. Und Liebe beschränkt sich hier auf einen eher derben Quickie in einer Amtsstube. Allzu zimperlich sollte man als Leser nicht sein, und den einen oder anderen Kraftausdruck muss man hinnehmen, was mir aber für Zeit und Handlung eher realistisch erscheint.
Gräfin Anastasia und ihre Ex-Zofe Alpiew in ihrem etwas heruntergekommenen Zustand lassen sich in keine mir bekannte Schublade pressen. Fidelis Morgan hat hier wirklich etwas ganz Eigenes geschaffen, quasi eine völlig neues Romangenre, die barocke Krimikomödie. Das allein ist unbedingt bereits ein ungeheurer Verdienst, darüber hinaus fand ich aber auch den Schreibstil überaus lobenswert. Denn das Buch ist zwar sehr humorvoll, dabei aber kein bisschen flach. Die Personen sind allesamt tief gezeichnet und von hoher Originalität. Obwohl ich viel in diesem Genre lese, kann ich keinerlei Anleihen bei anderen Autoren feststellen.
Das verwendete Englisch lässt sich gut lesen und die Satzkonstruktionen sind nicht ausufernd, doch durch das historische Setting und die Thematik kommen schon mal ein paar Wörter vor, die dem Nicht-Muttersprachler vielleicht nicht bekannt sind und sich auch nicht im nächsten Taschenwörterbuch werden finden lassen, die Bedeutung ist aber stets durch den Kontext ersichtlich.
Der historische Hintergrund ist außergewöhnlich gut recherchiert und Frau Morgan hat ihr spezifisches Theater-Fachwissen an einigen Stellen sehr gut eingebracht, ohne auch nur ein einziges Mal schulmeisterlich zu wirken oder durch die dargestellte historische Detailliertheit die Geschichte selbst einzuengen.
Dies ist für mich eine eher ungewöhnliche historische Periode und hebt sich sehr angenehm von der Masse der sonstigen historischen Settings für Kriminalromane ab. Den sehr „barock“ wirkenden Hintergrund mit seinen gepuderten Perücken, Schönheitspflästerchen und den lockeren Sitten hinter einer oft steif wirkenden Fassade sowie die dieser Zeit angepasste Sprache von Fidelis Morgan muss man aber schon mögen, um diesem Buch etwas abgewinnen zu können. Da sie den historischen Hintergrund aber so lebendig zeichnet, dass er fast schon dreidimensional auf mich wirkt, fiel mir das erstaunlich leicht, auch wenn das nicht mein bevorzugtes Zeitalter ist.
Der Titel der deutschen Übersetzung „Die Alchemie der Wünsche“ ist etwas irreführend, denn wenn der alchimistische Wissensstand dieser Zeit auch Erwähnung findet, so bleibt dies doch eher eine Nebensache. Erwähnenswert ist es auch, dass der Nachbar der Gräfin, Isaac Newton, in dem Buch einen Gastauftritt hat und durch sein Wissen zur Lösung des Rätsels beitragen kann. Fraglich bleibt für mich aber, ob die deutsche Übersetzung es wohl geschafft hat, den sehr eigenen Humor des Buches angemessen rüberzubringen – auf alle Fälle eine Herausforderung für den Übersetzer.
Ein winziger Kritikpunkt findet sich vielleicht in dem kriminalistischen Plot, denn bei so viel Humor und Geschichte hat der Leser zu Beginn Mühe, auch noch Spannung zu empfinden. Nach Wilsons Mord, allerspätestens aber als Alpiew die leuchtende Leiche Bettys findet, ist es mit diesem Kritikpunkt vorbei und die Geschichte wird so spannend, wie sie als Krimi ja auch sein sollte. Dass am Ende zwei, drei kleinere Fäden der Geschichte ungelöst bleiben, ist ein Schönheitsfehler, den man dann gut verschmerzen kann. Auch gibt die Autorin dem Leser meiner Meinung nach an manchen Stellen zu viele Lösungshinweise, so dass wir Alpiew und der Gräfin hin und wieder bei der Lösung des Mordes einen halben Schritt voraus sind. Das nimmt dem Ganzen ein Quentchen Spannung, es passiert aber nicht allzu häufig.
_Fazit_
Endlich kann ich mal wieder ein Buch uneingeschränkt weiterempfehlen. Zwar ist „Unnatural Fire“ durch den späten Spannungseinsatz und eine begrenzte Vorhersehbarkeit nicht perfekt, aber diese kleineren Mängel werden für mich durch die sehr orginellen und sehr gut gezeichneten Protagonisten, einen interessanten Plot, ein ausgezeichnetes historisches Setting, den dicht gewobenen Schreibstil und die lobenswerte Recherchearbeit mehr als aufgewogen. Als historischer Krimi-Erstling ein wundervolles Buch, das neugierig auf die weiteren Bände dieser kleinen Serie macht.
Homepage der Autorin: http://www.fidelismorgan.com
_Deutsche Fassung als:_
[„Die Alchemie der Wünsche“]http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3499233371/powermetalde-21
ISBN: 3499233371
|rororo| Dezember 2002
Erstausgabe bei |Wunderlich im Rowohlt| 2001