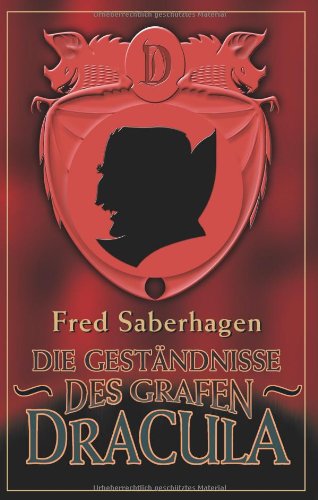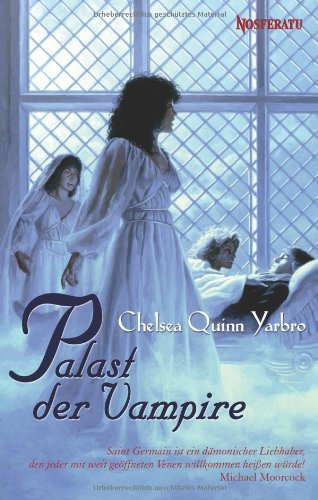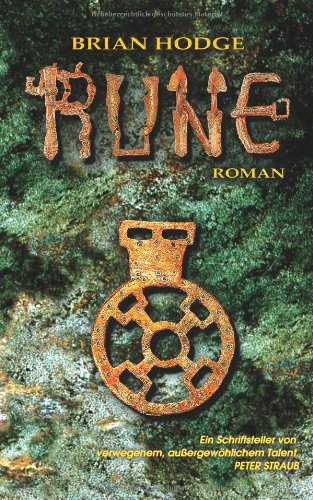Frank Festa (Hg) – Das rote Zimmer. Lovecrafts dunkle Idole II weiterlesen
Schlagwort-Archiv: Festa
Frank Rainer Scheck / Erik Hauser (Hg.) – Berührungen der Nacht. Englische Geistergeschichten in der Tradition von M. R. James
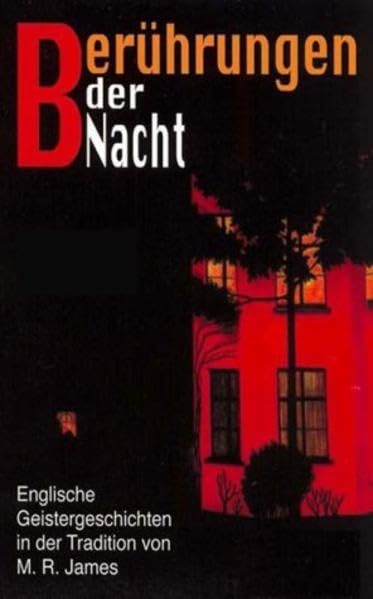
Frank Rainer Scheck / Erik Hauser (Hg.) – Berührungen der Nacht. Englische Geistergeschichten in der Tradition von M. R. James weiterlesen
F. Paul Wilson – Handyman Jack. Erzählungen
Elf Geschichten aus der Welt auf ihrem Weg in den Untergang: Sechsmal geht Handyman Jack, gesetzloser aber moralischer Retter der Unterprivilegierten, gegen Mörder, Wahnsinnige und Ungeheuer vor; fünf weitere Storys erzählen vom Einbruch des Phantastischen in die Realität, was in der Regel katastrophal endet:
– Zwischenspiel im Drugstore (Interlude at Duane‘s, 2006), S. 7-22: Ausgerechnet an einem Tag, als er waffenlos unterwegs ist, gerät Jack in einen Raubüberfall. Der Tatort – ein Supermarkt – bietet indes viele Möglichkeiten für einen improvisationsfreudigen Mann.
– Ein ganz gewöhnlicher Tag (A Day in the Life, 1989), S. 23-68: Eine Schutzgeld-Mafia soll er ausschalten, und ein rachsüchtiger Killer sitzt ihm im Nacken, doch Jack findet eine Möglichkeit, den Job mit der Gegenwehr zu kombinieren. F. Paul Wilson – Handyman Jack. Erzählungen weiterlesen
Festa, Frank (Hg.) – Denn das Blut ist Leben. Geschichten der Vampire
Schon einmal ist im |Festa|-Verlag eine Anthologie mit Vampirgeschichten erschienen. Damals suchte HR Giger, wohl am besten bekannt als der Schöpfer des „Aliens“, die Geschichten aus und veröffentlichte sie in einem durchaus umfangreichen Band namens „HR Gigers Vampirric“ – mehrere Geschichten dieser Anthologie fanden sich später auch als [Hörbuchfassungen bei LPL records 1839 wieder. Nun hat Verleger Frank Festa die Zügel selbst in die Hand genommen und ebenfalls eine stattliche Zahl von Geschichten zusammengestellt: „Denn das Blut ist Leben“ heißt seine Anthologie ziemlich treffend. Und im Untertitel liest man dann „Geschichten der Vampire“ – nicht etwa Geschichten |von| Vampiren oder |über| Vampire. Nein, solcherart einschränken möchte sich Festa nicht, und daher sind die zweiundzwanzig ausgewählten Erzählungen so abwechslungsreich wie nur irgend möglich. Sie sind jung oder alt, lang oder kurz, bekannt oder unbekannt, realistisch oder völlig fantastisch, historisch oder zeitgenössisch. Kurzum, in „Denn das Blut ist Leben“ dürfte sich für jeden Geschmack die passende Geschichte finden.
Dabei sieht sich eine Vampiranthologie natürlich mit einer gewissen Startschwierigkeit konfrontiert: Der Leser weiß, womit er es zu tun hat. Die Überraschung, die ein Autor für seine Geschichte geplant hatte, wird eventuell dadurch zerstört, dass der Leser zu gut informiert ist. Er weiß, dass es in der Geschichte auf irgendeine Art und Weise um Vampire gehen muss, und er interpretiert die Hinweise, die ein Autor wohlweislich hinterlässt, in entsprechender Weise. Dadurch durchschaut er in der Regel die Crux einer Geschichte schneller, als der Autor dies wohl ursprünglich geplant hatte.
Mit diesem Problem müssen sich viele Geschichten dieser Anthologie herumschlagen. So könnte „Stragella“ von Hugh B. Cave den Leser lange an der Nase herumführen. Cave spinnt hier ein wunderbares Seemannsgarn und erzählt die Geschichte von zwei Schiffbrüchigen, die in ihrem kleinen Rettungsboot in einer Nebelbank auf ein verlassenes Schiff treffen. Lange könnte der Leser spekulieren, was es mit diesem Schiff auf sich hat, denn es wird bald klar, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Doch der Leser kommt ihm zuvor und erwartet förmlich die Ankunft der Vampire. Dieses Wissen, diese Erwartungshaltung schmälert in Caves Fall kaum die Wirkung der Geschichte. Seine Erzählung ist so wild, abenteuerlich und ungeheuerlich, dass man sie trotzdem in vollen Zügen genießen kann. Einer kurzen Erzählung wie „Rückkehr in den Tod“ von J. Wesley Rosenquist ist dieses Privileg nicht vergönnt. Seine kleine Mär von einem lebendig Begrabenen, der bei seiner „Wiederauferstehung“ fälschlicherweise für einen Vampir gehalten und daraufhin prompt wieder in die ewigen Jagdgründe befördert wird, kann den Leser kaum überraschen.
Ein erstes Highlight (wenn man mal von der Auftakterzählung [„Draculas Gast“ 1086 von Bram Stoker absieht, die sich ohnehin in wirklich jeder Vampiranthologie wiederfindet) ist Graham Mastertons „Der Laird von Dunain“. Als armer Leser fühlt man sich zunächst wie im falschen Film: Claire macht Bildungsurlaub in Schottland. Zusammen mit einer Gruppe Gleichgesinnter verbringt sie einige Tage auf dem Anwesen des Laird von Dunain, um dort einen Malkurs zu absolvieren und etwas von der Landschaft zu sehen. Der Laird stellt sich zunächst als archetypischer Schotte dar, komplett mit Kilt, Schafwollpullover und roter, wilder Mähne. Die Frauen im Malkurs können sich ob des Anblicks einen kollektiven Seufzer nicht verkneifen, doch es ist Claire, auf die es der Laird abgesehen hat. Sein Porträt soll sie malen, doch da sie seine Gesichtsfarbe auf der Leinwand einfach nicht hinbekommt, greift sie zu drastischen Mitteln … Zu Beginn fühlt man sich ein bisschen wie in einem Groschenroman – dieses Setting, diese Charaktere sind wie gemacht für eine Liebesschnulze. Doch Masterton dreht das Ruder flott herum und schreibt stattdessen eine Geschichte, die sich irgendwo zwischen Vampirmär und Dorian-Grey-Interpretation einordnen lässt. Das Thema des Porträts, das stellvertretend für einen Menschen steht, scheint ihn zu faszinieren. In seinem Roman „Family Potrait“ hat er diesen Plot noch einmal aufgegriffen.
Auch Edgar Alan Poe findet sich mit seiner Geschichte „Ligeia“ in Festas Anthologie. Sicherlich hätte es auch „Berenice“ treffen können – beide Geschichten befassen sich mit dem Vampirthema. Poe jedoch, und diese Meisterschaft erkennt man schon nach wenigen Absätzen, verabschiedet sich vom gemeinen Blutsauger, vom geradlinigen Blutausaugen, Sterben, Wiederauferstehen. Bei ihm geht es um die vampirische Liebe – um die Liebe, die alles verzehrt, bis das geliebte Objekt daran zugrunde gehen muss. Dieses subtile Grauen, dieses Unterschwellige, nie wirklich Ausgesprochene macht Poes Erzählung so beunruhigend. Der Ich-Erzähler verfällt dem Wahn, kann nichts anderes denken als „Ligeia“, verzehrt sich nach der Geliebten und bringt ihr damit den Tod. Doch dieser Wahn ist nicht nur böse, er leuchtet mit einer düsteren Schönheit, und diese Schönheit ist es, die den Leser ängstigt.
Noch einmal ist es Graham Masterton, der mit der kurzen Geschichte „Verkehrstote“ ein kleines Juwel besteuert, das ganz auf den Effekt und die Pointe setzt. Sein Protagonist ist Dracula, doch ist er nicht der übergroße Vampir, den wir aus Stokers Roman kennen. Auch Dracula scheint müde geworden. So ganz ist er nicht im 20. Jahrhundert angekommen. Er ärgert sich darüber, dass man heutzutage kein vernünftiges Personal mehr finden kann, und hat das Briefeschreiben aufgegeben, weil es ihn deprimiert, dass seine Briefpartner irgendwann sterben. Dieser Dracula ist kauzig, nicht lebensfähig, und so wird ihm am Ende der Geschichte ein wirklich banaler Schicksalsschlag den Garaus machen. Er wird eingeholt von der Zivilisation, wortwörtlich überfahren vom Fortschritt. Der arme Kerl!
Frank Festa ist mit „Denn das Blut ist Leben“ eine vergnügliche (nun ja, im gruseligen Sinne) Auswahl gelungen. Die Geschichten kommen, bis auf wenige Ausnahmen, auf wirklich hohem Niveau daher. Man wird einige alte Bekannte wiedertreffen, wie zum Beispiel H. P. Lovecraft oder Théophile Gautier. Und man kann einige unbekanntere Namen entdecken – Frank Festa ist sich auch nicht zu schade, seinen „eigenen“ Autoren (wie F. Paul Wilson oder P. N. Elrod, die eine ungemein amüsante Geschichte aus ihrem Jack-Fleming-Universum beisteuert) eine Plattform zu bieten. Mit den über 400 Seiten garantiert die Anthologie jedenfalls langanhaltenden Lesegenuss.
In Festas Anthologie sind folgende Geschichten enthalten:
Bram Stoker: „Draculas Gast“
J. Wesley Rosenquist: „Rückkehr in den Tod“
Graham Masterton: „Der Laird von Dunain“
Simon Clark: „Vampir-Abschaum“
Edgar Allan Poe: „Ligeia“
Edmond Hamilton: „Das Vampirdorf“
F. Marion Crawford: „Denn das Blut ist Leben“
Brian Hodge: „Die Alchemie der Stimme“
H.P Lovecraft: „Das gemiedene Haus“
Simon Clark: „Hotel Midnight“
Théophile Gaultier: „Die verliebte Tote“
Alice Olsen: „Winternacht“
Raymond Whetstone: „Die durstigen Toten“
Clark Ashton Smith: „Ilalothas Tod“
Graham Masterton: „Verkehrstote“
Karl Hans Strobl: „Das Aderlassmännchen“
Anonymus: „Die Vampirkatze von Nabèshima“
Hugh B. Cave: „Stragella“
Henry Kuttner: „Ich, der Vampir“
Patricia N. Elrod: „Spätvorstellung“
Lester del Rey: „Feuerkrank“
F. Paul Wilson: „Mitternachtsmesse“
|Originalausgabe
Großformat Paperback 13,5 x 21 cm
416 Seiten|
http://www.FESTA-Verlag.de
Fred Saberhagen – Die Geständnisse des Grafen Dracula
Er lebt zwar nicht mehr, aber das ist für ihn kein Grund, sich mit übler Nachrede abzufinden: Graf Dracula, stolzer Kriegerfürst aus Transsylvanien und im 15. Jahrhundert zum Vampir mutiert, ärgert sich hoch im 20. Jahrhundert noch immer über ein altes Buch, das als Titel seinen Namen trägt und schildert, wie er im Jahre 1891 angeblich sein düsteres Schloss verließ, um England zu terrorisieren und dort unschuldigen Bürgern meist weiblichen Geschlechts das Blut auszusaugen.
Was ein gewisser Bram Stoker einst an Aussagen von Zeitzeugen wie Abraham Van Helsing, Jonathan Harker, Mina Murray, Lucy Westenra oder John Seward zusammentrug, ist nach Draculas Ansicht eine Sammlung schamloser Verdrehungen, Missverständnisse und Fehlinterpretationen. Eines Nachts im Jahre 1975 entführt er Arthur Harker, einen Nachfahren Jonathans, und seine Gattin: Endlich will Dracula die wahre Geschichte erzählen. Fred Saberhagen – Die Geständnisse des Grafen Dracula weiterlesen
H. P. Lovecraft: Das schleichende Chaos

H. P. Lovecraft: Das schleichende Chaos weiterlesen
Yarbro, Chelsea Quinn – Palast der Vampire
[„Hotel Transylvania“ 2706 war der erste Streich in Chelsea Quinn Yarbros episch angelegter Chronik um den Vampir Saint-Germain. Damals trieb er im Paris des 18. Jahrhunderts sein Unwesen – wobei „Unwesen“ zu viel gesagt wäre: Saint-Germain ist nämlich ein Untoter mit Anstand und einem Faible für die schönen Dinge des Lebens. Anstatt sich wie sein berühmtester Artgenosse an Burgmauern hinabzuhangeln und das Blut von unschuldigen Jungfrauen in alle Ecken des Zimmers zu verspritzen, beschäftigt er sich lieber mit Kunst – und mit der genussvollen Verführung schöner und williger Frauen!
Wer nun aber denkt, der zweite Band „Palast der Vampire“ knüpfe nahtlos an „Hotel Transylvania“ an, der irrt. Yarbro überrascht ihre Leser damit, dass sie den Roman nicht nur in einem anderen Land, sondern auch in einer anderen Zeit spielen lässt. Diesmal befinden wir uns im Florenz des ausgehenden 15. Jahrhunderts. Florenz ist zu dieser Zeit ein florierendes wirtschaftliches und kulturelles Zentrum Europas. Unter der Führung der Medici wird nicht nur Tuch exportiert, sondern auch Künstler wie Botticelli werden gefördert. Also genau der richtige Ort für Saint-Germain, der sich mit Vorliebe am Puls der Zeit niederlässt.
Zwar gilt er in Florenz als Ausländer, doch ist er gebildet und faszinierend genug, um von den Florentinern akzeptiert zu werden. Mit großem Brimborium baut er einen Palazzo – natürlich mit geheimen Kammern für seine alchimistischen Studien. Diese sollen ihm jedoch bald zum Verhängnis werden, denn als Laurenzo de Medici stirbt, schlägt die liberale Stimmung in Florenz rasch um.
Mehr und mehr reißt nämlich der Dominikanermönch Savonarola die Macht in Florenz an sich. Mit einer rigiden Bibelauslegung verdammt er alle Kunst, alle Annehmlichkeiten und alle Schönheit als eitle Sünde aus der Stadt. Seine Militia Christi, bei genauer Betrachtung nicht mehr als eine Gruppe randalierender Jugendbanden, dringt in Häuser ein und zerstört die Einrichtung. Gemälde werden verbrannt, das Spielen von Musik untersagt. Und Saint-Germain als Ausländer wird natürlich schnell zur Zielscheibe von Savonarolas Hass. Als eine ehemalige Geliebte in einer öffentlichen Beichte seinen Namen in den Schmutz zieht, muss Saint-Germain fliehen. Doch was ist mit seinem Protegé Demetrice, die darauf besteht, in Florenz zu bleiben?
Es ist ganz allein der Erzählkunst der Autorin zu verdanken, dass „Palast der Vampire“ ein so gelungenes Lesevergnügen ist. Denn wenn man es genau betrachtet, bietet der zweite Band gegenüber „Hotel Transylvania“ nicht viel Neues: Wir haben den Vampir, seinen treuen Diener, eine sich schüchtern entwickelnde Liebesgeschichte und äußere Einflüsse, die sich dem Paar entgegenstellen. Nach dem gleichen Schema verfuhr Yarbro schon in „Hotel Transylvania“, und doch ist „Palast der Vampire“ kein billiger Abklatsch. Und Langeweile kommt auf den 500 Seiten gleich gar nicht auf. Es muss also die Erzählfreude Yarbros sein, die den Leser so bei der Stange hält.
Saint-Germain ist ein Vampir für romantische Frauenträume. Er spielt lieber auf der Laute als Menschen umzubringen. Für ihn ist die Teilnahme am Leben der Menschen, an deren Kultur und Sorgen offensichtlich ein Lebenselixier, das er genauso benötigt wie Blut. Es ist seine Art, die Ewigkeit erträglich zu machen. Dass sich ihm dabei gern eine schöne und ebenso kluge Frau an die Seite stellt, macht die Sache nur noch interessanter. Demetrice ist, wie schon Madeleine in „Hotel Transylvania“ keineswegs ein Frauchen. Sie ist studiert, hat die Bibliothek des Medici katalogisiert und überredet Saint-Germain, sie in der Alchimie zu unterrichten. Erst als klar ist, dass beide gleichberechtigte Partner sein können, bringt Yarbro zarte Gefühle ins Spiel.
Ebenso faszinierend ist ihr Florenz des 15. Jahrhunderts. Wie auch schon im ersten Band, ist „Palast der Vampire“ in erster Linie ein historischer Roman. Yarbro versteht es, ins Detail zu gehen, ohne zu langweilen. Der Roman lebt von dem Gegensatz zwischen dem schöngeistigen Saint-Germain und dem radikalen Mönch Savonarola. Für Yarbro ist das Florenz des 15. Jahrhunderts keineswegs der Sündenpfuhl, den der Dominikaner darin sieht. Florenz ist für sie das Zentrum der Renaissance. Durch die Medici kommt die Stadt zur Blüte, Kunst und Naturwissenschaft sind auf dem Höhepunkt. Ausländer und Studenten strömen in die Stadt, um am Fortschritt teilzuhaben. Savonarola jedoch wirft Florenz um Jahre zurück. Mit seinen apokalyptischen Prophezeiungen vom Ende der Welt trifft er offensichtlich einen Nerv bei der Bevölkerung. Doch das führt nur dazu, dass in Florenz der Scheiterhaufen vorweggenommen wird, der später ganz Europa überziehen wird.
Wie auch schon im ersten Band, steht Saint-Germain wieder ein verlässlicher Diener zur Seite. Seinerzeit aus einer offenbar misslichen (und fast tödlichen) Lage befreit, ist Ruggiero seinem Meister treu ergeben. Er ist der einzige Charakter, den ich mir mehr ausgebaut gewünscht hätte. Außer seiner Treue zu Saint-Germain bedenkt ihn Yarbro mit keinen weiteren Charaktereigenschaften, und doch hat man als Leser ständig das Gefühl, hinter der Fassade des Dieners verberge sich ebenfalls eine spannende Geschichte, die das Erzählen lohnen würde. Doch wer weiß, vielleicht erfährt man in einem späteren Band ja mehr über Ruggerio.
„Palast der Vampire“ ist ein echter Schmöker, den man im gestreckten Galopp verschlingen wird. Auf 500 Seiten präsentiert Yarbro eine Geschichte ohne Hänger und Längen, mit einer ausgewogenen Mischung aus Historie, Erotik, Spannung und einem wirklich verachtenswerten Bösewicht. Wenn sie es schafft, dieses Erzähltempo auch in den Folgebänden zu halten, dann steht der geneigten Leserin ein langanhaltender Lesegenuss bevor, schließlich umfasst die Serie bereits 19 Bände!
http://www.festa-verlag.de
Chelsea Quinn Yarbro – Hotel Transylvania

„Hotel Transylvania“ spielt in Frankreich, genauer gesagt im Paris des Sonnenkönigs. Saint-Germain ist eine Lichtgestalt der Pariser Gesellschaft. Auf Partys ist er gern gesehen, als gut aussehendem Junggesellen laufen ihm die Debütantinnen scharenweise hinterher, und als Musiker begeistert er seine Zuhörer. Doch darüber hinaus gibt er der Gesellschaft auch genug Anlass zum Klatsch: Woher kommt Saint-Germain eigentlich? Warum sieht ihn nie jemand essen? Und woher nimmt er all die beeindruckenden Diamanten, mit denen er seine Garderobe aufpeppt?
Elrod, P. N. – tanzende Tod, Der (Jonathan Barrett 4)
[„Der rote Tod“ 821
[„Der endlose Tod“ 863
[„Der maskierte Tod“ 1582
Wir befinden uns im London des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Jonathan Barrett ist zusammen mit seiner Schwester Elisabeth aus den Kolonien angereist, um seine lang verschollene Flamme Nora Jones wiederzufinden. Doch tut er dies nicht (nur) aus gänzlich romantischen Gründen. Jonathan ist nämlich ein Vampir, und Nora für seinen Zustand verantwortlich. Und da im 18. Jahrhundert Vampire lange noch nicht so berühmt sind wie heute, tappt Jonathan im Dunkeln, wenn es darum geht zu definieren, was es mit seinem Zustand genau auf sich hat. Und so hofft er darauf, dass Nora seine zahlreichen Fragen beantworten kann – sollte er sie denn finden.
P. N. Elrods „Der tanzende Tod“ ist nun schon Band vier der Romanreihe um die Abenteuer von Jonathan Barrett. Der Leser durfte ihn zum Studium begleiten, seine Vampirwerdung beobachten, seine ersten zaghaften Schritte als Untoter anfeuern und seine Suche nach Nora Jones begleiten. Doch wurde eben jene Suche im letzten Band, „Der maskierte Tod“, relativ zügig unterbrochen, da Jonathan zwischen die familiären Fronten geriet und – mal wieder – dem Tod mit einem gewagten Satz von der Schippe springen musste, schließlich bewahrt ihn auch sein Vampirismus nicht vor Intrigen, Anschlägen, Duellen und Morddrohungen.
Dies führt dazu, dass sein (Un)Leben in „Der tanzende Tod“ ziemlich auf den Kopf gestellt ist. Plötzlich ist er nämlich Vater (war er doch während seines Studiums in London längst kein Kostverächter) und bekommt den Jungen von dessen leiblicher (und nicht ganz zurechnungsfähigen) Mutter sofort untergeschoben, die das Balg loswerden will. Und so kehrt in Jonathans Haushalt wieder die Friedefreudeeierkuchen-Stimmung ein, die der Leser von P. N. Elrod gewohnt ist.
Doch halt: Ganz so einfach ist die Sache nicht. Wie immer will man Jonathan an den Kragen. Und so muss er auch in diesem Band einigen Kugeln und Anschlägen auf sein Leben ausweichen und nebenbei herausfinden, wer ihm denn eigentlich ans Leder will …
In „Der tanzende Tod“ fährt P. N. Elrod wieder alle Kaliber auf. Jonathan, Elisabeth und Oliver leben mittlerweile zusammen in einem Haushalt und Elrod ergeht sich darin, die Idylle dieser Patchwork-Familie ausgiebig zu beschreiben. Da sind Teestunden mit einer Extrakanne voll Blut für Jonathan nichts Außergewöhnliches. Und als dann auch noch der kleine Richard dazustößt, wird es vorrübergend schier unerträglich zuckersüß. Kein kleines Kind ist ständig so putzig und gut erzogen. Und all die Spielstunden, die Vater und Sohn abends unternehmen, sind relativ repetitiv und tragen darüber hinaus nichts zum Fortkommen der Handlung bei.
Nur gut, dass Elrod ihren Plot bei all dem familiären Zusammensein nicht aus den Augen lässt. Es scheint sich nämlich einiges zusammenzubrauen. Während Jonathan und Oliver genüsslich einen Puff besuchen, der sich als türkisches Bad tarnt, wird Jonathan prompt erschossen. Und als er sich danach anschickt herauszufinden, wer die maskierten Übeltäter waren, hat er schnell noch mehr Häscher auf den Fersen. Nach guter alter Elrod-Manier geht es für Jonathan danach erst einmal steil bergab, bevor er es schafft, die Verschwörung aufzudecken und zu zerschlagen. Und das ist durchaus wörtlich gemeint …
Jonathan hat endlich ein Maß von Vertrauen in seinen Zustand gewonnen. So schließt er nicht jedes Mal mit seinem Leben ab und betet zu sämtlichen Gottheiten (denn eigentlich ist Jonathan ein rechter Feigling), wenn ihm jemand Böses will. Dieses Schema wurde in den vergangenen Romanen langsam ermüdend und so ist es zu begrüßen, dass Elrod es aufgegeben hat. Das bedeutet nicht, dass es keine brenzligen Situationen für Jonathan gibt – der Roman ist voll davon. Doch geht er nun anders mit diesen Situationen um und spielt den Helden auch schon mal überzeugender als in den Anfängen seines untoten Zustands.
Ach, und dann ist da ja noch Jonathans verzweifelte Suche nach seiner verschollenen Liebe Nora Jones. Seit vier Bänden wartet der geneigte Leser nun darauf, dass die beiden sich endlich wiederfinden. Wird es in „Der tanzende Tod“ nun endlich so weit sein, dass die beiden sich in die Arme fallen können? Oder sind die Gerüchte tatsächlich wahr, dass Nora krank darniederliegt? Wird Jonathan eine weitere Seefahrt wagen, um sie in Italien zu suchen?
Um das herauszufinden, gibt es nur eine Möglichkeit: Selber lesen!
http://www.festa-verlag.de
Brian Hodge – Rune
Mount Vernon, ein Städtchen irgendwo im US-Staat Illinois, Ende der 1980er Jahre: Viel tut sich nicht hier in der Provinz, was vor allem die Jugend frustriert. Wie ihre Altersgenossen vertreiben sich die Freunde Chris Anderson, Rick Woodward und Phil Merkley die letzten Monate vor dem College mit Ferienarbeit und abendlichem Herumhängen. Letzteres findet gern in einem abgelegenen Hain an den Ufern eines kleinen Sees statt, den die Freunde „Tri-Lakes“ nennen. Hier lässt es sich faulenzen und ungestört saufen, hierher kann man auch die Freundin zum Fummeln mitbringen.
Doch eine eigentümliche Stimmung lastet auf Tri-Lakes. Nichtige Anlässe führen zu erbitterten, gewalttätigen Auseinandersetzungen. Seltsame Unfälle geschehen. Eines einsamen Abends stürzt Chris gar ein seltsam aussehender Mann vor den Wagen, der sich bei der Autopsie als sechs Tage alte Wasserleiche erweist! Brian Hodge – Rune weiterlesen
Richard Marsh – Der Skarabäus
Das Schicksal hat es wirklich auf ihn abgesehen, denkt Robert Holt, ein zum Landstreicher herabgekommener Londoner Bürger, der in dunkler, kalter Nacht in ein einsam gelegenes Haus einsteigt. Leider steht dies nicht leer; ein unheimliches Wesen haust hier, das kaum Menschenähnlichkeit aufweist und sich womöglich in einen riesigen Skarabäus-Käfer verwandeln kann.
Vor allem ist diese Kreatur abgrundtief böse. Sie hat es auf den jungen Politiker Paul Lessingham abgesehen, der ihr während seines Aufenthalts in Ägypten – über den er sich sorgfältig ausschweigt – nach eigener Auskunft großes Unrecht angetan hat. Bis nach London ist sie Lessingham gefolgt und plant nun sorgfältig dessen politischen Ruin, privaten Untergang und schließlich Tod. Der unglückliche Holt muss ihr als Werkzeug dienen. Mit unwiderstehlicher hypnotischer Kraft wird er gezwungen, in Lessinghams Haus einzubrechen und einige persönliche Briefe zu stehlen, die das Geschöpf über die bevorstehende Verlobung mit der schönen Marjorie Lindon informieren. Richard Marsh – Der Skarabäus weiterlesen
Dan Simmons – Lovedeath
Fünf Kurzgeschichten bzw. Novellen, die um die Themen Liebe oder/und Tod kreisen, sammelt dieser Band, der zwar als „Horror“-Taschenbuch erscheint, aber vergleichsweise wenige Elemente des Übernatürlichen bietet. Stattdessen geht es um die beiden grundlegenden Gefühle in ungewöhnlichen, meist krisenhaften Situationen. Facettenreich und meisterhaft lotet der Verfasser aus, wie erstaunlich und erschreckend dünn die Trennlinie zwischen Liebe (oder Leben) und Tod ist.
Inhalt
Das Bett der Entropie um Mitternacht („Entropy’s Bed at Midnight“, S. 29-70): Ein auf die Untersuchung bizarrer Unglücksfälle spezialisierter Versicherungsvertreter meint die Regel entdeckt zu haben, dass der Tod der Liebe zwingend und unter grausamen Begleiterscheinungen folgen wird …
Tod in Bangkok („Dying in Bangkok“, S. 71-128): Ein ehemaliger Vietnamkämpfer sucht in Thailand nach einem Mutter-Tochter-Vampirpaar, das einst seinen besten Freund auf höchst extravagante Weise zu Tode brachte …
Sex mit Zahnfrauen („Sleeping With Teeth Women“,129-222): Ein junger Indianer begibt sich auf eine lange, gefährliche Reise, an deren Ende er in jeder Beziehung zum Mann gereift oder tot sein wird …
Flashback („Flashback“, S. 223-284): Die Bevölkerung der USA dämmert im Bann einer Droge dahin, die es ermöglicht, vergangene Ereignisse noch einmal zu durchleben …
Der große Liebhaber („The Great Lover“, S. 285-431): Im I. Weltkrieg erlebt ein junger Schriftsteller das Grauen der französischen Schützengräben. Im täglichen Kampf um das Überleben hilft ihm eine wunderschöne Geisterfrau, die er bald für den leibhaftigen Tod halten muss …
Lang oder kurz bzw. irgendwo dazwischen
Die Novelle ist der ungeliebte Bastard zwischen Roman und Kurzgeschichte. Literaturwissenschaftler werden bei diesem Bild aufschreien, doch es trifft dennoch den Kern der Sache. In einem langen Vorwort (S. 13-27) erläutert Dan Simmons, dass diese mittellange Erzählform als höchst marktschädlich gilt. Romane verkaufen sich besser als Kurzgeschichten, Storysammlungen immer noch besser als Novellen. Diese sind gleichzeitig zu lang und zu kurz. Gleichzeitig gibt es freilich gute Gründe für ihre Existenz: Manche Idee ist für die mittellange Form geboren. Nur wenige Autoren gehen jedoch das Risiko ein dies zu berücksichtigen. Lieber walzen sie das, was ihnen eingefallen ist, zum (mehrbändigen) Roman aus.
Dan Simmons kann es inzwischen einen gewissen Konfrontationskurs leisten. Wie Stephen King, Peter Straub oder Clive Barker gehört er zu den ganz Großen der Phantastik, hat sich aber auch in anderen Genres etabliert. In „Lovedeath“ wirft er seinen Verlegern gleich zwei Fehdehandschuhe hin: Er liefert ihnen Novellen, die zu allem Überfluss nicht einmal ‚richtigen‘ Horror bieten.
Obwohl der Leser in seiner Mehrheit ein Gewohnheitstier ist, geht Simmons das Risiko ein, auch sein Publikum zu verwirren. „Tod in Bangkok“ ist fast Grusel, „Flashback“ irgendwie Science Fiction. Doch der Verfasser hält sich nicht an Genregrenzen, die er überspringt und sogar Erzählungen präsentiert, die verdächtig in Richtung Belletristik (= ’schöne‘ bzw. ‚echte‘ Literatur) gehen.
Was Simmons tatsächlich gelingt, ist das Ad-Absurdum-Führen einer viel zu lang postulierten Grenze: die zwischen „E“- und „U-Literatur“ nämlich. „Lovedeath“ bietet schlicht spannende Geschichten, die gleichzeitig Stoff zum Nachdenken bieten. Zwar stößt der Autor gewaltig ins Horn: „Lovedeath“ sollte eigentlich (auch im Original) „Liebestod“ heißen und eine Beziehung zu Richard Wagners Oper „Tristan und Isolde“ herstellen. So schlimm kommt es jedoch nicht; Simmons bietet durchweg schnörkellose Lektürekost. Ohnehin stellt sich die Frage, ob es überhaupt Literatur gibt, in der Liebe und Tod ausgespart bleiben. Auch Simmons hat inhaltlich wie formal sehr unterschiedliche Erzählungen unter den gemeinsamen Titel gestellt, der dadurch wie eine weit gespannte Klammer wirkt.
Faszinierende aber unbequeme Wahrheiten
Betrachten wir uns die fünf Novellen ein wenig näher. „Das Bett der Entropie um Mitternacht“ kreist um die bekannte aber ungeliebte Erkenntnis, dass es Liebe ohne Risiko nicht gibt. Das Schicksal hat den männlichen Protagonisten doppelt geschlagen: Sein Sohn kam bei einem jener tragischen Unfälle um, mit denen er sich beruflich im Auftrag einer Versicherung beschäftigt. Seither lebt er wie auf dünnem Eis, vermeidet ängstlich jedes Risiko und würde vor allem seine kleine Tochter am liebsten niemals aus den Augen lassen. Immer wieder zitiert er aus seinen „orangefarbenen Akten“, in denen er festhält, wie aus einem nichtigen Anlass eine Tragödie erwachsen kann. Der übervorsichtige Vater kommt zu der Erkenntnis, dass er sein Kind nicht vor allen möglichen Übeln bewahren kann oder muss – er raubt sonst ihr und sich die Lebensfreude. Klingt langweilig? Von wegen! Simmons trifft exakt die richtigen Töne, er weiß Gefühle in Worte und Bilder zu übersetzen und spart zwischendurch nicht mit rabenschwarzem Humor, wenn er von ebenso lächerlichen wie grausamen Unglücksfällen erzählt. (2000 griff Simmons dies übrigens für seinen spannenden Thriller „Darwin’s Blade“, dt. „Das Schlangenhaupt“, wieder auf.)
„Tod in Bangkok“ wirkt wie ein „Nebenwerk“ zu Simmons’ berühmten, mehrfach preisgekrönten Romanerstling „Song of Kali“ (1985; dt. „Göttin des Todes“/“Song of Kali“). Das tropische Asien stellt er als dampfende Sickergrube dar. Bangkok ist eine Stadt, in der Suff, Drogen und Sex zusammen mit Gesetzlosigkeit, Korruption. Armut und Schmutz in einer Halbwelt zusammenfließen, in der sogar der Tod käuflich ist. So deutlich wie keine andere Erzählung macht „Tod in Bangkok“ deutlich, wieso Simmons selbst dieses Buch nicht „Leben und Tod“ nannte: Die Liebe kann durchaus beides subsumieren. Die Atmosphäre rücksichtsloser Verderbtheit verleiht „Tod in Bangkok“ als Erzählung eine unheilvolle Anziehungskraft, während die eigentliche Handlung kaum überraschen kann. In den 1990er Jahren mag AIDS als Symbol modernen Schreckens gewirkt haben. Heute hat Gleichgültigkeit diesen Effekt beeinträchtigt; der von Simmons heraufbeschworene Horror aus Sex und ‚verdorbenem‘ Blut verwandelte die Welt doch nicht in ein Siechen- und Beinhaus, sondern blieb mehr oder weniger auf die Länder der Dritten Welt beschränkt, was ihn problemlos ignorierbar werden ließ.
Mythen ohne Tümeleien
„Sex mit Zahnfrauen“ überrascht als farbenprächtiger Streifzug durch die (Mythen-) Welt der nordamerikanischen Ureinwohner. Der weiße Mann beginnt sich bereits breit zu machen auf den Prärien des nur scheinbar unendlich weiten Kontinents aber noch geben die Indianer sich nicht geschlagen und führen wie seit Jahrtausenden ein Leben, das geprägt wird vom Existieren in und von der Natur sowie einem Glauben, der Geister und mythische Wesen in Tieren, Pflanzen, Felsen oder Quellen ortet; das Nebeneinander von Realität und Übernatürlichem wird als völlig normal erachtet.
In dieser harten aber harmonischen Welt erleben wir die Abenteuer eines jungen Tunichtguts, der eigentlich nur der schönen Maid im Nachbarzelt an die Wäsche möchte, stattdessen seine Berufung zum Schamanen erfährt und sich plötzlich auf einer aufregenden Reise durch sein Land wieder findet, die ihren gefährlichen Höhepunkt in der Begegnung mit den „Zahnfrauen“ des Titels findet – einer besonders für geile junge Kerls unerfreulichen Spezies weiblicher Dämonen. Simmons hat fleißig recherchiert für seine Novelle; letztlich sollte man indes vorsichtig sein mit der Beantwortung der Frage, in wie weit oder ob überhaupt es ihm gelungen ist die historische Realität einer versunkenen indianischen Kultur neu zu beleben. Er präsentiert auf jeden Fall seine unterhaltsame, spannende, mit Humor nicht sparende Version, in der er kräftig gegen kitschigen Ethno-Quark à la „Wer mit dem Wolf tanzt“ vom Leder zieht.
Harte Alternativ-Realität
Eine beklemmende Vision gelingt Simmons mit „Flashback“. In den 1990er Jahren galten die Japaner als ökonomische Gegner, welche die USA wirtschaftlich ins Abseits zu drängen oder gar aufzukaufen drohten. Auf dieser Schiene fährt Simmons ein Stück in eine gar nicht so ferne Zukunft. Die USA sind von der Weltmacht zum Armenhaus abgestiegen; die Schulden der Reagan-Jahre haben das einst reichste Land der Welt zum Schuldner Japans und der Europäischen Gemeinschaft gemacht, die ihre Wirtschaftskriege von amerikanischen Soldaten auskämpfen lassen. Damit diese Weltordnung gewahrt bleibt, schleusen die neuen Herren die Droge „Flashback“ in die USA ein. Fast jeder Bürger nimmt es, ist abhängig davon, kommt nicht auf den Gedanken gegen sein Schicksal aufzubegehren.
„Flashback“ erzählt die Geschichte einer Durchschnittsfamilie, die zufällig von diesem Komplott erfährt. Das genretypische Happy-End bleibt aus; dem ungemein detailliert beschriebenen Alltagsleben der dystopischen Art folgt ein konsequent düsteres Finale, das Simmons zudem als Schriftsteller zeigt, der sich schon vor mehr als einem Jahrzehnt nur zu gut vorstellen konnte, was Globalisierung tatsächlich bedeuten kann.
Delirien eines ‚großen‘ Krieges
Beinahe Romanlänge erreicht „Der große Liebhaber“, die eindringlichste aber auch seltsamste Erzählung dieses Bandes. Akribisch rekonstruiert Simmons die fiktiven Erlebnisse eines jungen Mannes und Schriftstellers, der in den Weltkrieg von 1914-18 zieht und seine Erlebnisse während des realen Somne-Feldzugs von 1916 schildert. Dieser entwickelte sich zu einer Hölle auf Erden, in der die Soldaten aller Krieg führenden Länder zu Hunderttausenden verheizt wurden. Simmons kreiert Bilder äußersten Schreckens, die sich eng an zeitgenössischen Frontberichten orientieren. Eine ganze Generation junger und talentierter Schriftsteller zog mit in diesen Krieg. Sie schrieben über das Grauen, das sie hautnah erlebten, und das mit dem Talent, das ihnen gegeben war. Immer wieder streut Simmons Gedichte aus und vom Krieg ein seine Novelle ein. Er lässt sie von seinem Protagonisten verfassen; in ihrer poetischen Wucht und Eindringlichkeit verdichten sie künstlerisch den Schrecken, den Simmons ansonsten betont sachlich in knapp gehaltenen Tagebucheinträgen fixiert.
„Der große Liebhaber“ lässt seine Leser freilich ratlos zurück. Was möchte uns der Autor sagen? Krieg ist die Hölle, das stellt er wortgewaltig unter Beweis. Dennoch belebt Simmons primär die Erinnerung an einen Krieg, der längst Geschichte ist. Gewisse Strukturen des Schreckens – durch die Kriegshistorie zieht sich als dicker roter Faden die Menschen verachtende Dummheit frontfern entscheidender Feldherren – sind zeitlos. Trotzdem erschreckt Simmons eher vordergründig durch drastische Splatter-Szenen als durch die Darstellung der Sinnlosigkeit des Grabenkampfes.
Aufgesetzt wirken außerdem jene Szenen, in denen der psychisch überforderte Soldat die „Lady in Weiß“ halluziniert. Sie sollen seine ungebrochene Lebenslust bzw. -sehnsucht im Angesicht der Hoffnungslosigkeit illustrieren. Der Schuss geht nach hinten los: Lange fragt man sich, ob Simmons von einer Kriegs- zu einer Geistergeschichte umschwenkt. (Das hatte er übrigens in der früheren Novelle „Iversons Gruben“ vor dem Hintergrund des Amerikanischen Bürgerkriegs von 1861-65 schon getan.) Der Tod in Frauengestalt kann mit den Schrecken des Schlachtfelds nicht mithalten. Es fehlt zudem eine Auflösung; das Kriegstagebuch bricht unvermittelt ab. Simmons selbst übernimmt es das Nachkriegsleben seiner Figur zu beschreiben.
Plötzlich entpuppt sich „Der große Liebhaber“ als Versuch eines Psychogramms. Nicht ohne Grund wird der I. Weltkrieg in Großbritannien noch heute als der „Große Krieg“ bezeichnet. Ganze Jahrgänge junger Männer fielen im Felde; ihr Fehlen führte zu enormen gesellschaftlichen Verwerfungen, deren Folgen sich erst nach dem Krieg abzeichneten. Simmons gelingt es nur bedingt diese Entwicklung am Beispiel eines individuellen Schicksals darzustellen. Letztlich beeindruckt und erschreckt „Der große Liebhaber“ als stupende handwerkliche Leistung eines bemerkenswerten Verfassers. Ihn deshalb gescheitert zu nennen wäre falsch: „Der große Liebhaber“ entwickelt auf jeden Fall einen düsteren Sog, dem sich kein Leser entziehen kann.
Unterm Strich ist dies wohl die Gemeinsamkeit, welche die „Lovedeath“-Erzählungen eint; ich empfinde das als großartige Empfehlung für ein Buch, das die Lektüre von der ersten bis zur letzten Seite lohnt. Ein – zudem flüssig übersetztes – Werk dieser inhaltlichen und formalen Qualität sollte in den von öden Endlosreihen dominierten Regalen der deutschen Buchmärkte keinesfalls untergehen.
Autor
Dan Simmons wurde 1948 in Peoria, Illinois, geboren. Er studierte Englisch und wurde 1971 Lehrer; diesen Beruf übte er 18 Jahre aus. In diesem Rahmen leitete er eine Schreibschule; noch heute ist er gern gesehener Gastdozent auf Workshops für Jugendliche und Erwachsene.
Als Schriftsteller ist Simmons seit 1982 tätig. Fünf Jahre später wurde er vom Amateur zum Profi – und zum zuverlässigen Lieferanten unterhaltsamer Pageturner. Dass er nicht längst in dieselbe Bestseller-Kategorie aufgestiegen ist wie Dan Brown oder Stephen King, liegt wohl primär daran, dass er auf zu vielen Hochzeiten tanzt: Simmons ist einfach zu vielseitig, lässt sich in keine Schublade stecken, versucht immer wieder etwas Neues. Leider liebt das träge Leservieh keine Aufregung, sondern hält sich lieber an das Bekannte, scheinbar Bewährte. Ein flinker Schriftsteller wie Simmons taucht unter zu vielen Masken auf und kann sich deshalb nicht als Markenzeichen etablieren. In Deutschland wird er daher wohl ewig im Taschenbuch-Getto gefangen bleiben, während es Fließband-Kolleginnen und -Kollegen längst zum gediegen gebundenen Festeinband gebracht haben, der allein vom Radar der ‚richtigen‘ Literaturkritik geortet wird: eine Ungerechtigkeit, die den wissenden Fan indes nicht davon abhalten wird, den Meister in seinen vielen Verkleidungen zu finden!
Über Leben und Werk von Dan Simmons informiert die schön gestaltete Website http://www.dansimmons.com.
Impressum
Originaltitel: Lovedeath. Five Tales of Love and Death (New York: Warner Books 1993)
Übersetzung: Joachim Körber
Deutsche Erstausgabe: Dezember 1999 (Blitz Verlag)
352 S.
ISBN-10: 3-93217-122-5
Diese Ausgabe: Oktober 2005 (Festa Verlag/Horror-TB Nr. 1512)
431 S.
EUR 9,90
ISBN-13: 978-3-86552-032-6
www.festa-verlag.de
Jeffrey Thomas – MonstroCity
Jeffrey Thomas ist ein impulsiver Schreiber, einer, der seine Geschichten aus der Feder fließen lässt, ohne sich mit großmächtiger Szenenarchitektur aufzuhalten; Kunst ist etwas Spontanes, sagt er, und ein Verbrechen wäre es, dem frischen Moment der Schöpfung durch Planung das Blut abzuschnüren. Dementsprechend ist die Kurzgeschichte sein Revier, inspiriert durch die Werke von Barker und Lovecraft schreibt er sich durch sein 1980 erschaffenes Universum, das mit jeder neuen Geschichte wächst: Punktown. Es ist eine Stadt auf einem fremden Planeten, sie ist keinen Regeln unterworfen, es gibt keine Karte, auf der man ihrem Verlauf folgen könnte, keine Chronologie, die ihre Geschichte nachzeichnete, in Punktown kann alles geschehen, es ist der Ort, an dem Thomas seine Ängste auslebt, sein persönliches Oz, sein morbides Wunderland, Punktown ist die amorphe Allesstadt.
Nancy Kilpatrick – Todessehnsucht

Nancy Kilpatrick – Todessehnsucht weiterlesen
Andreas Gruber – Der Judas-Schrein
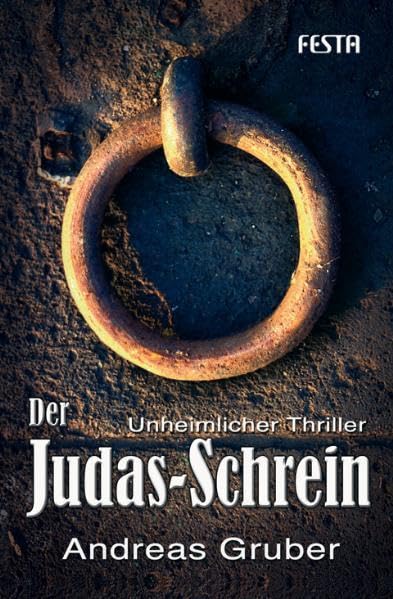
Elrod, P. N. – Blutzirkel (Vampirdetektiv Jack Fleming – Das 3. Abenteuer)
Tja, die Vergangenheit kann man eben nicht so einfach abschütteln. Gerade noch hatte Vampir Jack Fleming in „Blutjagd“ beschlossen, die Suche nach seiner alten Flamme Maureen aufzugeben, als sich ihre Schwester Gaylen meldete. Nun, mit all den neuen Informationen, die Jack gewonnen hat, beschließt er im dritten Band der Reihe um den Vampirdetektiv Jack Fleming, „Blutzirkel“, die Suche nach Maureen wieder aufzunehmen. Schließlich könnte sie in Lebensgefahr schweben; oder gar schon tot sein! So kehren er und sein Freund Escott dem Chicago der 30er Jahre den Rücken und reisen nach New York, denn dort verlor sich Maureens Spur vor fünf Jahren.
Mittlerweile hat sich Jack auch mit seinem vampirischen Dasein arrangiert. Die Blutbeschaffung bereitet ihm kein Kopfzerbrechen mehr (auch wenn sie unter Umständen sein Schuhwerk ruiniert, weil er einer Kuh hinterherjagt) und auch die hypnotische Beeinflussung von Menschen belastet sein Gewissen lange nicht mehr so stark wie noch in den Vorgängerbänden. Und sein Freund Escott scheint ohnehin keinerlei Probleme mit dem Zustand seines Freundes zu haben. Ohne zu Murren schleppt er dessen riesigen Kleiderkoffer durch die Gegend, schiebt dem untoten Jack heimlich Heimaterde unter und führt eine Art Erste-Hilfe-Kasten für Vampire mit sich (hauptsächlich bestehend aus einer Spritze, einem Schlauch und einer Anzahl Milchflaschen).
So ausgerüstet, begegeben sich die beiden nach New York, von wo aus die Spur schnell zum Anwesen der Franchers nach Long Island führt. Maureen nämlich hatte ihrer Nachbarin versichert, unter dieser Telefonnummer erreichbar zu sein. Dies verwirrt unsere beiden Detektive zunächst, können sie sich doch keinen Reim darauf machen, worin die Verbindung zwischen Maureen und der reichen und exzentrischen Emily Francher bestehen soll. Doch als sie das Anwesen erst besuchen, wird bald alles klarer. Der Sekretär der Besitzerin ist kein Geringerer als Jonathan Barrett höchstselbst, den wir schon kurz im letzten Band „Blutjagd“ kennen gelernt haben. Barrett, selbst Vampir, hatte Maureen offensichtlich Unterschlupf gewährt, jedoch nur für eine Nacht. Alles, was Jack und Escott darüberhinaus in Erfahrung bringen, will einfach keinen Sinn ergeben. Und Barrett selbst ist alles andere als hilfsbereit …
Wer Jonathan Barrett noch aus P. N. Elrods anderer Vampirserie kennt, der wird ihn hier zunächst nicht wiedererkennen. Der sensible Gutmensch, der als Erstes seine Familie in seinen Vampirismus einweiht und im Prinzip keiner Fliege etwas zuleide tun kann, ist in „Blutzirkel“ einem verschlossenen Eigenbrötler gewichen. Die beiden Vampire Fleming und Barrett umkreisen sich zunächst wie zwei hungrige Wölfe, die ihr Revier verteidigen wollen. Keiner traut dem anderen und ihr vorsichtiges Taktieren in Gegenwart des anderen ist ein reines Vergnügen für den Leser. Dass hier zwei Vampire mit- und gegeneinander agieren, ist ungemein reizvoll, durfte der geneigte Leser bisher doch „nur“ Jack als Vampir erleben.
„Blutzirkel“ ist in mancher Hinsicht anders als die beiden Vorgänger. Da wäre zunächst der Schauplatz: Vom lauten und gefährlichen Großstadtpflaster Chicagos geht es ins gemächliche, aber nicht weniger tödliche Long Island. Hier müssen sich Jack und Escott mit ganz anderen Problemen herumschlagen. Dass jeder jeden kennt und alles sofort weitergetratscht wird, wird Jack – mal wieder – fast zum Verhängnis. Zum anderen tauscht Elrod die wilden Verfolgungsjagden und Schießereien gegen bodenständige Detektion und Schnüffelarbeit.
Ein kleines Manko hat der Roman allerdings. Während die beiden Vorgänger von Heiko Langhans übersetzt wurden, übernahm diesmal Rosa Welz die Übertragung ins Deutsche. Das wirkt sich sprachlich auf den Detektivplot aus. Wo Heiko Langhans noch mit Verve heutzutage fast vollkommen verschollene Ausdrücke wie „Flüsterkneipe“ und „Rabatz“ ausgegraben hat, bietet die Übersetzung von Rosa Welz durchgehend flüssige, aber eben moderne Prosa. Der Reiz der 30er-Jahre-Gangstersprache, der im Erstling „Vampirjäger Jack Fleming“ am ausgeprägtesten war, ist mittlerweile fast gänzlich aus der Erzählung verschwunden. Schade!
Doch trotzdem bietet „Blutzirkel“ natürlich 250 Seiten Lesevergnügen. In gewohnter Manier tischt P. N. Elrod dem Leser einen packenden Plot, ein mysteriöses Geheimnis und mit Jack Fleming einen toughen, aber humorigen Helden auf. Amüsante Kurzweil und spannende Detektion gehen in „Blutzirkel“ Hand in Hand – alles gebettet auf Elrods überzeugende Charaktere. Denn wenn die amerikanische Autorin ein Talent hat, dann ist es das Erschaffen von dreidimensionalen Charakteren, die dem Leser einfach nie langweilig werden. Über Jack und Escott gibt es immer wieder Neues zu erfahren und man kann es kaum erwarten, den nächsten Band in den Händen zu halten. Gut, dass Elrod kaum Ermüdungserscheinungen zeigt und ihrer vampirischen Protagonisten noch lange nicht überdrüssig ist!
|P. N. Elrod bei Buchwurm.info:|
[„Der rote Tod“ 821
[„Der endlose Tod“ 863
[„Der maskierte Tod“ 1582
[„Vampirdetektiv Jack Fleming“ 432
[„Blutjagd“ 1928
http://www.festa-verlag.de/
Elrod, P. N. – Blutjagd. Ein Vampir-Krimi
Auf die Idee muss man erstmal kommen: Ein Vampir als Detektiv. Bereits 1990 hatte die amerikanische Autorin P. N. Elrod den Einfall für diesen genialen Kunstgriff. (Und war damit dem vampirischen Detektiv Nick Knight in der gleichnamigen Serie um zwei Jahre voraus.) Im Auftaktroman zu ihrer Serie um den „Vampirdetektiv Jack Fleming“ machte sie Jack kurzerhand zum Vampir und ließ ihn im Chicago der 30er Jahre mit Hilfe seines neu gewonnenen Freundes Escott seinen eigenen Mord aufklären. Da Jack sich in Luft auflösen und Menschen durch Hypnose beeinflussen kann und darüber hinaus ziemlich unverwüstlich ist, wäre Escott – der eigentliche Detektiv – ein Dummkopf, würde er sich nicht Jacks Hilfe bei einigen brenzligen Fällen bedienen.
Doch ein klassischer Fall präsentiert sich in der Fortsetzung „Blutjagd“ zunächst nicht. Stattdessen beobachten wir Fleming dabei, wie er es sich in seiner vampirischen Existenz gemütlich macht. Bobbi, die Barsängerin aus dem Vorgängerroman, ist nun Jacks Freundin und erfreut sich an den speziellen Zuwendungen, die man von einem untoten Bettgenossen erfährt. Jack fühlt sich so wohl in dieser neuen Beziehung, dass er die Zeit für gekommen hält, seine Suchanzeige in den großen Zeitungen des Landes zu stoppen und Maureen aufzugeben. Sie war nämlich die Vampirin, die Jack durch ihren Biss verwandelt hat. Die beiden verband eine heiße Affäre, bis Maureen sich plötzlich absetzen musste. Seit fünf Jahren nun sucht Jack per Annonce nach ihr – bisher ohne Erfolg. Nun jedoch beschließt er, diesen Abschnitt seines Lebens als erledigt zu betrachten und die wöchentlichen Anzeigen einzustellen.
Doch offensichtlich hat er nicht damit gerechnet, dass dies einigen windigen Gestalten auffallen würde. So hängen sich plötzlich zwei unfähige Vampirjäger à la „Tanz der Vampire“ an seine Fersen, fuchteln mit Holzkreuzen vor seiner Nase herum und belästigen seine Familie. Außerdem taucht ganz plötzlich Maureens Schwester auf – mittlerweile über 70 Jahre alt und ebenfalls auf der Suche nach Maureen. Wie soll Jack die Vampirjäger loswerden, ohne sie zu töten? Und sagt Maureens Schwester tatsächlich die Wahrheit? Man kann sich sicher sein, dass Elrod im Verlauf einige Kehrtwendungen für den Leser parat haben wird. Langweilig wird es also garantiert nicht!
Wer zu Beginn des Romans den echten und geradlinigen Mordfall vermisst, der wird schnell entschädigt. P. N. Elrod legt mit „Blutjagd“ zwar erst den zweiten Teil ihrer Serie um Jack Fleming vor, doch schon hier taucht sie tief in die Geschichte der Vampirliteratur ein und flicht viele mehr oder minder auffällige Anspielungen in ihre Handlung ein. So verschlägt es (einen noch menschlichen) Jack Fleming in New York in den Buchladen eines Spinners, der okkulte Bücher sammelt. Fleming ist auf der Suche nach „Varney, the Vampire“ und zwischen ihm und dem Buchhändler entspinnt sich ein unterhaltsames Gespräch über die Existenz von Vampiren, die Frage, ob es Dracula wirklich gab und diverse Klassiker der Vampirliteratur. Ein echtes Fest für Fans des Genres!
Ebenso erheiternd ist das Zusammentreffen von Jack mit den beiden Vampirjägern, die offensichtlich Ted Brownings „Dracula“ einmal zu oft gesehen haben und vor Theatralik nur so strotzen. Vermutlich können sie es Jack auch nicht verzeihen, dass er nicht ständig im Theatercape herumläuft. Die beiden heften sich wie zwei Zecken an die Fersen des Vampirs, der eher amüsiert als wirklich verängstigt ist. Die Attacken des dynamischen Duos wehrt er mit Sarkasmus und Gutmütigkeit ab, doch die selbst ernannten Retter der Menschheit geben einfach keine Ruhe und schrecken schließlich auch nicht davor zurück, Unschuldige mit in den Tod zu reißen. Elrod rechnet hier mit dem Bild des Vampirjägers nach dem Muster von van Helsing ab. Für sie ist der Vampir nur ein Mensch mit besonderen Eigenschaften. Der Jäger aber ist das eigentliche Monster – nur fähig zu zerstören, was nicht so ist wie er, anstatt das Potenzial in dieser Andersartigkeit zu erkennen, wie z. B. Jacks Freund Escott es tut.
Und schlussendlich wird der treue Elrod-Leser auch den Protagonisten ihrer anderen, ebenfalls bei |Festa| veröffentlichten, Vampirserie hier wiederfinden. Jonathan Barrett nämlich, der sensible Gentleman-Vampir aus Long Island, taucht in den Erinnerungen von Maureens Schwester auf, da er bei Maureens Vampirwerdung eine entscheidende Rolle spielte. Man darf hoffen, dass er auch in zukünftigen Romanen kleine Auftritte haben wird, trägt dies doch zu der Attraktivität beider Romanserien bei.
P. N. Elrod ist ein echtes Phänomen. Jeder ihrer Romane ist ein Treffer mitten ins Schwarze und jedes Mal denkt man aufs Neue, dass man so gut schon lange nicht mehr unterhalten worden ist. Doch mit jedem Roman übertrifft sie sich selbst. Ihre Charaktere sind farbenfroh und nicht ohne Humor, ihre Handlung flott und immer vorwärts strebend. Neben Laurell K. Hamilton ist Elrod wohl die amerikanische Autorin, die dem Vampirgenre im Moment die meisten neue Impulse gibt. Es gilt hier also nicht, eine Leseempfehlung auszusprechen. Nein, stattdessen gibt es einen Lesebefehl! Kaufen, lesen, lieben!
|P. N. Elrod bei Buchwurm.info:|
[„Der rote Tod“ 821
[„Der endlose Tod“ 863
[„Der maskierte Tod“ 1582
[„Vampirdetektiv Jack Fleming“ 432
http://www.festa-verlag.de/
Elrod, Patricia N. – Vampirdetektiv Jack Fleming
Das ist schon ein ziemlicher Schock, wenn man sich plötzlich an den Ufern des Lake Michigan wiederfindet und feststellt, dass man tot ist. Eigentlich ist es sogar ziemlich widersinnig. Nicht jedoch für Jack Fleming, dem genau das passiert: Irgendjemand im Chicago der 30er Jahre will ihm offensichtlich an die Gurgel und scheinbar ist ihm das auch gelungen. Doch Fleming steht wieder auf – dank einer Affäre und des dazugehörigen Blutaustausches mit der Vampirin Maureen. So ist er zwar dem Tod von der Schippe gesprungen, doch ist ihm dafür die Erinnerung an seine Todesnacht abhanden gekommen. Warum will das organisierte Verbrechen von Chicago ihn loswerden? Wer hat ihn umgebracht? Und was soll diese Blutliste sein, die die angeheuerten Schläger ihm abnehmen sollten?
Fleming beschließt, sich zunächst ein wenig an seinen neuen vampirischen Zustand zu gewöhnen (inklusive erster taktischer Besuche des berüchtigten Chicagoer Schlachthofs – schließlich ist er ein humanistischer Vampir) und dann seinen eigenen Mord aufzuklären. Immerhin ist er eigentlich Reporter, und verdeckte Machenschaften aufzudecken sein täglich Brot. Er erhält überraschende Hilfe von dem Privatschnüffler Escott, der allein durch penible Beobachtung auf Fleming und seinen außergewöhnlichen Zustand aufmerksam geworden ist und ihm seine Hilfe und seine Kontakte anbietet. Fleming nimmt dieses Angebot dankbar an und gemeinsam machen sich die beiden auf, das Geheimnis um den Mord an Fleming zu lösen und dessen verlorenes Gedächtnis wieder herzustellen. Und so wühlen sich Fleming und Escott durch die Unterwelt Chicagos und von einem Bandenboss zum nächsten, geraten in einige brenzlige Situationen, Verfolgungsjagden und Schießereien, logieren in illustren Kneipen und spielen – natürlich – Poker (und betrügen – das versteht sich wohl von selbst), bis sie nach kurzweiligen 250 Seiten endlich das Rätsel um die Blutliste gelöst haben. Ob sich der ganze Aufwand für zwei Blatt Papier tatsächlich gelohnt hat, bleibt abzuwarten, doch unterhaltsam war er allemal!
„Vampirdetektiv Jack Fleming“ von P. N. Elrod ist in seiner Plakativität ein ziemlich abstoßender Titel (das hat auch |Festa| schnell eingesehen und die Titel der Fortsetzungen mehr am US-Original orientiert), zeigt aber, worum es in dem Roman gehen soll. Autorin Elrod nimmt das Genre des Vampirromans und katapultiert ihren untoten Helden gnadenlos in eine hardboiled Detektivgeschichte à la Hammett und Chandler. Dabei bedient sie zunächst einmal eine ganze Reihe Klischees des Genres: Unser Held ist ein Reporter, die Story spielt im Chicago der 30er Jahre, es gibt eine schöne Frau (die unser Held, bevor der Roman zu Ende ist, natürlich mindestens einmal verführt haben muss), Männer haben dicke Kanonen und setzen sie gern ein. Es fehlt nur noch, dass die Hauptcharaktere Filzhüte tragen (immerhin sieht man einen auf dem Cover des Buches).
Doch Elrod hält die Fäden ihrer Handlung fest in der Hand und ihr Vampirkrimi droht nie wirklich, ins Klischee abzudriften. Stattdessen spielt sie mit viel Finesse mit den Eckpfeilern des Genres und streut eine ganze Reihe Anspielungen und Namen ein, die Fans der damaligen Pulp-Magazine sicher ein Begriff sein werden. Darüberhinaus präsentiert sie gerade mit den Hauptcharakteren Fleming und Escott zwei schillernde und unterhaltsame Figuren. Fleming akzeptiert seinen neuen Zustand mit trockener Ironie und findet schließlich sogar Gefallen daran, den bösen Bandenboss mit seinen vampirischen Tricks zu erschrecken (da er sich beispielsweise ganz dramatisch in Luft auflösen kann). Escott dagegen hat eine Theaterkarriere hinter sich, beweist Sinn für Theatralik und begegnet Fleming mit erfrischender Entspanntheit. Und auch wenn Elrod ziemlich unwahrscheinliche Haken schlägt, um die beiden zusammentreffen zu lassen, so verzeiht man ihr diesen Patzer recht schnell, da Fleming und Escott ein so effektives Paar abgeben.
„Vampirdetektiv Jack Fleming“ erschien in den USA bereits 1990, doch hier hat sich erst der |Festa|-Verlag der Romane von Elrod angenommen und bringt sie nach und nach als deutsche Erstausgaben auf den Markt. Mittlerweile besteht die Serie „The Vampire Files“ in den USA aus elf Titeln – Elrod ist also eine fleißige Schreiberin. Und als Bonus bleibt ihre Vampirmythologie gleich, sodass in Zukunft auch Crossover mit ihrer anderen Vampirserie um Jonathan Barrett möglich sein werden. Überhaupt, Jonathan Barrett, Elrods zweite Vampireserie. Wo Jonathan mit seinem Zustand als Vampir zunächst endlos überfordert ist und sich bei jedem neuen Einschussloch panisch fragt, ob er nun sterben muss, nimmt Fleming die ganze Sache viel entspannter. Er findet sich recht problemlos mit den neuen Gegebenheiten ab, beschafft sich einen Schrankkoffer, lässt sich per Taxi zu den berühmten Chicagoer Schlachthöfen fahren und setzt die Vorteile seines Zustandes gnadenlos ein, ohne dessen Nachteile zu beweinen. In dem Sinne thematisiert und problematisiert „Vampirdetektiv Jack Fleming“ den Vampirismus an sich viel weniger, als es in den Jonathan Barrett-Büchern der Fall ist. Was durchaus vorteilhaft sein kann, wirkt Fleming doch damit viel weniger weinerlich als Barrett. Seine schroffe und doch liebenswerte Art wird ihm schnell viele Leserherzen bescheren.
„Vampirdetektiv Jack Fleming“ ist eher ein Krimi mit Vampir-Held als ein Vampirroman mit Krimielementen. Gruslig wird es also nie wirklich. Dafür spart Elrod nicht mit Motiven des Detektivromans und der entsprechenden Brutalität. Da gibt es Folterszenen und genüsslich beschriebene Schlägereien. Wem das zu blutig anmutet, der sollte sich lieber an Elrods gemächlichere Jonathan-Barrett-Serie halten. Alle anderen werden am finsteren und gewalttätigen Chicago sicher ihre Freude haben!
John Barnes – Der Himmel, so weit und schwarz

Es startet gemächlich: Ein altgedienter Alkoholiker-Cop und Psycho-Doctor setzt sich vor die imaginäre Kamera, schnappt sich einen Becher Whiskey und starrt auf seinen Bildschirm. Er erwartet eine Nachricht von einem seiner „Fälle“, von Terpsichore Melpomene Murray, die sich aus unerfindlichen Gründen nicht mehr melden mag.
Weil diese erhoffte Meldung ausbleibt, beginnt er dem Leser das Universum zu vermitteln, in dem dieser Roman spielt. Der Leser erfährt, dass eine künstliche Intelligenz jeden Menschen auf der Erde kontrolliert, dass deswegen ganze Generationen flüchten, um ein karges Leben auf dem Mars zu beginnen. Aber auch die Mars-Bewohner sind vor einer Übernahme nicht sicher: Die Künstliche Intelligenz entwickelt sich. |OneTrue| versucht, den Mars mit dem „Resuna-Mem“ zu infizieren, einem Gedankenvirus, der über eine codierte Kommunikationssequenz in die Hirne seiner Wirte gelangt, um sie unter die Kontrolle der KI zu stellen. Jegliche Information, die von der Erde auf den Mars gelangt, könnte ein Resuna-Träger sein.
Lin Carter – Die Xothic-Legenden
Seit Jahrmillionen tobt in Zeit und Raum ein unerbittlicher Kampf zwischen diversen ‚Gottheiten‘. Ein Schauplatz dieses Krieges ist die Erde, auf der die „Götter“ noch immer ihr boshaftes Spiel treiben. Wer ihnen auf die Spur kommt, ist verloren:
Robert M. Price: Vorwort, S. 7-22
– Die rote Opfergabe (The Red Offering), S. 23-30: Im vorzeitlichen Reich von Mu sichert sich der ehrgeizige Jungmagier Zanthu zaubermächtige Beschwörungstafeln aus dem Grab eines Vorgängers, der indes weder tot ist noch auf seine Beigaben zu verzichten gedenkt.
– Der Bewohner der Gruft (The Dweller in the Tomb), S. 31-46: Viele Jahrzehntausende später – im Jahre 1913 – steht ein wagemutiger Forscher in der Gruft des besagten Zanthu und stiehlt seinerseits die uralten Tafeln, was neuerliches Grauen zur Folge hat.
– Das Ding in der Tiefe (The Thing in the Pit), S. 47-62: Zanthu plant seinen Herrn Ythogtha aus dessen Knechtschaft zu befreien, doch Götter kennen keine Dankbarkeit, was dem Kontinent Mu ein atlantisähnliches Schicksal beschert.
– Aus der Tiefe der Zeit (Out of the Ages), S. 63-96: Der Kontakt mit einer rätselhaften Götzenstatue verschafft einem Historiker 1928 nicht nur üble Träume, sondern schließlich sogar eine persönliche Begegnung mit lauernden Urzeit-Übeln.
– Der Schrecken in der Galerie (The Horror in the Gallery), S. 97-156: 1929 setzt ein weiterer Pechvogel die Untersuchung der seltsamen Statue fort und gerät ebenfalls in ihren verderblichen Bann.
– Der Winfield-Nachlass (The Winfield Heritance), S. 157-188: Sieben Jahre später wird ein etwas weltfremder Jüngling vom verschrobenen Erbonkel mit diversen wertvollen Zauberbüchern bedacht – und mit jenen Kreaturen, die er zu Lebzeiten damit heraufbeschworen hat.
– Vielleicht ein Traum (Perchance to Dream), S. 189-204: Mit Anton Zarvak wird ein ‚guter‘ Magier in das „Xothic“-Geschehen verwickelt, der sich seiner Haut nachdrücklich zu wehren weiß.
– Das seltsame Manuskript aus den Wäldern von Vermont (Strange Manuscript Found in the Vermont Woods), S. 205-230: Eine gemütliche Waldhütte verliert ihre Anziehungskraft, weil sie in der Nachbarschaft einer vorzeitlichen, immer noch rege besuchten Kultstätte errichtet wurde.
– Etwas im Mondlicht (Something in the Moonlight), S. 231-250: Nicht jeder Irrenhäusler ist tatsächlich geisteskrank, weil er sich vor mörderischen Echsen vom Mond fürchtet.
– Die Fischer von draußen (The Fishers from Outside), S. 251-272: Noch ein allzu tief schürfender Forscher kommt im tiefen Afrika einem Hilfsvolk der Alten auf die Schliche, das daraufhin die üblichen Maßnahmen zur Wahrung ihrer Anonymität trifft.
– Hinter der Maske (Behind the Mask), S. 273-294: Ein unbedarfter Nachwuchs-Wissenschaftler liest einige Bücher, die er hätte meiden sollen, da sie ihm Träume bescheren, die ganz & gar keine Schäume bleiben wollen.
– Die Glocke im Turm (The Bell in the Tower), S. 295-317: Ein englischer Lord entdeckt die Möglichkeit, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, die sich indes als Zweibahnstraße erweist.
(In der deutschen Ausgabe fehlen der Sonnett-Zyklus „Dreams from R’lyeh“ sowie die Storys „The Strange Doom of Enos Harker“ – begonnen von Lin Carter, vollendet von Robert M. Price – und „The Soul of the Devil-Bought“, eine Art Carter/Xothic-Parodie von Price. „The Bell in the Tower“ ist Carters postume ‚Zusammenarbeit‘ mit H. P. Lovecraft, der eine Reihe unvollendeter Storys und Entwürfe hinterließ.).
Bruchstücke einer schrecklichen Vergangenheit
Lin Carters „Xothic-Legenden“ bilden eine eigenartige Lektüre – ein Buch ohne eigentliche Handlung, sondern eine Lose-Blatt-Sammlung (fiktiver) Protokolle, historischer Bücher, bruchstückhafter Artefakt-Beschriftungen, Berichte, Tagebücher, Notizen usw., die für sich selbst stehend nur Mosaiksteinchen darstellen. Erst in der zeitlichen Ordnung und vor allem im Zusammenhang enthüllt sich das Geschehen: Die Geschichte der Welt ist so, wie wir ‚zivilisierten‘ Menschen sie ‚wissenschaftliche‘ rekonstruiert haben, falsch bzw. unvollständig. Wir sind längst nicht die Herren unseres Planeten, der seinerseits nur Spielball kosmischer Entitäten ist, deren Motive nur ansatzweise erfassbar sind.
Die ‚Fragmentarisierung‘ des „Cthulhu“-Mythos‘ geht auf seinen Schöpfer zurück. H. P. Lovecraft (1890-1937) kannte die Regeln für literarischen Horror sehr gut. Er erfand eine alternative Weltgeschichte, die sich dem erschrockenen Betrachter immer nur zufällig und in Bruchstücken enthüllt. Dem Leser ergeht es nur marginal besser, denn auch die Kenntnis aller Cthulhu-Storys ergibt kein Gesamtbild. Ob dies so geblieben wäre, hätte Lovecraft nicht ein frühes Ende ereilt, muss Spekulation bleiben. Auf jeden Fall fand der Mythos seine Anhänger, von denen nicht wenige ihm selbst Kapitel ein- und anfügten.
Hierbei stellt Robert M. Price, Lin-Carter-Biograf und Kenner des Horrors à la Lovecraft, mehrere Varianten fest. Da gibt es den „Kopisten“, der möglichst eng am Original bleibt, den „Erklärer“, der die Lücken tilgt, die der Mythos aufweist, sowie den „Neuerer“, der mit ihm ‚spielt‘, ihn sich zu eigen macht und entwickelt, ohne ihn zu entzaubern.
Lin Carter gehört zweifellos zu den „Erklärern“. Er steht ganz in der Tradition von August Derleth (1909-1971), der Lovecraft noch persönlich kannte und nach dessen Tod nicht nur sein Werk bewahrte, sondern es vermehrte. Anders als sein ‚Meister‘ wollte oder konnte Derleth das Prinzip eines rudimentären „Cthulhu“-Mythos’ nicht begreifen. Er war es, der systematisch damit begann, Lovecrafts (nicht grundlos) schemenhaft bleibenden Hintergrundinformationen zu sammeln, zu katalogisieren und in eine chronologische Reihenfolge zu bringen. In einem zweiten Schritt füllte Derleth die Leerstellen, die er bei dieser Arbeit festgestellt hatte. Er schuf einen Stammbaum der ‚Götter‘ aus dem All und ihrer Helfershelfer. Darüber hinaus erfand er neue Kreaturen, neue Orte des Grauens, neue Bücher verbotenen Wissens.
Enthüllungen im Salventakt
Lin Carter geht mit seinen „Xothic-Legenden“ noch einen großen Schritt weiter. Er greift nicht nur auf Lovecraft- und Derleth-Werke zurück, sondern berücksichtigt auch die Beiträge von Schriftsteller-Kollegen und -Epigonen wie Clark Ashton Smith, Frank Belknap Long, Seabury Quinn, Basil Copper oder Brian Lumley, die sich an Cthulhu versuchten (bzw. vergingen). Vor allem Derleths Bemühen um Ordnung im Dämonenhimmel verblasst vor Carters geradezu enzyklopädischem Wissen um den Mythos, der unter seiner Schreibhand endgültig zur ‚Tatsache‘ gerinnt.
Carters Enthusiasmus ist Segen und Fluch zugleich. Zu bewundern ist die Meisterschaft, mit welcher der Autor ‚Fakten‘ und selbst Erdachtes zu einer ‚neuen‘ Weltgeschichte fügt. Andererseits ordnet Carter diesem Ziel die Unterhaltung, die doch eigentlicher Zweck einer Geschichte sein sollte, konsequent unter. Im Vordergrund steht immer der Mythos. Die Enthüllung läuft allzu schematisch ab: Der Entdeckung rätselhafter Artefakte oder Bücher folgt die allmähliche Enträtselung, was allerlei Monster auf den Plan ruft, die für ein grausames Finale sorgen, das neue Fragen aufwirft. Deshalb ist es primär der Hardcore-Cthulhuist mit einem Faible für Mystery-Puzzles, der mit Carter auf seine Kosten kommt. Am Stück sollte man dieses Buch jedenfalls nicht lesen, da das wenig innovative Strickmuster nicht einmal vom Herausgeber bestritten wird.
Viele interessante Hintergrundinfos zum Mythos und zur Entstehung der „Xothic-Legenden“ liefert Robert M. Price, im Hauptberuf Professor für Theologie und Bibelwissenschaft, ohne den es diese Sammlung wohl nicht gäbe. Lin Carter selbst hat mit ihrer Entstehung nichts mehr zu tun; sie wurde fast ein Jahrzehnt nach seinem Tod zusammengestellt. Zwar plante Carter einen Episodenroman zum Thema, der aber längst nicht alle Storys umfassen sollte, die Price hier vorstellt. Dies spricht für Carter, der offenbar selbst erkannt hat, dass die Qualität seiner „Xothic“-Erzählungen arg schwankt.
So ist es eigentlich Price, der die „Xothic-Legenden“ schuf. Seine Chronologie, seine Bearbeitungen, seine verbindenden Texte formen aus ihnen ein Gesamtwerk, das einen gewissen roten Faden aufweist. Prices Gesamteinleitung sowie die einleitenden Texte zu den einzelnen Storys legen außerordentlich penibel deren Entstehungsgeschichten, Intentionen und ihre Stellung im Mythos dar. Gern holt Price weit aus und versucht sich an literaturkritischen, -historischen und -psychologischen Deutungen der Carter-Erzählungen. Dabei fördert er oft Unerwartetes und Interessantes zutage, übertreibt es jedoch einige Male gewaltig. Als Verfasser der Carter-Biografie („Lin Carter: A Look Behind His Imaginary Worlds“, 1992) und Lovecraft- bzw. Cthulhu-Experte verfügt Price über ein profundes Wissen, das er gern & reichlich mit seinen nicht immer begeisterten und überzeugten Lesern teilt.
Die Nase zu tief hineingesteckt
Es sind (bis auf eine Ausnahme) keine Helden, die wir in den „Xothic“-Geschichten mit den außerirdischen Unholden ringen sehen. Vergeistigte Hohepriester, Bücherwürmer und elfenbeinturmhoch entrückte Forscher entdecken Spuren einer gänzlich unerwarteten Frühgeschichte. Sie ahnen, was sie da entdeckt haben, begreifen aber stets zu spät, dass dieses Wissen handfeste Konsequenzen nach sich ziehen wird. Treten dann mordlustige Riesenschnecken, Froschmenschen oder berggroße Schleimgötzen auf den Plan, ist der Reue groß aber vergeblich; die unmittelbare Konfrontation mit Kreaturen, die es nicht geben dürfte, zieht den grausamen Tod oder zumindest den Wahnsinn nach sich.
Dabei sind diese (Un-) Wesen prinzipiell nicht ‚böse‘ in dem uns bekannten Sinn, sondern unendlich fremd. Deshalb ist es ratsam, sich ihnen fernzuhalten. Unterwerfung stimmt sie nicht gnädig, Unbotmäßigkeit strafen sie ebenso hart wie Versagen, Gehorsam belohnen sie nicht. Sie locken mit Versprechungen von Wissen, Macht und Geld, die sie nie halten oder auf eine Weise erfüllen, die den Fordernden nicht mit Freude erfüllt. Überhaupt benehmen sie sich wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen – über die Statur verfügen sie -, wenn sie sich bemerkbar machen. Nach Lin Carter sind es ihrer zudem so viele, dass man sich wundert, wieso es ihnen immer wieder gelingt, ihre Spuren zu verwischen; schließlich hausen sie nicht alle in Tiefseeschluchten, Urwäldern oder auf hohen Bergen, sondern schleimen & morden durchaus in den zivilisierten Regionen dieser Erde umher.
Ja, es fällt manchmal schwer, am Ball (oder ernst) zu bleiben, wenn Carter uns, seine Leser, mit zungenbrecherisch benamten alten, hohen & minderen Göttern konfrontiert oder bombardiert. Allein Cthulhu kann plötzlich auf eine Gattin und drei Söhne – natürlich ebenso missraten wie der Vater – verweisen. Leicht verliert man da die Übersicht, sodass es hilfreich ist, dass Carter und Price die verwandtschaftlichen Konstellationen und Konfrontationen vielfach wiederholen.
Denn die xothischen Götter sind notorische Streithähne, die ihren äonenlangen Krieg bis in die Gegenwart fortsetzen. Sie alle haben ihre ‚Reviere‘, speziellen Fähigkeiten und Motive. Carter setzt sie und uns ins Licht und ignoriert dabei, dass dies eine Entzauberung darstellt: Der sterbliche Leser ‚begreift‘ die Götter schließlich doch. Lovecraft hätte das nicht gefallen.
Autor
Linwood Vrooman Carter wurde am 9. Juni 1930 in St. Petersburg, gelegen im US-Staat Florida, geboren. Er wuchs hier auf, ging hier zur Schule und kehrte kurz hierher zurück, nachdem er in den Koreakrieg gezogen, verwundet und mit einem „Purple Heart“ ausgezeichnet worden war. 1953 ging Carter nach New York und studierte zwei Jahre an der Columbia University. Anschließend arbeitete er anderthalb Jahrzehnte für diverse Agenturen und Verlage, bis er, der 1965 mit „The Wizard of Lemuria“ sein Romandebüt im Phantastik-Genre gegeben hatte, ab 1969 Vollzeit-Schriftsteller wurde – ein überaus fleißiger, der mehrere Romane pro Jahr sowie diverse Kurzgeschichten veröffentlichte und sich als Herausgeber von Fantasy-Kollektionen einen Namen machte.
Der Fantasy und hier der Sparte „Sword & Sorcery”, die Muskel bepackte Barbarenkrieger gegen Monster, Mumien & finstere Zauberer antreten ließ, galt Carters ganze Liebe. Schon als Schüler verfasste er Storys im Stil von L. Frank Baum („Der Zauberer von Oz“), Edgar Rice Burroughs („Tarzan“, „John Carter vom Mars“) oder Robert E. Howard („Conan“, „Red Sonya“). Letzterem verhalf er zur literarischen Auferstehung, indem er mit Lyon Sprague de Camp und Björn Nyberg die ‚alten‘ Conan-Storys sammelte, ordnete und Lücken mit eigenen Geschichten und Romanen füllte.
Der private Lin Carter war ein unsteter, getriebener Mensch, der sich durch unmäßiges Rauchen und Alkohol gesundheitlich ruinierte. Mitte der 1980er Jahre erforderte ein zu lange unbeachteter Lippenkrebs eine radikale Operation, die Carters Gesicht entstellte und ihn erst recht isolierte. Immer öfter unterbrochen von Krankenhausaufenthalten setzte der unterdessen auch an einem Lungenemphysem erkrankte Schriftsteller seine selbstzerstörerischen Sauftouren fort. Am 7. Februar 1988 starb er, gerade 57-jährig, in einem Veteranen-Hospital.
Website „In Memoriam Lin Carter“
Website von Robert M. Price
Gebunden: 317 Seiten
Originaltitel: The Xothic Legend Cycle: The Complete Mythos Fiction of Lin Carter (Oakland, CA : Chaosium 1997)
Übersetzung: Andreas Diesel, Hans Gerwin, Ralph Sander, Malte S. Sembten
http://www.festa-verlag.de
Der Autor vergibt: