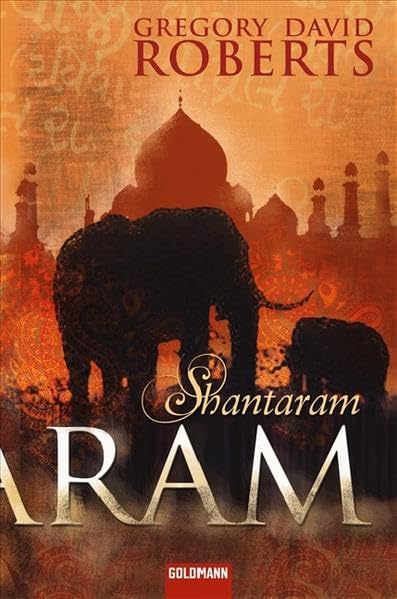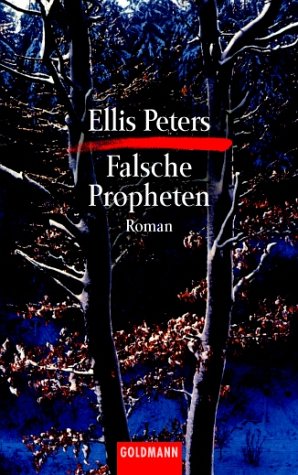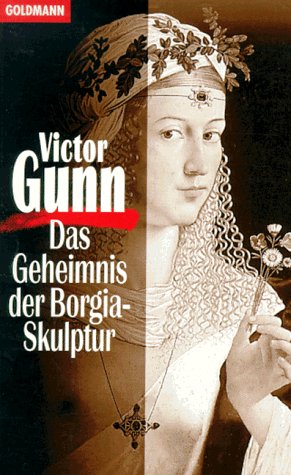
Victor Gunn – Das Geheimnis der Borgia-Skulptur weiterlesen
Schlagwort-Archiv: Goldmann
John Cassells – Die Schwarzen Tränen

John Cassells – Die Schwarzen Tränen weiterlesen
Clifton Adams – Tanz im Hexenkessel
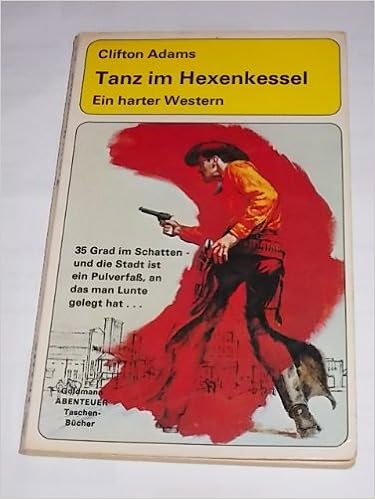
Victor Gunn – Auf eigene Faust

Victor Gunn – Auf eigene Faust weiterlesen
Mo Hayder – Ritualmord [Jack Caffery 3]

Mo Hayder – Ritualmord [Jack Caffery 3] weiterlesen
Goddard, Robert – Schatten von Aberdeen, Die
_Das geschieht:_
Nach vielen Jahren kehrt der in Kanada lebende Harry Barnett in seine englische Heimat zurück, um den Nachlass seiner verstorbenen Mutter zu ordnen. Die Einladung zu einem Treffen ehemaliger RAF-Kameraden ist ihm eine willkommene Ablenkung. Vor fünfzig Jahren hatte Harry als Soldat an einem obskuren militärischen Projekt teilgenommen: Junge Soldaten wurden in Kilveen Castle, einem unweit der schottischen Stadt Aberdeen gelegenen Außenposten der Royal Air Force, auf ihre Lernfähigkeit überprüft. Mit 14 Kameraden hatte Harry 1955 drei angenehme, weil drillfreie Monate in der alten Burg verbracht. Dorthin lädt Johnny Dangerfield, der im Ölgeschäft reich geworden ist, nun ein. Kilveen Castle wurde inzwischen zum Luxushotel umgebaut, sodass sich die im Rentenalter befindlichen Kameraden nicht lange bitten lassen.
Auch Harry fährt, obwohl er weiß, dass sein ehemaliger Freund und Geschäftspartner Barry Chipchase ebenfalls kommen wird. Nach der Pleite einer gemeinsam betriebenen Werkstatt geht man sich tunlichst aus dem Weg. Auch andere alte Kameraden hat Chipchase inzwischen um Geld geprellt, sodass Harry sich nicht wundert, dass Barry Kilveen Castle letztlich meidet.
Ohnehin ist das Treffen kein Erfolg. Schon während der Anreise verschwindet einer der alten Soldaten; seine Leiche wird später gefunden. Mord ist möglich, und als in kurzem Abstand zwei weitere Teilnehmer des Treffens sterben, wird die Polizei unangenehm. Ausgerechnet der biedere Harry wird zum Hauptverdächtigen. Zu ihm gesellt sich der aus der Versenkung aufgetauchte Chipchase. In ihrer Not tun die beiden Männer sich zusammen und stellen eigene Nachforschungen an. Sie führen in die eigene Vergangenheit zurück, die sie zu unfreiwilligen Opfer eines obskuren Experiments machte. In der Gegenwart sind die Polizei, der Geheimdienst und diverse Killer dem Duo auf den Fersen …
_Ein Buch als nicht ganz einfach zu hebender Schatz_
Die Konstruktion eines Rätsels, das auch den lese- und filmerfahrenen Zeitgenossen fesseln kann, ist im 21. Jahrhundert wahrlich kein einfaches Unterfangen. Uns wurden alle möglichen (und unmöglichen) Intrigen in unzähligen Varianten bereits präsentiert, sodass wir in der Regel wissen, wohin der Hase läuft.
Deshalb ist durchaus eine besondere Erwähnung angebracht, wenn es einem Autoren doch gelingt zu überraschen – einem Autoren zudem, der einem als Kandidat nicht unbedingt einfallen würde. Robert Goddard hat sich mit mysteriösen Ereignissen der (jüngeren) Vergangenheit, die sich in der Gegenwart meist gewalttätig zu neuem Leben melden, zwar einen Namen gemacht, der indes durch ein Zuviel an unterhaltsamen, aber zunehmend schematisch gestrickten Geschichten an Glanz verloren hat. Zumindest der Rezensent hätte Goddard ein Kabinettstück wie „Die Schatten von Aberdeen“ nicht (mehr) zugetraut!
Es zu finden, ist nicht ganz einfach, denn obwohl Goddard zu den Stammautoren des |Goldmann|-Verlags gehört, werden seine Werke optisch völlig lieblos und mit auswechselbaren Stock-Covern quasi gut getarnt in die deutschen Buchladen-Ketten gepresst.
_Menschen altern, Geheimnisse reifen_
Sehr schade ist das, denn die Geschichte vom alten Soldaten, der in eine monströse Verschwörung gerät, ist ungemein unterhaltsam. Zwar ist das dem Komplott zugrunde liegende Rätsel nachträglich betrachtet nicht gerade originell. So denkt der Leser freilich in 99 von 100 entsprechenden Fällen. Der Weg ist der Ziel, und der ist reich an scharfen Kurven und unerwarteten Hindernissen, während die Geschichte gemächlich beginnt, aber bald gefährlich an Fahrt aufnimmt. Dabei muss man mehr als einmal an Alfred Hitchcock selig und hier explizit an sein frühes Meisterwerk „The 39 Steps“ (1935; dt. „Die 39 Stufen“) denken, das ebenfalls eine wilde Flucht vor unsichtbaren, aber mörderischen Verfolgern durch schottische Moor- und Heidelandschaften und ein vertracktes Rätsel thematisiert, von dessen eigentlich unmöglicher Auflösung das Leben der ratlosen Hauptfiguren abhängt.
Auch Harry Barnett ist eine Figur, die Hitchcock gefallen hätte – ein Jedermann, der in seinem ruhigen Leben keine Turbulenzen erfahren und überstanden hat, die ihn auf das vorbereiten könnten, was ihn im Land seiner Väter erwartet. Folgerichtig ist Harry alles andere als ein Held und – obwohl schon zweimal in kriminelles Treiben verwickelt – in echten Krisensituationen überfordert. Schon sein Alter verbietet ihm Action-Einlagen, und für sein Naturell ist es charakteristisch, dass ihn bereits die Handhabung eines Handys überfordert; keine Idealvoraussetzungen für eine Flucht, die kreuz und quer durch Schottland und England führt und in der nördlichen Ödnis der Neuen Hebriden ihren Höhepunkt findet.
_Nimm’s mit Humor, auch wenn die Kugeln fliegen_
Hitchcock zum Dritten: Obwohl Mord und Totschlag mehr als eine Szene von Harrys Odyssee prägen, schlägt Autor Goddard einen sehr leichten Ton an. „Die Schatten von Aberdeen“ besticht durch einen stets präsenten, nie albernen oder aufdringlichen, sondern britisch trockenen Humor, der die Übersetzung erfreulich gut überstanden hat. Für einen politisch unkorrekten Oneliner sorgt auch in kritischen Situationen zuverlässig Luftikus Barry Chipchase, den Goddard wohlweislich dem blassen Harry an die Seite stellt.
Barry ist ein Betrüger, dem kein Coup jemals wirklich gelang. Wieso das so ist, erfahren wir schnell, denn für eine Hetzjagd auf Leben und Tod ist er eigentlich nicht der richtige Partner. In der Tat ist es die blanke Not, die unsere ungleichen ‚Helden‘ zusammenschweißt: ein Klischee, das Goddard wundersam mit neuem Leben erfüllt.
Natürlich hat Barry das Herz auf dem rechten Fleck. Wenn man weiß, welche Knöpfe man bei ihm zu drücken hat, schwingt er sich zu ungeahnten Höhenflügen auf. Harry ist hartnäckig, aber zurückhaltend, Barry unkonventionell. Gemeinsam sind sie nicht unbedingt unschlagbar, aber sie entwickeln eine Gegenwehr, die nicht aus bisher verborgenen Superkräften, sondern logisch aus der Handlung erwächst. Das zu verfolgen, macht einfach Spaß, zumal Goddard mit Überraschungen nie geizt. Selbst das etwas zu happy geratene Ende passt zu dieser Geschichte, die Routine mit Raffinesse mischt – in welchem Verhältnis dies geschieht, mag der Leser/der Kritiker selbst entscheiden.
_Der Autor_
Robert Goddard wurde 1954 in Fareham, Hampshire, geboren. Als Student der Universität zu Cambridge erwarb er einen akademischen Grad als Historiker: eine Ausbildung, die ihm später nützlich war, obwohl er sich zunächst mit den in diesem Metier üblichen Beschäftigungsproblemen konfrontiert sah. Ein Versuch, als Journalist Fuß zu fassen, scheiterte recht bald, und auch als Lehrer konnte Goddard nicht glänzen. So wählte er den letzten Ausweg und ging in die Verwaltung.
Während er für das „Education Department“ des Devon County Councils tätig war, schrieb er in seiner Freizeit einen ersten Roman. „Past Caring“ (dt. „Dein Schatten, dem ich folgte“) erschien 1986 und entwickelte sich sogleich zu einem großen Erfolg. Der gleichzeitig vertrackte und spannend entwickelte, dabei aber den Regeln des Genres stets verpflichtete und massenlesertaugliche Thriller um diverse Schatten aus ferner Vergangenheit, die in der Gegenwart zu neuem, unheilvollen Leben erwachen, wurde zur Blaupause der meisten Romane, die seither in zügigem Tempo und regelmäßig folgten. Die Leser scheint es nicht zu stören, jedes Goddard-Werk entert die Bestsellerlisten; nicht bis zur Spitze, aber – auch in Deutschland – hoch genug, um dem mit seiner Gattin heute in Truro, Cornwall, lebenden Schriftsteller ein behagliches Auskommen zu garantieren.
Die Harry-Barnett-Serie erschien zuletzt im |Wilhelm Goldmann Verlag|:
(1990) Into the Blue („Mitten im Blau”) – TB 41310
(1996) Out of the Sun („Die Zauberlehrlinge”) – TB 44273
(2006) Never Go Back („Die Schatten von Aberdeen“) – TB 46400
_Impressum_
Originaltitel: Never Go Back (London : Bantam Press 2006/New York : Delta Trade Paperbacks 2007)
Übersetzung: Peter Pfaffinger
Deutsche Erstausgabe: Juni 2007 (Wilhelm Goldmann Verlag/TB Nr. 46400)
411 Seiten
EUR 8,95
ISBN-13: 978-3-442-46400-5
http://www.goldmann-verlag.de
_Außerdem von Robert Goddard auf |Buchwurm.info| zu finden:_
[„Bedenke, dass wir sterben müssen“ 1605
Roberts, Gregory David – Shantaram
Bombay – wie die indische Metropole noch bis 1996 hieß, die anschließend offiziell in Mumbai umbenannt wurde, was dort allerdings selbst von einigen Behörden noch nicht durchgehend umgesetzt wird – ist eine multiethnische und multikulturelle Stadt und zudem eine der größten und sicherlich auch faszinierendsten der Welt. Unzählige einheimische Volksgruppen sowie Menschen aus vielen anderen Nationen der Welt haben ihre Spuren hinterlassen, prägen und entwickeln diese Metastadt laufend weiter.
Mit ihrem Hafen ist Bombay der wichtigste wirtschaftliche Dreh- und Angelpunkt des Subkontinents für Im- und Export und deswegen zur Hauptstadt des Handels geworden. Als eine der größten Städte der Welt produziert Bombay natürlich auch die größten Probleme; inmitten der Stadtteile reihen sich wohlhabende Siedlungen direkt an die zahlreichen Slums an, die mal größer und mal kleiner werden, sofern sie zumindest von den Stadtoberen akzeptiert werden.
Zugleich mit der Wirtschaft floriert auch die kriminelle Organisation der Stadt. Ebenso wie den offensichtlichen Reichtum, der gerne auch zur Schau gestellt wird, gibt es hier Armuts- und Elendsviertel, die von kriminellen Bossen beherrscht werden. Indien ist so weit entfernt von den westlichen Wirtschaftsräumen, dass es für flüchtige Verbrecher wie ein Paradies wirkt. Der Einfluss nationaler und internationaler Gerichtsbarkeit sowie die Verfolgung durch Staatsanwalt und Polizei sind gering bis gar nicht vorhanden.
An humanitärer Hilfe in den Slums mangelt es an jeder Ecke; Drogen beherrschen hier stattdessen den Handel und das (Über-)Leben in der Unterwelt. Medikamentöse und ärztliche Versorgung bleibt der privilegierten Gesellschaft vorbehalten, so dass es hier ganze Viertel gibt, in denen durch Krankheit die regelrecht zum Tode Verurteilten ein jämmerliches Dasein fristen.
Indien ver- und bezaubert durchaus; die märchenhafte Aura des Landes begegnet dem Besucher an vielen Orte. Das Leben, Denken und Handeln der Inder ist so ganz verschieden von unserem. Nüchtern betrachtet allerdings verflüchtigt sich hierbei schnell jedes romantisierte Weltbild. Für zahllose Einwohner des Landes ist das dortige Leben mit all seinen Entbehrungen und Gefahren ein schmerzvoller Überlebenskampf.
Gregory David Roberts hat in seinem Roman „Shantaram“ ein raues, aber zugleich umfassendes und faszinierendes Bild der Metropole Bombay entworfen und damit einen leidenschaftlichen Roman verfasst.
_Inhalt_
Lindsay, ein junger Australier, hat zwei Jahre seiner langjährigen Haftstrafe in einem Hochsicherheitsgefängnis verbracht, als ihm seine spektakuläre Flucht gelingt. Lindsay hat alles verloren, Frau und Kind, seinen Job. Diese Schicksalsschläge haben ihn mit Drogen und Verbrechen konfrontiert, eine Spirale, die im Gefängnis endete.
Um internationalen Fahndern zu entkommen, flüchtet Lindsay mit falschen Papieren ausgestattet nach Bombay. Die indische Kulturhauptstadt wirkt verstörend und anfangs fremd auf ihn. Durch Zufall lernt er den jungen Inder Prabaker kennen, der Lindsay zunächst als Fremdenführer die schillernde und übergroße Stadt zeigt und erklärt.
Als Gestrandeter lernt er andere Menschen kennen, die in Bombay ähnlich wie er selbst einen Neuanfang suchen. Lindsay wird durch Prabaker, der inzwischen sein Freund geworden ist, in die ungeschriebenen Gesetze der Stadt und deren Unterwelt eingeführt. Er lernt einflussreiche Menschen aus dem Drogenmilieu kennen, die die Stadt mit beherrschen und regieren. Alles scheint miteinander verwoben zu sein, jeder macht in seiner Welt Geschäfte und ist abhängig von anderen – dies zu durchschauen, wäre ohne die Hilfe des jungen Inders unmöglich.
Lindsay baut sich eine Art von Familie auf, die viele unterschiedliche Persönlichkeiten umfasst, die bald alles für ihn bedeuten. Da ist Karla, eine bildhübsche, aber kühle Frau mit schweizer Wurzeln, in die er sich verliebt. Auch einflussreiche Männer aus Bombays Unterwelt begleiten den jungen Mann, und er entwickelt zu diesen kriminellen Männern ein tiefsinniges, fast schon väterliches Verhältnis.
Prabaker der spürt, dass Lindsay auf seine Art verloren ist, und führt ihn in seine Familie ein, in der dieser wie ein Sohn aufgenommen und akzeptiert wird. Diese Zeit prägt den jungen Mann und lässt ihn über seine Vergangenheit und seine vielen Möglichkeiten der Zukunft nachdanken.
Prabaker ist es auch, der Linbaba, wie Lindsay jetzt genannt wird, sein eigenes Haus vermittelt. Inmitten der Slums lernt Lin Menschen kennen, die ungeachtet ihrer Nöte und Sorgen füreinander einstehen und Verantwortung übernehmen. Diese exotische Welt birgt viel Gnadenlosigkeit, aber auch viel Hoffnung für die dort lebenden Menschen, die in Baracken hausen, die notdürftig aus Blech, Plastik und Holz eher schlecht als recht zusammengezimmert wurden.
Lindsays neue Heimat wird wenig später zum Teil durch ein Feuer vernichtet, viele Menschen werden durch Flammen und Rauch verletzt, und durch seine rudimentären Medizin- und Erste-Hilfe-Kenntnisse wird Lin schnell zum Arzt in diesem Slum. Doch auch hier ist er abhängig von der Unterwelt und den Bossen, die die Slums regieren und mit Nahrungsmitteln und Medikamenten versorgen. Obwohl Lin keine medizinischer Ausbildung genossen hat, wird er von den Menschen schnell als Slumarzt akzeptiert.
Seine Praxis ist Anlaufstelle für die vielen Verletzten und Kranken, die ihn in immer größerer Anzahl aufsuchen, ebenso wie die vielen Leprakranken, die in eigenen Slums etwas abgegrenzt wohnen. Lin wird zu „Shantaram“, wie ihn Prabaker tauft – ein Mann des Friedens. Durch seine Naivität und nicht zuletzt durch seine ominösen Verbindungen zur Unterwelt wird Lin verraten und in Bombays gefürchtetes Arthur-Road-Gefängnis gesteckt. Dort wird er brutal gefoltert und fast zerbrochen …
Als Lin durch einen einflussreichen Unterwelt-Boss aus dem Gefängnis herausgeholt wird, verfolgt er das alleinige Ziel, sich an demjenigen zu rächen, der für seinen Gefängnisaufenthalt verantwortlich ist …
_Kritik_
Selten hat ein Autor Bombay ein so intensives Gesicht verliehen, wie es Gregory David Roberts gelungen ist. Roberts weiß auch, wovon er schreibt, denn die Person „Shantaram“ oder Lindsay ist er selbst. „Shantaram“ ist seine Biografie, und seine abenteuerlich anmutenden Erlebnisse hat er in diesem Roman verarbeitet.
Der Leser erlebt den Alltag Bombays an der Seite des Autors. Die exotische Stadt besitzt viele Facetten, wir erleben aber vor allem in den Slums Drogen, Alkohol, familiäre Gewalt, Krankheit, Armut und medizinische Missstände. Die sozialen Schichten mit ihrer ungeschriebenen Hierarchie begegnen uns ebenso wie die vielen Sorgen und Nöte der in den Slums wohnenden Menschen. Der Autor lässt uns aber auch an philosophischen Gedanken der Protagonisten teilhaben, wenn in Männerrunden oder Dialogen über verschiedene Themen des Lebens diskutiert wird.
Die Atmosphäre von „Shantaram“ ist eine besondere. Der Leser taucht ein in die Metropole Bombays, in die Straßen der Slums und in die Gedankenwelten der Protagonisten. Der über tausend Seiten umfassende Roman bietet dabei spannende Literatur, die den Leser schon ab den ersten Seiten in Bombays Atmosphäre katapultiert. Die Protagonisten sind zwar zahlreich, aber so grandios präsentiert, dass man mit diesen Figuren leidet, wütend und verzweifelt ist und zugleich einen tiefsinnigen Schauer empfindet, folgt man den Dialogen, die wirklich etwas zu sagen haben.
Philosophisch interpretiert, geht es in „Shantaram“ immer um die Liebe. Der Fokus der Liebe zu anderen, zu sich selbst, zu etwas Höherem, zu einer Aufgabe – Liebe verfolgt den Leser durch alle Kapitel. Dass Lindsay/Linbaba/Shantaram/Roberts von einem Schicksalsschlag in den nächsten geschubst wird, ist dabei nicht unglaubwürdig erzählt. Das Tempo in „Shantaram“ ist nicht überdimensioniert, es überfährt den Leser nicht, lässt ihn aber auch nicht zur Ruhe kommen.
Die Haupthandlung selbst ist dabei ausnehmend spannend, allerdings wird diese Spannung nicht durch Gewalt und Action erzeugt, sondern durch liebevolle Figuren aufgebaut, die der Geschichte ihren Anteil an Leben, Dramatik, Philosophie und auch Gewalt einhauchen.
Der „Guru“, der sensible und etwas schlitzohrige Prabaker, ist eine Figur, die man fast schon mehr liebgewinnt als den Handlunsgträger Lindsay. Seine Botschaften sind nicht ohne Humor und hintergründig in Worte gefasst. Ohne Prabaker wäre Lindsay verloren gewesen, in psychischer wie auch physischer Hinsicht. Selten erlebt man in Erzählungen derartig präsente Figuren, die man faszinierend verfolgt, selbst wenn sie lediglich Nebenfiguren sind, aber nicht im Schatten der Schlüsselgestalt stehen.
Karla, in die sich Lindsay Hals über Kopf verliebt und sich dabei benimmt wie in den Anfängen der Pubertät, ist nicht nur schön an Gestalt, sondern auch sensibel, verletzbar und gerade wegen Letzterem emotional nach außen stark unterkühlt. Bindungen und Gefühlen will sie sich nicht stellen, sie scheut die Verantwortung, doch bringt sie dies so schonend und plausibel rüber, dass man ihre Beweggründe logisch und auch emotional nachvollziehen kann.
_Fazit_
„Shantaram“ ist ein epischer Roman, ein wunderbarer Exot in der literarischen Welt, der leidenschaftlich versucht, die Liebe als umfassendes Konzept in Worte zu fassen, und dem dies auch gelingt. Zwischen den Zeilen und den vielen Handlungsebenen gibt es so viel Wissenswertes und Imposantes zu erleben, dass jedes Gefühl ausgelebt werden kann.
„Shantaram“ ist auch oder gerade deswegen so faszinierend, weil der Schöpfer Gregory David Roberts seine Geschichte autobiografisch erzählt und dabei nicht nur sein Alter Ego, sondern auch sich selbst entdeckt und lieben lernt.
Das moderne Indien hat für westliche Leser mit „Shantaram“ eine umfassende Betrachtungsperspektive bekommen, mit vielen Blickwinkeln und vielen Persönlichkeiten, in denen wir uns trotz ihrer Andersartigkeit so manches Mal wie in einem Spiegel erkennen. Wenn Geschichten wie diese Emotionen in uns wecken und uns unsere Menschlichkeit bewusst machen, so sind sie besonders wertvoll und nach meinem Dafürhalten bedenkenlos zu empfehlen.
Die Filmrechte von „Shantaram“ sind längst verkauft, gesichert hat sie sich Johnny Depp. Und eines ist schon jetzt deutlich: Die Geschichte von „Shantaram“ lebt von ihren Charakteren und ihren Schicksalen. Ein Roman, vielleicht auch später ein Film, an den man sich erinnern und auf eine Fortsetzung warten wird – die bereits in Arbeit ist.
„Shantaram“ bietet Tragik, Dramatik und Liebe in Reinform.
_Der Autor_
Gregory David Roberts (* 1952 in Melbourne) ist ein australischer Buchautor und verurteilter Schwerverbrecher. Roberts sollte im australischen |HM Prison Pentridge| eine 24-jährige Haftstrafe absitzen. Dort brach er nach zwei Jahren aus.
Nachdem er das Sorgerecht für seine damals dreijährige Tochter nicht erhielt, wurde er heroinabhänging. Um seine Sucht zu finanzieren, beging er zahlreiche Raub- und Banküberfälle (allerdings mit vorgehaltener Spielzeugpistole). Nach seiner gelungenen Flucht über die Frontmauer des |HM Prison Pentridge| – am helllichten Tag – ließ er sich nach einem Zwischenaufenthalt in Neuseeland in Mumbai, Indien nieder. 1990 wurde er in Frankfurt gefasst und an seine Heimat ausgeliefert. Dort verbrachte er dann sechs Jahre im Gefängnis, davon zwei in Isolationshaft. In dieser Zeit begann er auch an seinem bekanntesten Buch „Shantaram“ zu arbeiten, das auf seinen Erfahrungen in Mumbai basiert.
Der Titel des autobiografischen Romanes „Shantaram“ basiert auf seinem Spitznamen, der ihm von der Mutter seines besten Freundes Prabaker verliehen wurde. Roberts schrieb außerdem ein Drehbuch des „Shantaram“-Romans und ein weiteres für den Film „Allegra“.
|Originaltitel: Shantaram
Originalverlag: St. Martin’s Press
Aus dem Amerikanischen von Sibylle Schmidt
Gebundenes Buch mit Schutzumschlag, 1088 Seiten
Mit Vignetten von Oliver Weiss|
http://www.goldmann-verlag.de
http://www.shantaram.com/
Victor Gunn – Das rote Haar

Victor Gunn – Das rote Haar weiterlesen
Daniel Glattauer – Gut gegen Nordwind

Lieber Leo …
Max Brooks – World War Z. Operation Zombie
Kaum ein Jahrzehnt ist vergangen, seit die menschliche Zivilisation beinahe unterging. Kein Atomkrieg, keine terroristischen Umtriebe und keine Ebola-Pandemie haben ihr den Untergang gebracht, sondern Zombies – verstorbene und wiederauferstandene Männer und Frauen, die nicht nur hungrig Jagd auf ihre früheren Mitmenschen machten, sondern diese durch ihren Biss selbst in lebende Tote verwandelten. Erst nach Jahren eines verzweifelten Kampfes konnten die Zombies ausgerottet werden. Die Zahl der Opfer geht in die Milliarden.
Der Autor dieses Buches gehörte einer Kommission an, die für die Vereinten Nationen die Geschichte des „Zombie-Weltkriegs“ rekonstruierte. Er konnte die Brennpunkte der Ereignisse bereisen und mit denen sprechen, die dort mit den Zombies in Berührung kamen (und dies überlebten). Die gesammelten Interviewtexte sind wichtige Steinchen in einem Mosaik, das bisher nie in seiner Gesamtheit dargestellt werden konnte. Sie wurden chronologisch geordnet und spielen an vielen Orten der Erde.
Victor Gunn – Das achte Messer

Victor Gunn – Das achte Messer weiterlesen
Thomas Muir – Kabine B 55

Alan Campbell – Devil’s Night (Kettenwelt-Chroniken 2)

Alan Campbell – Devil’s Night (Kettenwelt-Chroniken 2) weiterlesen
Arthur W. Upfield – Der schwarze Brunnen
Ein defektes Flugzeug lässt Kriminalinspektor Napoleon Bonaparte, genannt „Bony“, in der Ödnis des nordwestlichen Australien stranden. Agar’s Lagune besteht aus zehn Wohnhäusern, einem baufälligen Hotel und einer Kneipe; die einzige Sehenswürdigkeit besteht aus einem Ring leerer Flaschen, den trinkfreudige Viehzüchter, Schafhirten und Goldsucher im Laufe vieler Jahre um das Örtchen aufgeschüttet haben.
Aus Bonapartes unfreiwilligem Zwischenaufenthalt wird ein Kriminalfall, als Fernfahrer Sam Laidlaw 170 km nördlich von Agar’s Lagune den Jeep des Polizeiwachtmeisters Martin Stenhouse findet; der Fahrer hockt mit durchschossenem Herzen am Steuer. Allem Anschein nach hat Jacky Musgrave, Stenhouses Fährtensucher – ein Aborigine -, seinen Chef umgebracht und ist anschließend in die Wüste und eventuell zu seinem Stamm geflüchtet. Arthur W. Upfield – Der schwarze Brunnen weiterlesen
Harry Carmichael – Geflohen aus Dartmoor

Harry Carmichael – Geflohen aus Dartmoor weiterlesen
Victor Gunn – Der Tod hat eine Chance

Seamark – Das Kokainschiff

Michael Delving – Satan schreibt Memoiren
_Das geschieht:_
Einmal im Jahr besuchen die US-amerikanischen Antiquitätenhändler Dave Cannon und Bob Eddison England, um dort nach interessanten Stücken für ihren Laden zu stöbern. In Bartonbury, einem kleinen Städtchen in der Grafschaft Glouchestershire, wittern sie eine unerwartete Chance: Dort hat Tristram Vail seinen Altersruhesitz aufgeschlagen. Einst galt er als Hexenmeister und Antichrist, der eine große Anhängerschar um sich versammelte und durch gotteslästerliche und unzüchtige Praktiken von sich reden machte.
Nun ist Vail müde und knapp bei Kasse. Gern würden Cannon und Eddison einige Bände aus seiner legendären Bibliothek okkulter Schriften erwerben. Die Verhandlungen gestalten sich indes schwierig. Vail ist kein reuiger Sünder; im Gegenteil will er seine Memoiren schreiben, was einigen Jüngern, die inzwischen zu Ämtern und Würden gelangten, gar nicht gefallen dürfte. Außerdem geht das Gerücht, dass Vail hinter diversen Einbrüchen in Kirchen der Umgebung steckt, die anschließend auch noch geschändet wurden. Der Verdacht verstärkt sich, als Richard Foss, Vails Sekretär, in der Dorfkirche gefunden wird – scheinbar beim Versuch, einen kostbaren Kelch zu rauben, von einem alten Schwert durchbohrt, das sich wie durch Zauberhand (!) aus seiner Verankerung löste.
Chefinspektor Codd, der mit der Klärung des Falls beauftragt wird, ist ein alter Bekannter von Cannon und Eddison. Er hat deshalb nichts dagegen, dass sich das Duo detektivisch betätigt. Hinter den Kulissen von Bartonbury geht es alles andere als beschaulich zu. Nicht nur der alte Vail hütet düstere Geheimnisse. Schwarze Magie oder simpler Betrug: Was steckt hinter den Ereignissen? Diese Frage gilt es zu beantworten, bevor sich der nächste ‚Unfall‘ ereignet …
_Die Macht der Vergangenheit_
Alte Sünden sterben nicht wirklich, Ohne diese Tatsache gäbe es die meisten Krimis gar nicht. Irgendwann hat man einen Fehler begangen, man verstieß gegen ein Gesetz oder eine moralische Regel, kam davon bzw. wurde nicht zur Rechenschaft gezogen. Das Leben geht weiter, man steigt auf, genießt gesellschaftliches Ansehen. Immer bleibt jedoch die Erinnerung, die von der Angst vor Entdeckung begleitet wird. Irgendwann ist es so weit. Wie wird man reagieren? Das offene Geständnis widerspricht natürlich dem Wesen des Krimis. Genregerecht wird versucht zu vertuschen, man verwickelt sich in Widersprüche, gerät in die Enge, deren Fesseln schließlich durch Gewalt gesprengt werden sollen, was alles nur schlimmer macht.
Dieser Plot ist wahrlich klassisch und zeitlos zugleich. Er wird gern verwendet und kann durch diverse Ausschmückungen individualisiert werden. Das gelingt bedrückend oft besser als in diesem Fall: „Satan schreibt Memoiren“ – der Originaltitel lautet ähnlich knallig „The Devil Finds Work“ – ist einerseits ein grundsolider und andererseits ein ziemlich langweiliger Krimi, was durch die altbackene Übersetzung noch unterstrichen wird. Das Landhaus, das Schloss, der kleine Ort: Ein wirklich inspirierter Autor vermag auch im abgegriffenen Ambiente des englischen „Whodunit?“ Stimmung und Spannung zu schaffen. Michael Delving, der seine schriftstellerischen Erfolge außerhalb des Krimis feierte, bringt nur handwerklich sauberes Mittelmaß hervor.
_Zwei Amerikaner, aber nicht in Paris_
Seltsam fehl am Platz wirken Delvings Serienhelden. Dabei ist der Gedanke, zwei US-Amerikaner in die englische Provinz zu locken, gar nicht abwegig. Viele Krimi-Autoren haben sich des Kunstgriffs bedient, den Ort des Verbrechens quasi durch fremde Augen zu betrachten. Was für die Bewohner von Bartonbury selbstverständlich ist, muss den ausländischen Besuchern – und damit den Lesern – ausführlich erklärt werden. Amerikaner stehen darüber hinaus für eine lockere Lebensart, die gern in reizvollen Kontrast mit den steifen Briten gestellt wird.
Leider sind Dave Cannon und Bob Eddison zwei denkbar farblose Charaktere. Es musste noch ein Vierteljahrhundert verstreichen, bevor Archäologen, Historiker und Antiquitätenhändler zu Helden und die Buchläden mit Mystery-Thrillern geflutet wurden; Nicolas Cage führt in „National Treasure“ (besonders Teil II: „Das Vermächtnis des geheimen Buches“) vor, wie das dann filmisch umgesetzt wird: wesentlich actionreicher.
Dabei hat sich Autor Delving in dieser Hinsicht sogar etwas ausgedacht: Bob Eddison ist ein nordamerikanischer Ureinwohner (= „Indianer“, wie das 1970 noch gesagt werden durfte). Das ist für die Krimi-Handlung völlig unerheblich. Stattdessen baut Delving eine Szene ein, in der Eddison mit Rassenvorurteilen konfrontiert wird, was schrecklich aufgesetzt wirkt, weil es offenkundig nur Vorwand für einen politisch korrekten Anti-Rassismus-Appell an die Leserschaft ist. Womöglich hat sich diese in den turbulenten 1970ern, in denen die Diskussion über Menschenrechte en vogue war, nicht so sehr darüber gewundert wie der Rezensent im 21. Jahrhundert.
Bartonbury wird von der üblichen Schar exzentrischer Engländer bevölkert, die Delving publikumswirksam von Agatha Christie entliehen hat. Die Atmosphäre ist so altertümlich, dass die Erwähnung der Gegenwart des Jahres 1970 beinahe störend wirkt. Viele Zeilen widmet unser Verfasser der Beschreibung historischer Bauwerke und Artefakte; vielleicht wird der kleine Ort deshalb von so vielen Käuzen bewohnt … Bedauerlicherweise sind sie nur seltsam, aber nicht liebenswert und nur in Maßen unterhaltsam.
_Götterdämmerung für einen Magier_
Mehr Mühe hat sich Delving mit der Figur des Tristram Vail gegeben. Er ist in Gestalt, Auftreten und Biografie ein akkurates Ebenbild von Aleister Crowley (1875-1947), dem „Magicker“, Schriftsteller, Maler und Bergsteiger, der eine Zeit lang als „bösester Mensch des Jahrhunderts“ galt und sich selbst als die „Große Bestie 666“ aus den Offenbarungen des Johannes bezeichnete. (Insofern ist es nachvollziehbar, das uns Christopher Lee, der in seiner langen Filmkarriere so manchen gottlosen Finsterling mimte, vom Cover der deutschen Ausgabe bedrohlich anstarrt.) Tatsächlich war Crowley kein simpler Satanist, was seine Gegner, in den östlichen und kabbalistischen Lehren meist wenig bewandert und von Crowley, einem genialen Selbstdarsteller, geschickt manipuliert und gereizt, in der Regel nicht zur Kenntnis nahmen.
Michael Delving präsentiert mit Tristram Vail einen gealterten, von der Welt weitgehend vergessenen Crowley, der aber noch als Schatten seiner selbst eine faszinierende Persönlichkeit ist und von seinen Attitüden nicht lassen mag. Vail meint die Regeln der Selbstvermarktung verinnerlicht zu haben; er ist fest davon überzeugt, dass ihm seine Memoiren den Weg zurück ins Rampenlicht bahnen, denn „sex sells“, wie der alte Zyniker weiß. Zu seinem Pech verlässt er sich nicht darauf, sondern wandelt vorsichtshalber auch auf krummen Pfaden. Sein Schicksal ist nicht tragisch, sondern kläglich. Damit passt es sehr gut ins Finale, das zwar aufklärt, aber nichts von der Spannung der klassischen Kriminalromane aufweist, auch wenn alle Verdächtigen genrekonform zur Auflösung zusammenkommen: Dieser Roman ist keine echte Wiederentdeckung. „Satan schreibt Memoiren“ dürfte schon 1970 als simples Lesefutter gedient haben. Dabei ist es geblieben; nicht hinter jedem angejahrten Krimi verbirgt sich halt ein Klassiker, sondern manchmal nur – Staub …
_Der Autor_
Michael Delving wurde als Jay Williams am 31. May 1914 in Buffalo (US-Staat New York) geboren. Der Sohn eines Vaudeville-Produzenten besuchte in den frühen 1930er Jahren die Universität. In der Zeit der großen Wirtschaftskrise oft arbeitslos, trat er als Komödiant auf.
Ab 1936 arbeitete Williams als Presseagent für die „Hollywood Theatre Alliance“. Der II. Weltkrieg unterbrach diese Tätigkeit. Williams wurde einberufen und diente bis 1945 in der Armee. Schon in dieser Zeit begann er zu schreiben; sein Romandebüt wurde 1943 „The Stolen Oracle“, ein Krimi für jugendliche Leser.
Erfolgreich und berühmt wurde Williams vor allem mit seiner Mystery-Serie um „Danny Dunn“, die es zwischen 1956 und 1977 auf 15 Bände brachte. Neben weiteren Kinder- und „Young Adult“-Büchern verfasste er auch Historienromane und historische Sachbücher für ein erwachsenes Publikum, zahlreiche Science-Fiction-Storys sowie unter dem Pseudonym „Michael Delving“ sieben Krimis, davon sechs um den Antiquitätenhändler Dave Cannon, der mal mit, mal ohne seinen Partner Bob Eddison unfreiwillig in Verbrechen verwickelt wird. Insgesamt veröffentlichte Jay Williams, der am 12. Juli 1978 starb, mehr als 75 Bücher.
Die Cannon/Eddison-Krimis erschienen hierzulande im |Wilhelm Goldmann|-Verlag.
(1967) Smiling the Boy Fell Dead (dt. „Der Tod des Gärtners“) – Nr. 4188
(1970) The Devil Finds Work (dt. „Satan schreibt Memoiren“) – Nr. 4160
(1970) Die Like a Man (dt. „Das Geheimnis der 13 Stühle“) – Nr. 4141
(1972) A Shadow of Himself (dt. „Ein Schatten seiner selbst“) – Nr. 4210
(1975) Bored to Death/A Wave of Fatalities (dt. „Schwer wie Blei“) – Nr. 4538
(1978) No Sign of Life
Catherine Aird – Skelett mit Folgen

Catherine Aird – Skelett mit Folgen weiterlesen
Ellis Peters – Falsche Propheten
Das kleine Dorf Comerford in der englischen Grafschaft Shropshire gehörte nie zu den Orten, die man als ländlich-beschaulich bezeichnen würde. Hier wird seit Jahrhunderten Kohle gefördert; eine harte, gefährliche Arbeit, die im Tagebau betrieben wird, was ausgedehnte Flächen der Landschaft in Wüsteneien verwandelt hat, die an die Oberfläche des Mondes erinnern. Die Plackerei in den Kohlengruben hat einen harten, schweigsamen Menschenschlag hervorgebracht. Konflikte sind häufig und werden mit den Fäusten oder dem Messer ausgetragen. Im Jahre 1950 ist die Situation explosiver denn je. Ein halbes Jahrzehnt nach dem Ende des II. Weltkriegs sind dessen Folgen auch im siegreichen England keineswegs überwunden. Viele der jungen Männer Comerfords sind gefallen. Wer überlebte, kehrte verletzt und mit bedrückenden Erinnerungen an die Front, womöglich mit Orden geschmückt und als Held heim, um sich plötzlich wieder als gemeiner Grubenarbeiter oder Schafhirte wiederzufinden.
In Comerford gab es ein Lager für deutsche Kriegsgefangene und später für „Displaced Persons“, Vertriebene aus allen kriegsverheerten Ländern des Kontinents. Inzwischen wurde es aufgelöst, doch viele Insassen blieben in England: frei aber fremd und misstrauisch gemieden von den Einheimischen. Sergeant George Felse hat ständig im ehemaligen Lager zu tun, denn dort gibt es täglich Auseinandersetzungen. Bei einem seiner zahlreichen Besuche lernt er den Deutschen Helmut Schauffler kennen, der einen Mitbewohner attackiert hat. Der junge Mann weiß beredt die Schuld von sich zu weisen, doch Felse argwöhnt, dass zutreffen könnte, was Zeugen ihm zutragen: Schauffler war und ist noch überzeugter Nazi, der seinen Privatkrieg mit dem britischen ‚Feind‘ austrägt. Ellis Peters – Falsche Propheten weiterlesen