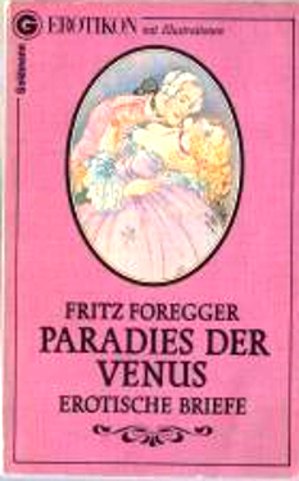Im Paradies der Venus finden sich unerschöpfliche Freuden. Der junge Held dieses Buches weiß sie zu genießen, und unermüdlich pflückt er die Frucht der Liebe…. (Verlagsinfo) Die Briefe, die der junge Edmond de Grammont an seine Tante, die Herzogin und Geliebte, schickt, berichten von seinen amourösen Heldentaten. Dabei befindet sich der Dragoner mit den französischen Truppen auf einem Feldzug gegen die Deutschen im Elsass und in Lothringen.
Hinweis: Dieser illustrierte 31. Band der EROTIKON-Reihe wurde am 30.3.1983 von der Bundesprüfstelle indiziert. Deshalb ist er bis heute eine Rarität.
Der Autor
Im Nachwort klärt uns der Herausgeber der EROTIKON-Reihe über den wahren Autor auf: Es war der Wiener Rechtsanwalt Dr. Fritz Foregger alias „Fritz Thurn“, bekannt auch als Autor der „Weisheiten der Aspasia“. Er versteckte sich hinter dem Pseudonym Fritz Thurn, als er ca. 1925 die „Zwölf Briefe des Chevalier de Grammont an die Herzogin von Richelieu“ veröffentlichte.
Handlung
Die Briefe, die der junge Offizier Edmond de Grammont an seine Tante, die Herzogin und Geliebte, schickt, berichten von seinen amourösen Heldentaten. Dabei befindet sich der Dragoner mit den französischen Truppen auf einem Feldzug gegen die Deutschen im Elsass und in Lothringen. Er ist ein rechter Draufgänger, der keinem Rock widerstehen kann.
Sein erstes Opfer ist eine junge Marquise, deren wohlgerundeten Hintern er hinter der Mauer ihres Klosters verwöhnt, während sein Knappe Blaisois sie an den Armen festhält. Seine zweite Begegnung ist wesentlich heikler: Als er bei einem Frauentausch mitmacht, merkt Liane O. recht schnell, dass ihr neuer Liebhaber ungewohnte Liebespraktiken anwendet und holt ein Öllämpchen. In dessen Lichtschein entdeckt sie den Fremden in ihrem Bett. Flugs holt sie eine kleine versteckte Pistole und drückt den Abzug. Dass die Waffe den Dienst versagt, wird zu ihrem Verhängnis, denn nun geht der Dragoner zum Gegenangriff über…
Ein Dame-Opfer
Der Spanische Erbfolgekrieg geht weiter und führt Edmond ins Elsaß. Auf Schloss Arnau residiert Baron Bolzheim mit seiner frisch angetrauten Frau Bertha. Edmond würde sie zu gern vernaschen. Als der Baron durch abgefangene Briefe der Kollaboration mit dem deutschen General Aldringen überführt wird, müsste man ihn eigentlich standrechtlich erschießen. Doch Bertha setzt für sein Leben ein – Edmond können nun mit ihr machen, was er wolle. Da fällt Edmond ein teuflischer Plan ein: Während er sich an Berthas jungem Alabasterkörper – wie ist ein Rotschopf – gütlich tut, muss ihr Mann dabei zusehen. Das führt dazu, dass der Baron sie als Dirne und Hure schmäht, woraufhin sich Bertha ihrem Liebhaber umso intensiver hingibt. Doch der Ausgang dieser Begegnung ist unerwartet…
Liebe im Dreieck
Edmond hat sich endlich Hals über Kopf verliebt, und das, obwohl sein Herz eigentlich ganz seiner Lehrmeisterin, der Herzogin gehört. Blanche ist die 16-jährige Tochter des Herrn von N., und ihre anbetungswürdige Gestalt ist die einer schlanken, brünetten Nymphe. Edmond hat sie im Teichbad mit ihrer Freundin, der blonden und molligen Georgette erspäht, wie sie einander streichelnd umarmten.
Nun aber gibt sich Blanche aus unerfindlichen Gründen abweisend und spröde, während sich Georgette sehr für den Besucher erwärmt. Dank eines Donnerwetters während eines Feuerwerks hat Edmond indes unerwartet Gelegenheit, Blanches Allerheiligstes zu erkunden, was sie ihm jedoch sehr übelnimmt. Auf der Kutschfahrt nach Hause fällt es ihm umso leichter, mit Georgette amouröse Händel anzufangen, denn er will Blanche eifersüchtig machen.
In der Hoffnung auf eine Nacht mit Blanche, erlangt er den Schlüssel zum Schlosszimmer, in dem die beiden Mädels gemeinsam schlafen. Als Georgette lustvoll stöhnend seine Aufmerksamkeit empfängt, erwacht Blanche und will sich in Sicherheit bringen. Doch der Schlüssel steckt nicht im Schloss der abgeschlossenen Tür – ist sie ihm jetzt wehrlos ausgeliefert? Wider Erwarten wirkt nun endlich der Schlüssel namens Eifersucht und Blanche gibt seinem Drängen nach. Als sich die beiden Freundinnen zanken, versöhnt Edmond sie wieder.
Unerwartete Eroberungen
Die französische Armee drängt die Kaiserlichen immer weiter zurück, so dass nach Lothringen auch das Elsass erobert werden kann. Nach der Einnahme von Straßburg quartiert sich Edmond im Haus des Bürgermeisters ein, wo ihm dessen schöne Gattin den Kopf verdreht. Doch die Stadt ist in Aufruhr, weil Seine Allerchristlichste Majestät König Ludwig sein Kommen angekündigt hat. Als der König durch die Hauptstraße reitet, scheint die Gelegenheit günstig. Während sich die Schöne nicht wehren kann, erobert Edmond sie von hinten.
Eine unverhoffte Entdeckung
Der Feldzug geht weiter und führt Edmonds Dragoner bis nach Bernkastel. Mit Karachi reiten sie ins Lager des Feindes und nehmen es ein. Nur ein junger Bursche ist so dumm, sich ihnen mit einem Rapier entgegenzustellen. Edmond besiegt ihn mit links und verdonnert ihn zum Dienst in seinem Zelt. Doch dieser „Roul“ erweist sich als renitent, so dass er ihm den Hintern versohlen muss. Doch was findet er das in der Hose des Jungen? Fein gerundete Hinterbacken und keine Spur eines männlichen Genitals. Während er Roul den Hintern versohlt, lässt sich Edmond nicht anmerken, dass er ein Mädchen in Jungenkleidern vor sich hat.
Roul dient ihm gewissenhaft, bis zu jenem Tag, da Edmond andeutet, dass er „ihn“ aus seinen Diensten entlassen wolle. Da erst enthüllt ihm „Roul“, dass „er“ die Tochter von General Kessler sei und Lorle heiße. Edmond möge doch bitteschön nicht ihr „Magdtum“ rauben, also ihre Jungfernschaft, sofern er die Ehre eines Ritters habe. Diesen Appell kann Edmond nicht ignorieren, will er nicht seinen Ehrenschwur brechen. Er muss sich zwischen Ehrencodex und Geilheit entscheiden….
Bei den Calvinisten
Ein Befehl des Königs schickt Edmond in die tiefste Provinz, nämlich in die Berge nahe Lyon. Die Stadt selbst ist von den Schweizer Calvinisten übernommen worden, die für ihren strenggläubigen Protestantismus bekannt oder vielmehr berüchtigt sind. Ausgerechnet hier stößt Edmond auf das Lust erregendste Weib, das er je gesehen hat (von seiner Herzogin mal abgesehen): Marion Fontin nennt mit ihren 28 Jahren einen sinnlichen Körper ihr Eigen, dessen hervorstechendste Merkmale – die Spitzen ihrer voluminösen Brüste – sie durch eine unnatürliche Körperhaltung sie zu verbergen sucht, vergeblich natürlich. Gleiches versucht auch Edmond bei ihrem Anblick, denn sein bester Freund regt sich gleich gewaltig in seiner Hose.
Edmonds Männer haben Marions Dienstmädchen vergewaltigt, sie verlangt Bestrafung – die er ihr auch gewährt. Er will es seinen Männern nicht nachtun. Es ist nicht indes nicht zu übersehen, dass Marions Gatte nur selten zu Hause weilt und seine Frau sexuell darben lässt. Gespräche mit ihr über Religion sind wenig dazu angetan, dieses Feuer zu löschen oder gar zu verbergen.
Und als die Rede auf Geißelung und Fleischesabtötung kommt, scheint ein Funkeln in Marions Augen zu treten. Hat er sich getäuscht? Edmond fragt Suzon, die alte Amme, die seine Männer verschont haben. Für eine finanzielle Zuwendung erzählt die Alte, dass Madame regelmäßig freitags gegeißelt werden wolle, um die Gelüste ihres Fleisches abzutöten. Nun bietet sich Edmond endlich eine Chance, Marion zu erobern. Wird er Erlösung bringen oder Verdammnis ernten?
Praktische Aufklärung
In der zweiten Schlacht von Hochstädt, die am 3. August 1704 mit einer vernichtenden Niederlage der sieggewohnten Franzosen endet, ist Edmond schwer am Knie verwundet worden. Ein Baron der verbündeten Bayern nimmt ihn bei sich auf, denn er braucht mindestens acht Wochen absolute Ruhe, wie der Bader anordnet. Welch ein Entzücken erfasst Edmond jedoch, als er die schöne Tochter Gundel des Barons erblickt: blond, blauäugig und von reinster Unschuld. Er beschließt, sie zu erobern und in die Geheimnisse der Liebe einzuführen.
Sprachunterricht, ein Schachspiel und die schlüpfrigen Fabeln des Jean de la Fontaine ebnen den Weg zu Gundels Herzen. Doch nach den ersten Berührungen scheint die Jungfer zu Eis zu erstarren. Edler Rückzug oder forscher Sturmangriff – das ist jetzt die Frage.
Ein reuiger Sünder?
Der Spanische Erbfolgekrieg tobt weiter, und Edmond Truppe verschlägt es nach Nauheim, wo sie ein Kloster der Ursulinerinnen stürmt und plündert. Die einzige junge Frau, die der Notzucht wert wäre, findet Edmond in Gesellschaft der Äbtissin. Es ist eine rund 16-jährige junge Frau namens Klothilde, die wie sich herausstellt, bereits in den Orden aufgenommen wurde. Der verbale Protest ist heftig, doch gegen Edmonds Gewalt hilft keine Gegenwehr, und er zerrt sie in ihre Zelle. Er muss zu seinem Frust ein letztes Hindernis entdecken: einen abgeschlossenen Keuschheitsgürtel. Um ein Haar klemmt er sich beim Versuch, das Hindernis zu umgehen, den Finger ein.
Doch jemand muss den Schlüssel zum Schloss des Gürtels haben, und wer sonst als die Äbtissin könnte dies sein? So dauert es nicht lange, bis das Hindernis beseitigt und Klothilde „erobert“ ist. Als er nach Stunden zurückkehrt, um nach ihr zu sehen, muss er erkennen, dass er einen Fehler gemacht hat: Er ließ den Schlüssel im Schloss stecken. Nun hat Klothilde den Gürtel wieder abgeschlossen und den Schlüssel aus dem Fenster ihrer Zelle auf einen vorbeifahrenden Proviantwagen geworfen, der bestimmt schon über alle Berge ist. Sie hat der Liebe für immer entsagt, und Edmond ist schuld daran. Reue erfüllt ihn.
Das bittere Ende
Der Spanische Erbfolgekrieg geht 1714 in sein letztes Jahr, und die letzte Schlacht findet bei Barcelona statt. Die Schlacht selbst wird nicht erwähnt, aber Edmonds Truppe findet Unterkunft auf einem Schloss, das von einer umfangreichen Witwe namens Donna Dolores Castrados beherrscht wird. Nicht nur üble Gerüchte umgeben sie: Sie habe bereits vier Ehemänner ins Grab befördert. Auch ein verdächtiger Geruch scheint ihr anzuhaften, meint Edmond zu erschnuppern, gerade so, als wäre sie krank. Sie daher abzuweisen, erweist sich als keine gute Idee, denn ihre Rache ist fürchterlich….
Mein Eindruck
Natürlich ist Edmond ein Wüstling, wie er im Buche steht. Doch es sind Kriegszeiten, die er schildert, und der Spanische Erbfolgekrieg (1704-1714), der mit der Niederlage der Franzosen König Ludwigs endet, kann es an Wildheit, Barbarei und Zerstörung locker mit dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) aufnehmen. Edmond, der Ich-Erzähler, glaubt sich im Recht des Siegers, noch dazu ihm Recht eines dominanten Mannes, der ungestraft jede Frau, die er sich wünscht, benutzen darf, wie es ihm gefällt. Seien sie nun Klosterschülerinnen, Bürgermeisterinnen oder Schlossherrinnen, Edmond nimmt sie alle.
Besonders hat es ihm jedoch das junge Gemüse angetan, und hier betritt der Autor wirklich moralisches Grenzgebiet. Die Mädchen mögen 14, 15 oder 16 Jahre alt sein, sie sind Edmond allesamt willkommene Beute. Denn er ist nicht Herr seiner Sinne, sondern der Knecht seines Liebeslümmels, der ständig befriedigt werden will. Offenbar hat es die Herzogin, der Edmond so eifrig seine Eroberungen wie auch Verfehlungen brieflich beichtet, versäumt, ihm auch ethische Grundsätze mitzugeben, die über den Ehrenkodex eines Ritters hinausgehen. Mädchen, vor allem unschuldige, stehen daher ganz oben auf seine Beuteliste. Manche Mädchen wie Gundel oder Blanche sind dankbar, andere schlicht wehrlos.
Doch auch einen Wüstling muss einmal die gerechte Strafe ereilen. Die Vergewaltigung der jungen Nonne Klothilde in Nauheim ist nur das schlechte Omen, das der endgültigen Strafe vorausgeht. Reue genügt nicht, muss Edmond feststellen, nachdem er kastriert worden ist. Donna Dolores Castrado trägt ihren Namen wirklich zu Recht. Dolores ist ein Name voll Grauen: Sie ist nicht nur geschlechtskrank und stinkt, sie ist auch erbarmungslos, was ihre Rache anbelangt. Am Ende kommt Edmond die Mündung seiner Pistole wirklich freundlich vor und hält sie sich an den Kopf.
Die Geschichten, die Edmond erzählt und seiner Herzogin widmet, sind flott erzählt, beinhalten stets eine spannende Verführung, gipfeln in einer mehr oder weniger willkommenen Vergewaltigung – die Damen hatten seinerzeit leider keine Rechte – und entbehren nie einer moralischen Erkenntnis. Keine Begegnung bleibt folgenlos, sondern trägt, ganz im Sinne der Aufklärung, zu Edmonds moralischer Erziehung bei.
Das ist umso erstaunlicher, weil ja das Buch erst in den Zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts geschrieben wurde. Aber die geschilderten Taten, die im 20. Jahrhundert bereits als Verbrechen eingestuft werden konnten, nildeten möglicherweise genau jene Themen, mit denen sich der Rechtsanwalt Foregger in seiner täglichen Arbeit befassen musste. Schließlich waren Vergewaltiger in den letzten 200 Jahren (zwischen 1714 und 1927) nicht ausgestorben. Nur wurden ihre Vergehen nicht mehr im Krieg begangen, sondern im Frieden. Dass sie im Krieg begangen wurden, macht sie nicht legitimer, lässt der Autor durchblicken. Wären sie das nämlich, dann müsste Edmond, der Wüstling, nicht am Ende den höchsten Preis bezahlen, sondern würde fröhlich in den Sonnenuntergang reiten.
Der Stil
Der Autor war Österreicher und ahmte einen Stil nach, den er im früheren 18. Jahrhundert verortete. Daher klingt seine Wortwahl und Stilistik vielfach altertümlich. Schon die literarische Form des Briefs ist ein Kniff, der es ihm erlaubt, die Ich-Form der Erzählperspektive zu wählen, um seine Seelenregungen zu offenbaren, und so einen völlig subjektiven Standpunkt einzunehmen. Der Erzähler selbst beichtet seiner Angebeteten und Mentorin, aber das ist keine Vorwegnahme eines Urteils. Dem Leser ist es überlassen, über dieses Subjekt zu urteilen.
Textschwächen
S. 93: “Sie ahnte wohl, dass ich zugleich mit seinem (!) entzückenden Gesäße auch gleich ihr Geheimnis entschleiert hatte…“: Statt „seinem“ sollte es natürlich „ihrem“ heißen. Offenbar stand zuvor ein Mädchen anstelle von „sie“, und dafür wäre „seinem“ passend gewesen. Aber bei einer Ausbesserung der Textstelle wurde „seinem“ übersehen, so dass es zu einer Verwirrung der Geschlechter gekommen ist.
S. 94: “das Magdtum eines unglücklichen Mädchens“. Gemeint ist ihre Jungfernschaft.
S. 107: “Dass sie für Geschenke nicht ganz unempfindlich war…“: Korrekt müsste es „unempfänglich“ heißen. Denn Geschenke werden empfangen, nicht empfunden.
S. 133: “angeschwellte Klitoris des Mädchens“: Diese falsche Form von „anschwellen“ sollte korrekt „angeschwollen“ heißen. Der Fehler tritt zweimal auf.
S. 153: “dem Reize der scheinbar harmlosen Liebesbeziehungen hinzugeben“: Gemeint sind aber die Liebesbezeigungen.
S. 157: “kraftstro[t]zenden Brust“: Das T fehlt.
Die Illustrationen
„Die Illustrationen sind von dem 1875 in Wien geborenen Zeichner und Maler Franz Christophe“, teilt der Herausgeber mit. Die ca. fünf Darstellungen galanter Begegnungen zwischen einem Mann und einer Frau zeichnen sich durch Einfachheit der Linien aus, das heißt aber nicht, dass man nicht genau hinschauen müsste. So gilt es etwa auf Seite 114 die beiden Köpfe der Akteure zu suchen, was nicht ganz einfach ist. Zum Erstaunen des Betrachters tritt auch ein kleiner Amor auf, der über den Liebenden schwebt. Die Motive steigern hinsichtlich der Action vom Entblößen und Betrachten bis zur eindeutigen Interaktion.
Unterm Strich
Ich habe das Büchlein von nicht mal 200 Seiten in wenigen Tagen gelesen. Die geschilderten Szenen lassen in zehn von zwölf Fällen nicht an pikanter Verführung fehlen, insbesondere dann, wenn es um junge Mädchen geht, die zum Beuteschema des Erzählers gehören. Der heutige Leser muss sich indes auf das Schlimmste gefasst machen, wenn es um Vergewaltigungen geht. Die von Edmond „eroberten“ Mädchen und Frauen sind völlig recht- und wehrlos seinen Taten ausgeliefert. Rechtfertigt der Krieg diese Verbrechen? Genau wegen dieser Frage werden sie vom Autor, also Foregger, auch der kritischen Beurteilung durch den Leser unterbreitet.
Eine Beichte
Die Briefe sind eine subjektive Beichte an eine übergeordnete Person, die Herzogin. Edmond, der Erzähler, fühlt sich in zehn von zwölf Fällen im Recht, was seine Eroberungen angeht, doch im elften Brief erfüllt ihn angeblich die „Reue eines Sünders“. Er hat also genug moralische Maßstäbe, um sein eigenes Verbrechen zu verurteilen. Dass diese Reue nicht reicht, muss er im zwölften Brief zugeben: Ihn hat die mehr oder weniger angemessene Strafe durch eine „weibliche Bestie“, also eine dominante Frau, ereilt und als Folge wird er nie wieder den Geschlechtsakt ausführen. Mag sich nun der Leser in selbstgerechter Zufriedenheit zurücklehnen – das schafft den Tatbestand der Vergewaltigung auch im 20. und 21. Jahrhundert nicht aus der Welt.
Zum Buchtitel
Ist es wirklich ein „Paradies“, wie der Autor im Titel behauptet, das sein Erzähler hier durchwandert? Für die Opfer des Wüstlings sicherlich nicht, selbst wenn sich die eine oder andere dankbar dafür zeigen mag, zur Frau gemacht worden zu sein. Die Bezeichnung „Paradies“ erweist sich zunehmend als ironisch, wenn nicht sogar als sarkastisch, wenn den Sünder erst die Reue, dann die Strafe für seine Missetaten ereilt. Oder fungiert Donna Dolores de Castrado – nomen est omen – als Erzengel, der den eifrig Liebenden aus dem Paradies vertreibt? Warum nicht.
Taschenbuch: 174 Seiten.
Der Autor vergibt: