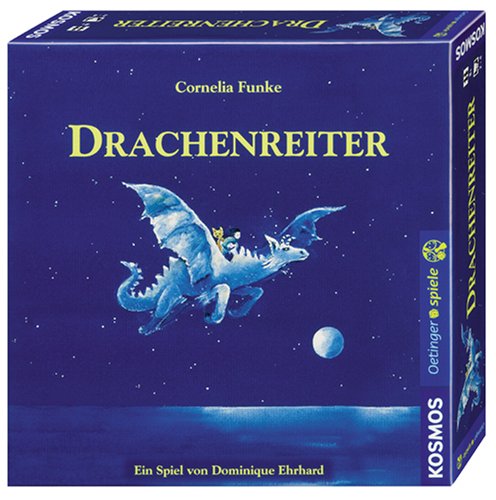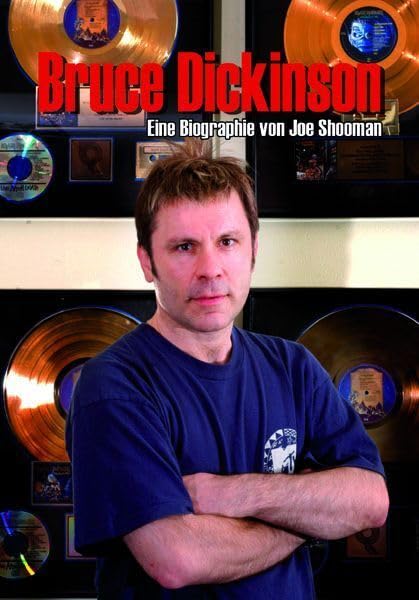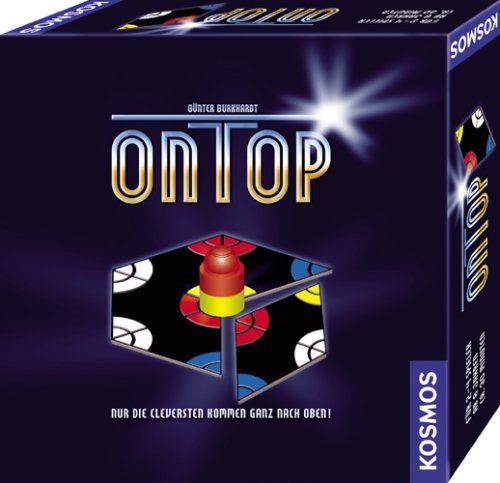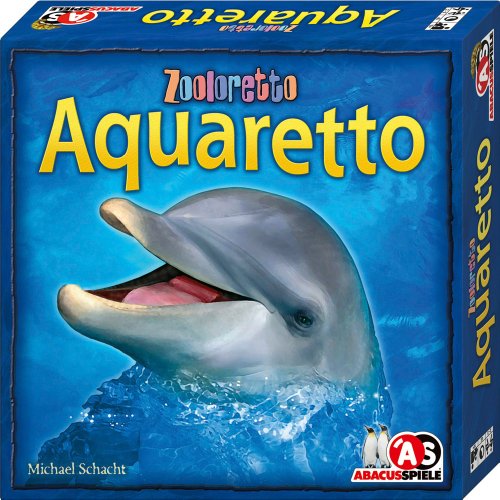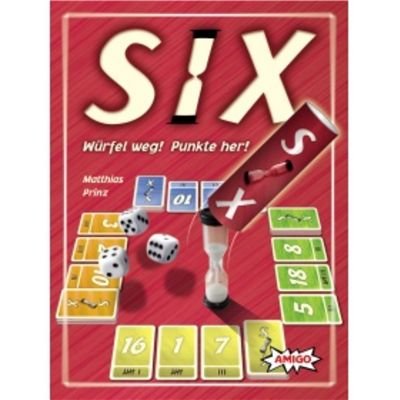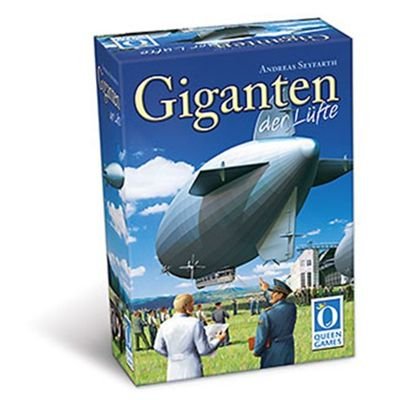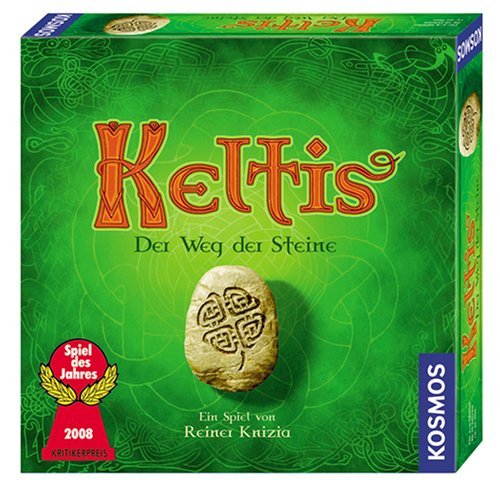Bereits 1997 veröffentlichte Cornelia Funke ihren Jugendfantasy-Roman „Drachenreiter“ in hiesigen Landen und ahnte zu dieser Zeit wohl noch nicht, welche Wellen dieses Buch noch schlagen würde. Zur amerikanischen Erstveröffentlichung ganze sieben Jahre später durfte die Autorin nämlich die Spitzenposition der |New York Times|-Bestsellerliste erklimmen und damit einen ihrer größten Erfolge feiern. Der französische Maler Dominique Ehrhard fand die Story darüber hinaus würdig genug, um ihr ein Brettspiel zu widmen, welches er nun über den |Kosmos|-Ableger |Oetinger Spiele| auf den Markt bringt. Nach „Tintenherz“ ist dies bereits der zweite Titel der erfolgreichen Schriftstellerin, der es via |Kosmos| aufs Spielbrett schafft.
_Spielidee_
Ehrhard hat die Geschichte des Romans weitestgehend für sein Konzept übernommen, wenngleich das Spiel alles in allem ein ganzes Stück einfacher gestrickt ist. Die Spieler bewegen abwechselnd die vier Hauptfiguren vom Tal der Drachen in den Saum des Himmels, den letzten Zufluchtsort der Drachen, der ihnen endgültig Schutz vor dem fiesen Feuerspucker Nesselbrand bieten soll.
Reihum würfeln die Spieler für die Bewegungen der Protagonisten und achten schon einmal darauf, in welcher Reihenfolge die Figuren über die Landschaft auf dem Spielbrett reisen. Ziel ist es nämlich, die vier Charaktere in einer bestimmten Reihenfolge im Saum des Himmels zu platzieren, denn nur so kommt man an die begehrten Drachentränen, deren Besitz später über Sieg und Niederlage entscheidet. Derjenige Spieler nämlich, der auf der Reise sowie im Zielgebiet die meisten dieser Tränen einsammelt, ist auch gleichzeitig der Gewinner in „Dracheneiter“.
_Spielmaterial_
• 1 zweiteiliger Spielplan
• 4 Auftragskarten
• 8 Abenteuerchips
• 4 gelbe Kampfchips
• 4 Heldenfiguren mit Standfüßen
• 1 gelbe Nesselbrand-Figur mit Standfuß
• 2 Würfel
Das Spielmaterial ist, den hohen Ansprüchen des Verlags entsprechend, wirklich prächtig. Sowohl die Karten als auch die Chips bestehen aus extra dickem Karton und sind zudem optisch sehr schön aufbereitet. Gleiches lässt sich für die stimmungsvollen Chips und die liebevoll skizzierten Teile des Spielplans sagen, die einen materiell wie visuell absolut fantastischen Eindruck hinterlassen. Keine Frage: Hier wurde mit besonderem Blick auf die Zielgruppe gearbeitet.
_Spielvorbereitung_
Vor jedem Spiel wird zunächst der Spielplan zusammengesteckt. Anschließend werden die Heldenfiguren in einer bestimmten Anordnung vor der Figur des bösen Drachen Nesselbrand aufgestellt. Die Abenteuerchips werden auf dem Spielplan abgelegt, ebenso die Kampfchips im Zielgebiet, dem Saum des Himmels. Als Letztes erhält nun jeder Spieler eine der Auftragskarten, die aussagen, in welcher Anordnung die vier Figuren auf der Zielgeraden zu positionieren sind. Je mehr Treffer man hierbei erzielt, desto mehr Kampfchips heimst man ein – und nur derjenige, der hier gut plant, kann am Ende um den Sieg mitspielen.
_Spielablauf_
Der Spielzug in „Drachenreiter“ ist prinzipiell ganz einfach. Man würfelt mit den beiden Würfeln und entscheidet nun, welche Figuren man mit dem Resultat weiterbewegt. Optionen gibt es hier mehrere: Entweder summiert man die Würfelaugen und zieht nur eine Figur vorwärts oder teilt das Ergebnis auf zwei Figuren auf. Allerdings gibt es hier auch einige Sonderfälle: Ein Pfeil bedeutet, dass man eine Figur um ein Feld zurücksetzen muss. Und wer ein schlichtes N auf den Würfel bekommt, muss sich möglicht schnell vor Nesselbrand in Sicherheit bringen. Der nämlich greift nun die letzte Figur in der Reihe an und versucht, dieser ihre Drachentränen zu stehlen. Sollte ein Spieler bereits Tränen in der Farbe dieser Figur in Form eines Abenteuerchips besitzen, muss er diesen nun wieder abgeben.
Abenteuerchips erhält man im Übrigen, sobald eine der vier Figuren auf einem Feld mit einem Chip in der gleichen Farbe landet. Der Spieler, der diese Figur gesetzt hat, nimmt den Chip an sich und behält ihn bis zur Schlusswertung, sollte Nesselbrand nicht in der Zwischenzeit angegriffen haben. Im Umkehrschluss bedeutet dies natürlich, dass man stets versuchen muss, diese Figuren möglichst weit nach vorne zu bringen, da Nesselbrand immer nur die letzte Gestalt in der Reihe angreift.
Auf diese Weise bewegt man die vier Helden gen Ziellinie, sammelt nach Möglichkeit Abenteuerchips ein und drängt die Figuren, deren Abenteuerchips im Besitz der Mitspieler sind, nach Möglichkeit weit nach hinten. Auf der Schlussgeraden gilt es dann, die Auftragskarten genauer zu studieren und die Helden bestenfalls genau in der Anordnung einzureihen, wie sie hier abgebildet sind. Für jede richtige Position gibt es den zugehörigen Kampfchip. Sobald nun alle Charaktere den Saum des Himmels angelangt sind, werden die gesammelten Chips umgedreht und die darauf befindlichen Drachentränen gewertet. Der Spieler mit dem besten Resultat hat gewonnen. Bei Gleichstand zählt die Anzahl der gesammelten Chips.
_Persönlicher Eindruck_
Mit Adaptionen erfolgreicher Jugendromane ist das Team vom |Kosmos|-Verlag mittlerweile längst vertraut, weshalb man sich um die passende Aufmachung und Gestaltung schon gar keine Gedanken mehr machen muss. Und in der Tat ist vor allem die Aufbereitung des Spiels einer der Punkte, die in der Adaption zu Cornelia Funkes Roman wirklich herausragen.
Allerdings soll der hier erzielte Effekt keinesfalls von der wirklich guten Spielidee ablenken, die ein richtig schön ausgewogenes Verhältnis aus Glück und Taktik bietet und insbesondere durch die Aufteilung in zwei zusammengehörige Spielphasen bis zum Ende spannend bleibt. So schleicht sich zunächst der Eindruck ein, dass eh erst die letzten Runden des Spiels wirklich bedeutend sind, doch da die Abenteuerchips in der Schlusswertung das Zünglein an der Waage darstellen, darf man sich auch auf der Reise durch das Tal der Drachen keinen größeren Fehler erlauben – und das macht das Spiel mitunter strategischer, als es auf den ersten Blick den Anschein hat.
Das Romanthema ist indes nur am Rande bedeutsam und wird in erster Linie durch die grafische Aufarbeitung wiedergegeben. Besonders der schöne Spielplan tut sich hier positiv hervor und sorgt für die nötige Atmosphäre. Den Effekt, dass man sich anschließend dazu berufen fühlt, auch das Buch zu erwerben, hat das Spiel aber nicht wirklich. Braucht es jedoch auch nicht, denn unabhängig von der Vorlage überzeugt „Drachenreiter“ mit einem sehr schön ausgeklügelten Konzept und einem spannenden, abwechslungsreichen Spielverlauf. Gerade für Familien und das jüngere Publikum gibt es daher auch eine klare Empfehlung für diesen kompakten Neuling auf dem Spielemarkt.
http://www.kosmos.de
_Cornelia Funke auf |Buchwurm.info|:_
[„Tintenherz“ 2005 (Hörbuch)
[„Herr der Diebe – Das Hörspiel zum Film“ 2356