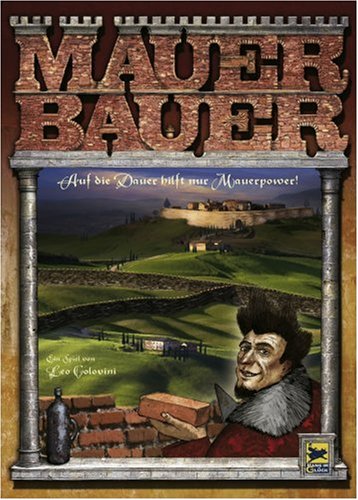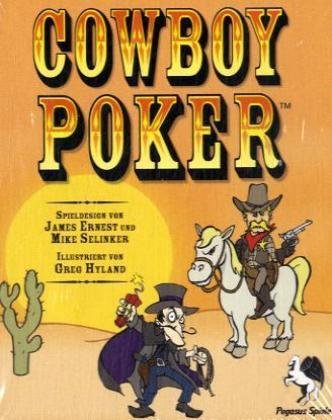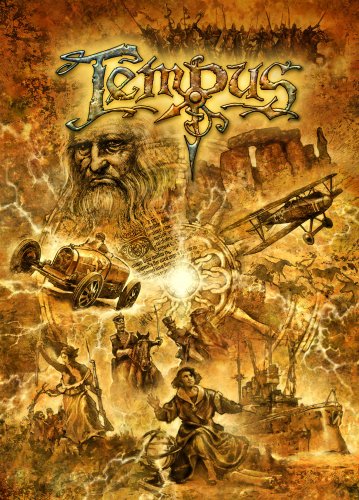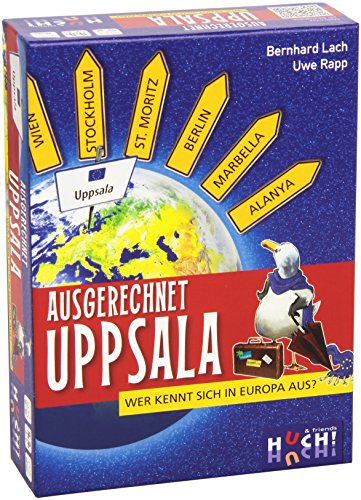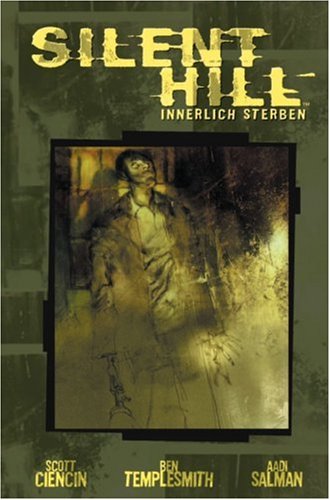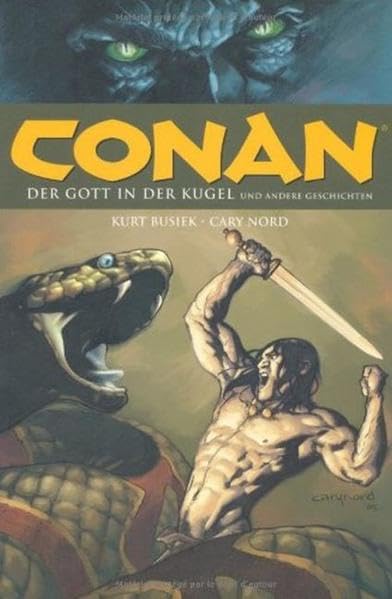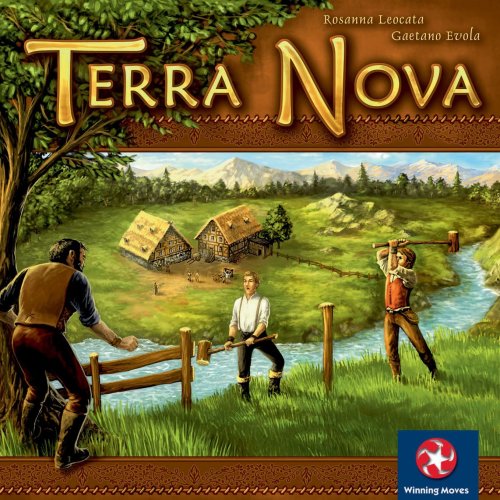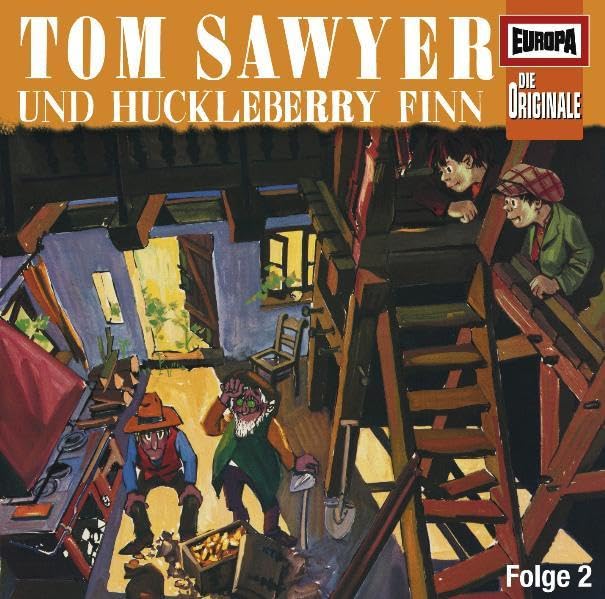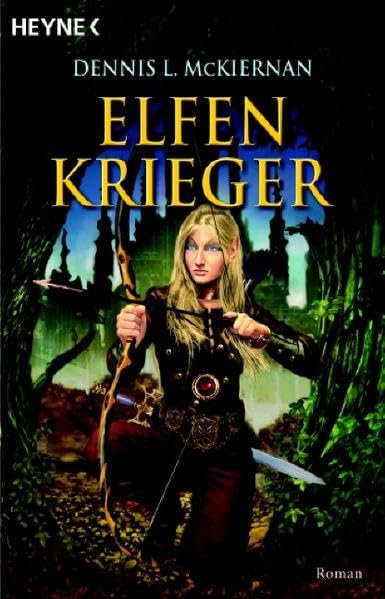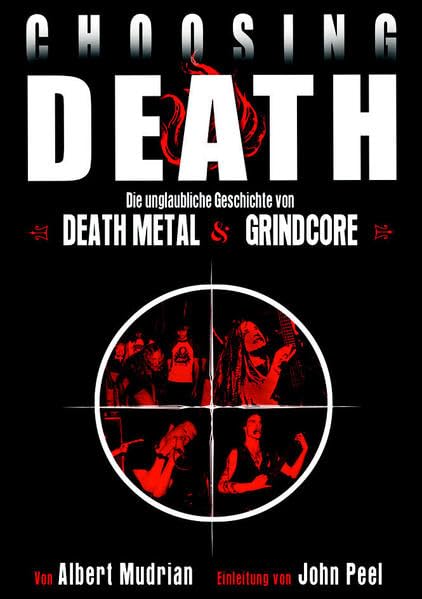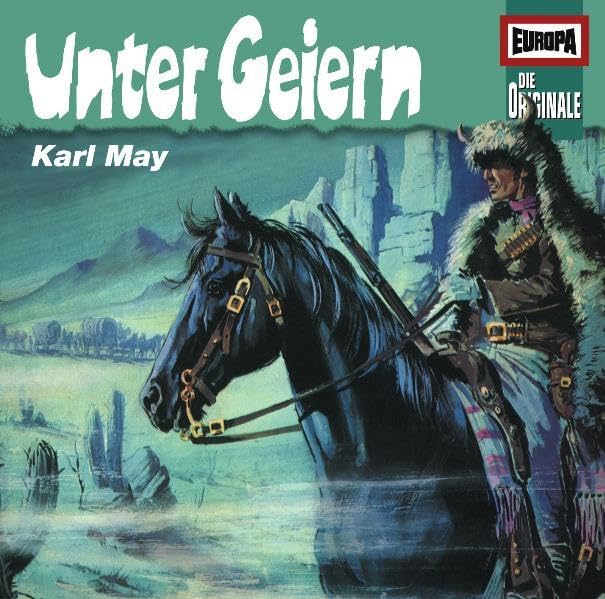_Zurück zu den Wurzeln?_
Sind es nicht eigentlich die schlichten Spiele, die einen meist durch einen tollen Aufbau, leicht verständliche Regeln und einen dennoch hohen Spielspaß immer wieder positiv überraschen? Spiele wie zum Beispiele „Mauerbauer“, die nach außen hin eigentlich nicht viel hermachen, dazu über einen recht einfach gestrickten Spielplan verfügen und optisch jetzt nicht gerade ein Blickfang sind? Oft genug habe ich diese Erfahrung gemacht, weshalb ich mich erst einmal nicht vom vergleichsweise langweiligen Cover des Spiels habe abschrecken lassen und mal ganz unvoreingenommen abwartete, was mich hier erwartet. Schließlich zeigt die Erfahrung ja, dass solche Spiele später diejenigen sind, die am häufigsten auf den Tisch kommen. Und siehe da – auf den Instinkt ist manchmal Verlass. „Mauerbauer“ bietet nämlich keine aufgeblasene Optik, im Gegensatz dazu aber spielerisch einen sehr starken Gegenwert fürs Geld, an dem man noch lange Freude haben wird.
_Spielidee_
Vor ewiger Zeit stritten sich die berühmtesten Mauerbauer, wer wohl die schönste und perfekteste Stadt in ihren Landen erbauen könnte. Jeder von ihnen hatte eine genaue Vorstellung davon, wie seine Stadt aussehen sollte: prunkvolle Paläste, edle Bürgerhäuser, feste Mauern und massive Türme – dies alles wollten sie in ihrer Stadt verewigen.
In diesem Spiel soll der Wettstreit der Mauerbauer nun nachempfunden werden. Bis zu vier Spieler schlüpfen in die Rolle der Bauherren, bauen Mauern, Häuser, Paläste und Türme und beanspruchen einen Teil des Landes für sich und ihre Stadt. Doch jedes Mal, wenn die Mauern einer Stadt geschlossen werden, folgt eine Wertung, die jeden Spieler betrifft. Und erst jetzt entscheidet sich, wer beim Bau der Mauern und Städte am klügsten vorgegangen ist.
_Spielmaterial_
• jeweils 10 Türme in den Farben Grau, Weiß und Schwarz
• jeweils 12 Häuser und 3 Paläste in den Farben Gelb, Grün, Blau, Rosa und Rot
• 33 Holzmauern
• 2 Haus- und 1 Turmwürfel
• 4 Zählsteine
• 60 Gildekarten
• 1 Spielplan
Das Spielmaterial von „Mauerbauer“ ist in erster Linie zweckdienlich, dafür aber dennoch schön aufgemacht. Wie bei |Hans im Glück| eigentlich üblich, legt man besonders hohen Wert auf die Robustheit des Materials. So sind abgesehen von den Karten und dem Spielplan alle Spielmittel aus stabilem Holz. Schön dabei ist, dass man nicht einfach nur plumpe Steine gewählt, sondern den Materialien auch schöne, eigenständige Formen verpasst hat.
Der Spielplan indes ist recht schlicht gehalten und bestätigt meine Worte aus der Einleitung, dass „Mauerbauer“ rein äußerlich recht unauffällig ist. Aber das will ja noch nichts heißen …
_Spielvorbereitung_
Der Spielplan wird in die Mitte des Tisches ausgelegt. Darum werden sortiert Häuser, Paläste und Türme bereitgelegt, ebenso die drei im Spiel verwendeten Würfel und der durchgemischte Stapel mit den Gildekarten.
Vor jedem Spiel bekommt nun jeder Spieler sechs Karten auf die Hand. Nachdem der Zählstein der gewählten Farbe neben die Position 0 auf der Siegpunktleiste platziert wird, kann das Spiel beginnen.
_Spielziel_
Die Mauerbauer versuchen, nach ihrer Vorstellung Städte beliebiger Größe auf der Karte des Spielplans zu bauen. Dabei gilt es, die Gildekarten in der eigenen Handauslage zu beachten, denn sie bestimmen später, mit welchen Bauten man zu Punkten gelangt. Jedes Mal, wenn eine Stadt durch den Bau einer Mauer geschlossen wird, kommt es zu einer Wertung, in der man entweder eine oder zwei Karten aus der Hand ablegen und dadurch punkten darf. Allerdings gilt es zu beachten, dass die hinten liegenden Spieler nach jeder Wertung beliebig viele Karten ihrer Handauslage gegen neue tauschen dürfen und sich so einen gehörigen Vorteil verschaffen können. Es gilt zu taktieren, wann man welche Stadt schließt, und welche Gildekarten man danach ablegt. Wer auf diese Weise zum Schluss die meisten Siegpunkt erreicht hat, ist der erfolgreichste Mauerbauer und damit der Sieger des Spiels.
_Ein Spielzug_
In jeder Runde stehen den Mauerbauern bis zu vier Spielzüge zur Verfügung, die in folgender Reihenfolge auch durchgeführt werden müssen, falls sie in dieser Runde möglich sind.
Als Erstes muss der Spieler eine Mauer aus dem Vorrat nehmen und auf eine beliebige Mauerlinie auf dem Spielfeld setzen. Dabei muss er keine weiteren Vorgaben beachten; man muss also nicht direkt an eine andere Mauer angrenzen. Auch die Abgrenzung von Stadt, Graslandschaft und Wasser muss gemauert werden!
Anschließend würfelt er mit allen drei Würfeln. Auf dem Turmwürfel steht nun entweder ein graues, weißes oder schwarzes Turmsymbol. Dem Ergebnis entsprechend muss nun ein Turm in solcher Farbe an die gerade gesetzte Mauer platziert werden. Sind beide Seiten der Mauer besetzt, kann der Turmbau nicht stattfinden. Ist indes die Farbe des gewürfelten Turmes nicht mehr vorrätig, darf der Spieler einen andersfarbigen Turm verwenden.
Das Ergebnis der beiden Häuser-Würfel entscheidet über das Wachstum der Stadt. Hier ist entweder ein Haus in einer der fünf Spielfarben abgebildet oder aber ein Fragezeichen (freie Auswahl). Der Spieler nimmt nun Häuser der beiden Farben zur Hand und platziert an beiden Seiten der Mauer nach eigener Wahl jeweils eines der Häuser.
Schließt der Spieler mit seiner Mauer eine Stadt – dies ist der Fall, wenn die abgelegten Mauerstücke eine Landschaft umschließen –, kommt es zu einer Wertung. Jetzt muss sich der Spieler entscheiden, welche seiner Gildekarten er verwendet. Er muss dabei zwischen Karten, die nur die aktuell gebaute Stadt betreffen, und solchen, die sich auf Gebiete beziehen, die noch nicht erschlossen sind, entscheiden und versuchen, das bestmögliche Gesamtpunkteergebnis zu erzielen. Anschließend legt er die gespielten Karten auf den Ablagestapel und nimmt ersatzweise eine neue Karte – dies übrigens auch, wenn man zwei Karten ausgespielt hat. Entsprechend dem Punkteresultat setzt man nun seinen Zählstein auf der Siegpunktleiste weiter. Wer sich einer Wertung mangels guter Gildekarten entziehen will, darf auch eine Karte von der Hand auf den Ablagestapel legen und zwei neue vom Nachziehstapel ziehen. Allerdings bekommt er dann in dieser Runde keine Punkte.
Als Letzter darf nun der Spieler, der auf der Siegpunktleiste am weitesten hinten steht, beliebig viele Handkarten gegen neue Gildekarten vom Nachziehstapel nehmen. Die Würfel werden daraufhin weitergegeben, und der nächste Spieler beginnt auf die gleiche Art und Weise seinen Zug.
_Sonderregeln_
Spielautor Leo Colovini hat sich neben dem Basisregelwerk auch noch einige Dinge ausgedacht, welche die Spieltiefe noch erweitern und das taktische Vorgehen insgesamt noch weiter erschweren. Vier Regeln sind dabei besonders zu beachten
|1. Städte erweitern|
Sobald ein Spieler mit dem Bau einer Mauer eine Stadt abgeschlossen hat, besteht die Möglichkeit, diese zu erweitern. Sollte nämlich angrenzend an eine der Stadtmauern eine weitere, geschlossene Stadt aufgestellt sein, darf er nun die Abgrenzungsmauern zwischen diesen beiden Städten sowie die dazwischen befindlichen Türme entfernen und die Städte verbinden. Dies hat auch Auswirkungen auf die Wertung, denn es wird im Anschluss die gesamte Stadt und nicht bloß die zusätzlich erschlossene gewertet. Man darf allerdings immer nur eine Stadt mit der just erbauten verbinden, wobei dieser Schritt freiwillig und jedes Mal von Neuem abzuwägen ist.
|2. Es gibt keine Stadtviertel|
Sobald eine Stadt von Mauern umgeben ist, kann sie nur noch erweitert, nicht aber mehr separat eingeteilt werden. Das heißt für den Spieler konkret, dass er in eine fertige Stadt keine weiteren Mauern mehr setzen darf.
|3. Paläste setzen|
Wenn eine Stadt von einer Mauer umgeben und somit fertig ist, werden Häuser in gleiche Farbe, und zwar jeweils zwei, zu einem Palast zusammengefügt. Die Häuser gehen zurück in die Auslage.
|4. Der Minuspunkt für Hektiker|
Die einzelnen Spielzüge in „Mauerbauer“ sind fest vorgegeben. Sollte sich indes trotzdem mal jemand nicht daran halten und noch vor dem Mauerbau würfeln, bekommt er zur Strafe einen Punkt auf der Siegpunktleiste abgezogen. Und man mag es kaum glauben: Dies passiert häufiger …
_Spielende_
Es gibt gleich mehrere Möglichkeiten, das Spiel zu beenden. Alle jedoch haben sie gemeinsam, dass sie einem Mangel an weiteren Baumaterialien folgen. Sobald nämlich kein Turm oder Haus oder Tempel oder keine Mauer mehr in der Auslage sind – also nach maximal 33 Spielrunden – ist das Spiel zu Ende. Wenn beim letzten Spielzug noch eine Stadt erschlossen wurde, darf diese noch gewertet werden. Anschließend werden die Punkte auf der Siegpunktleiste verglichen und der Gewinner gekürt.
_Meine Meinung_
Ganz ehrlich, ich hatte mir nach den ersten (optischen) Eindrücken von „Mauerbauer“ nicht viel erhofft, und schon gar nicht das spannende, taktische Strategiespiel, das es letztendlich ist. Nach außen hin mag die Neuheit aus dem |Hans im Glück|-Verlag zwar recht unspektakulär und schlicht wirken, doch innen drin, sprich im Spiel selber verbirgt sich ein sehr fein ausgeklügeltes Spielprinzip, das zwar zu einem gewissen Teil auch von Glück bestimmt ist (so zum Beispiel beim Nachziehen der Gildekarten und natürlich beim Würfeln), jedoch weitestgehend auf taktischem Geschickt und weitsichtiger Planung aufbaut.
Schön ist auch, dass man zu keinem Zeitpunkt des Spiels vorhersehen kann, wer am Ende der Sieger sein wird. Eine Führung kann bereits nach einer oder zwei schnellen Wertungen wieder gänzlich verspielt sein, ein Rückstand dementsprechend flott wieder aufgeholt werden.
Hinzu kommt, dass sich durch die Gildekarten bei der Planung weiterer Spielzüge unheimlich viele Möglichkeiten auftun. Einzig und alleine die Städte sind begrenzt, und zwar durch Mauern, sonst aber bei diesem herrlichen, leicht erlernbaren Familien- und Strategiespiel gar nichts, und schon gar nicht der Spielspaß.
Ich bin alles in allem daher sehr überrascht von der Spieltiefe und der daraus resultierenden Langzeitmotivation von „Mauerbauer“. Die einzelnen Partien sind knapp und spannend und werden meistens erst mit der letzten Wertung entschieden, so dass wirklich zu keinem Zeitpunkt Langeweile aufkommt. Garantiert wird der langfristige Spaß am Spiel schließlich durch das stabile, robuste und dennoch schön aufgemachte Spielmaterial, dem i-Tüpfelchen auf einem Spiel, das trotz (und gerade wegen) seiner schlichten Mittel die zuvor gesetzten Erwartungen um ein Vielfaches übertrifft. Wirklich toll, was sich der Herr Colovini hier ausgedacht hat!
http://www.schmidt-spiele.de/