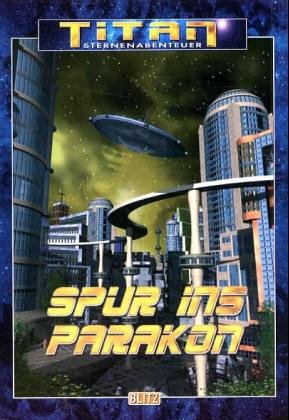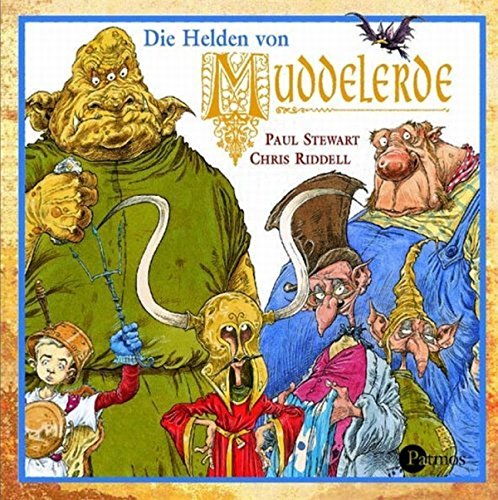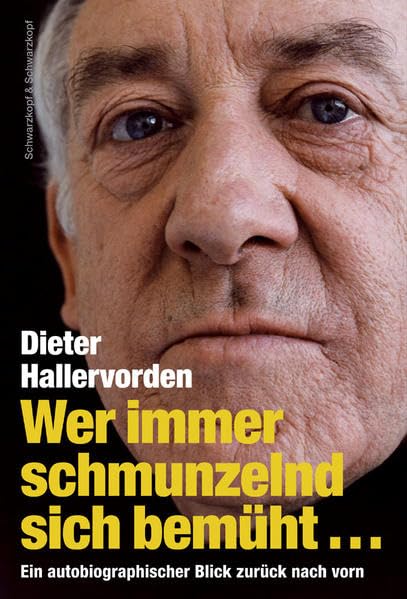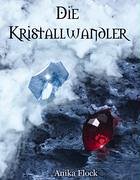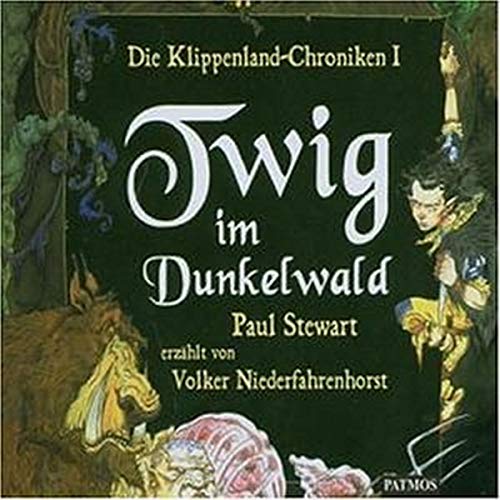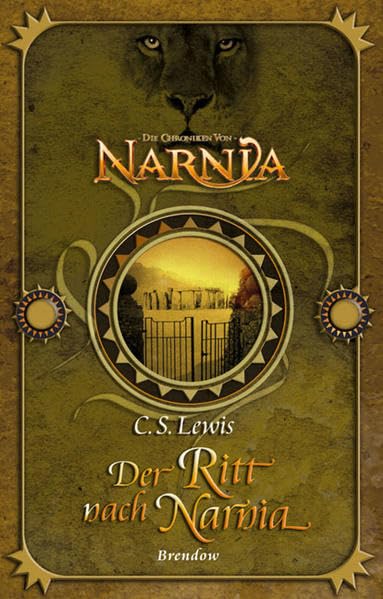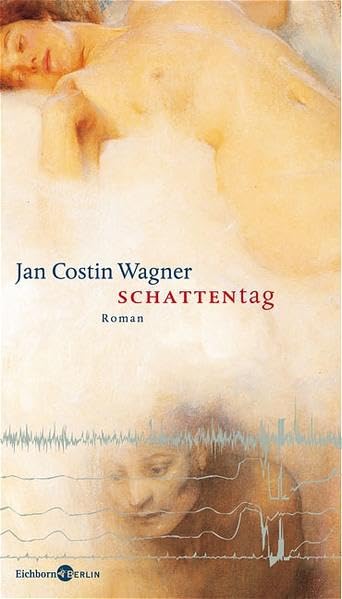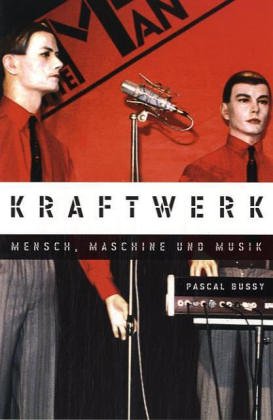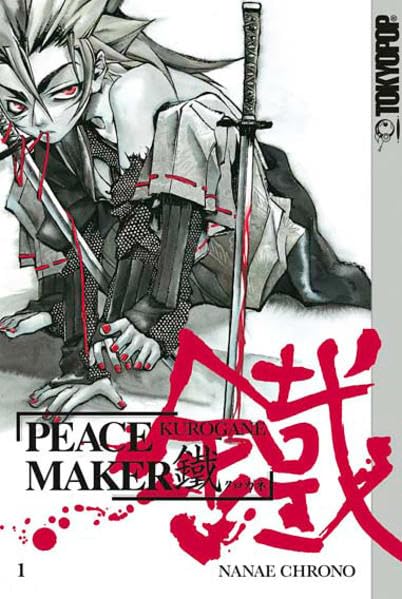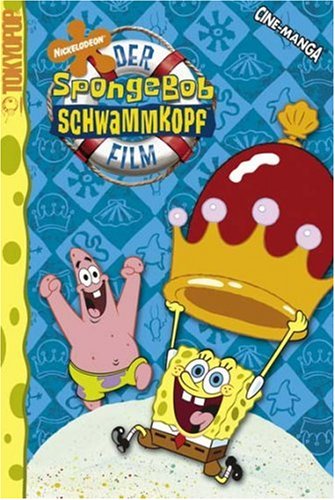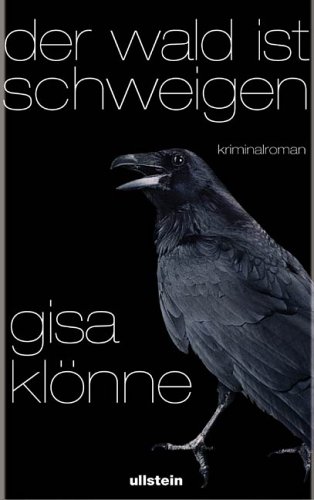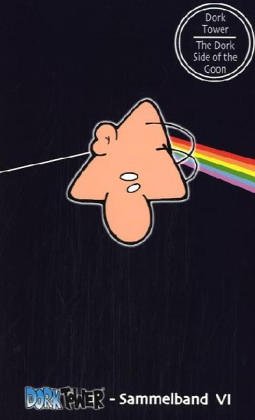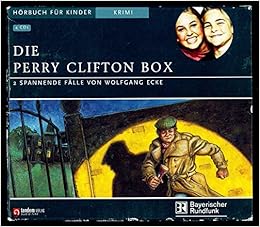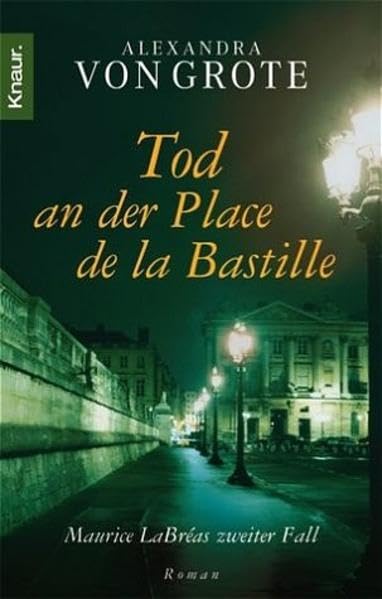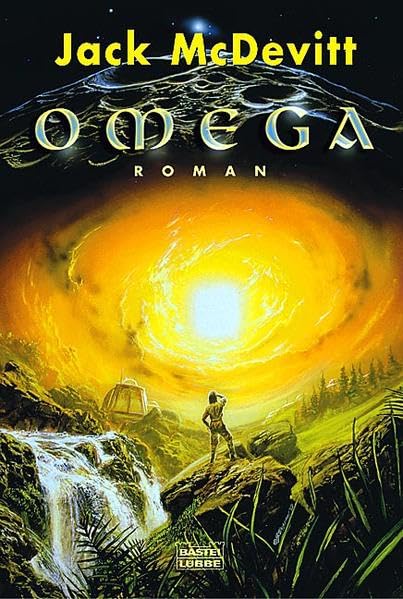Mit dem 18. Band der „Titan“-Reihe starten die beiden Autorinnen Margret Schwekendiek und Antja Ippensen mit einem neuen Zyklus, dem so genannten Parakon-Zyklus. Diese Idee ist hauptsächlich deswegen entstanden, weil einige Leser den Wunsch geäußert hatten, dass die damals liegen gebliebenen Geheimnisse der „Promet“-Reihe irgendwann weiterverfolgt werden sollten, und deshalb geht man mit diesem hier vorliegenden Taschenbuch auch wieder komplett zurück zu den Wurzeln der Serie.
Dabei war es dem Herausgeber ein Anliegen, sowohl klassische Figuren in die Geschichte einzuflechten, gleichzeitig aber auch die von Thomas Ziegler entwickelte Welt nicht aus dem Auge zu verlieren.
In Band 18, „Spur ins Parakon“ geht es in erster Linie um Ereignisse, die in der ersten Hälfte von „Promet Classics 6“ eine Rolle spielten. Mehr dazu in der folgenden Inhaltsangabe:
_Story_
Vor 17 Jahren stieß die „Promet II“ auf ihrem Jungfernflug auf den Planeten Akat/Okan. Auf diesem Planeten entdeckte die Crew die größte bekannte Stadt in der gesamten Galaxis, jedoch völlig leblos und inaktiv. Dennoch werden genau hier, im Zentrum eines scheinbar nicht mehr bewohnten Planeten, stellare Impulse registriert.
Die Spur dieser Impulse führt zu einem riesigen Wasserplaneten, auf dem ebenfalls kein Leben entdeckt wird. Als sich das Schiff „Tereschkova“ jedoch auf den Weg zu diesem Planeten macht, um die Impulse aufzuspüren, wird es vom Gedankenstrom der dort lebenden Goldschater mit einem Schlag vernichtet. Für die beiden stärksten und stabilsten Schiffe der CRC herrscht von da an Alarmbereitschaft. Beim Versuch, nach Überlebenden der Raumschiffexplosion zu suchen, entdecken sie ebenfalls diesen Planeten, werden aber Zeugen einer weiteren, noch viel mächtigeren Explosion …
An anderer Stelle herrscht größte Aufregung: Luisa di Cantoras erwartet in der Asteroidenwerft die Ankunft ihres neuen Vorgesetzten Amos Carter. Doch was genau macht sie so nervös? Und warum bricht sie kurz vor seiner Ankunft völlig zusammen? Carter ist ebenfalls nicht frei von Sorge; Insider haben herausbekommen, dass ein Anschlag auf ihn geplant ist, jedoch sind keine genauen Details bekannt. Beim Probelauf eines neuen Antriebs kommt es dann aber doch zur befürchteten Katastrophe …
Für mich war dieser Band der Einstieg in die Serie, und auch wenn ich bislang noch keine Informationan zu „Titan“ hatte und auch die „Promet“-Reihe nur vom Hörensagen her kenne, ist es mir außerordentlich leicht gefallen, in die Geschichte hineinzukommen. Die beiden Autorinnen haben einen sehr einfachen, leicht verständlichen Stil und überfallen den Leser auch nicht mit überzogenen, für die Handlung völlig unwichtigen Details. Stattdessen stellen sie die beiden verschiedenen Handlungsstränge sofort in den Mittelpunkt und beginnen direkt mitten im Geschehen. Keine lange Einleitung ist hierfür nötig, schließlich benutzen Schwekendiek und Ippensen im Laufe des Buches immer wieder die Gelegenheit, um genauere (für die Handlung relevante) Rückblicke einzuwerfen, die jede Unstimmigkeit im Keim ersticken. So erfährt man nach und nach mehr über die Entwicklung auf dem rätselhaften Wasserplaneten, blickt Schritt für Schritt hinter das Mysterium um die stellaren Impulse und kann auch den Gedankengängen der sehr gut dargestellten Hauptfiguren stets sehr leicht folgen.
Wegen all dieser Gründe werden jetzt sicherlich viele mit Parallelen zur wohl berühmtesten Weltraumserie „Perry Rhodan“ kommen, aber diese sind auch gerne willkommen, schließlich handelt es sich auch hier um eine nicht zu komplexe, auf die einzelnen Veröffentlichungen aufbauende Space-Opera, bei der ich bereits nach diesem ersten Buch das sehr gute Gefühl habe, dass mir „Titan“ noch ziemlich lange Freude bereiten wird. Der Einsteig mit „Spur ins Parakon“ hat definitiv sehr gut gemundet, und die Spannung ist mit dem Ende des Buches noch einmal richtig angewachsen. Die besten Voraussetzungen also für eine starke Fortsetzung und für mein weiteres Interesse an dieser vielversprechenden, wenn auch nicht unbedingt superspektakulären Reihe. Daher wage ich zum Ende dieser Rezension auch das Fazit, dass jeder, der auf „Perry Rhodan“ steht, „Titan“ ebenfalls mögen wird. Auf ins Parakon!
http://www.blitz-verlag.de/