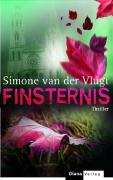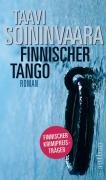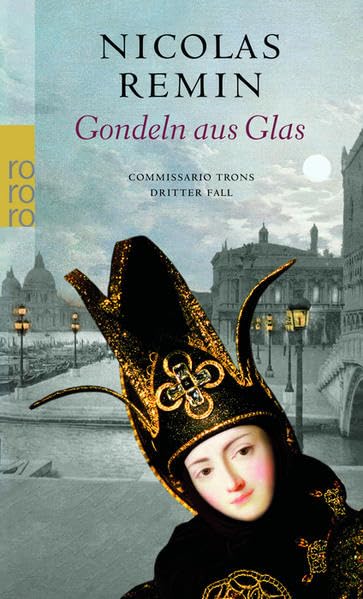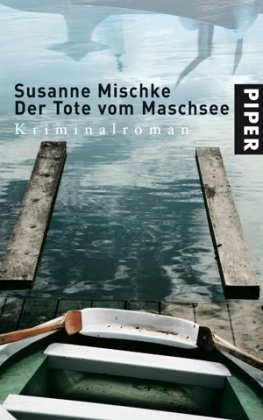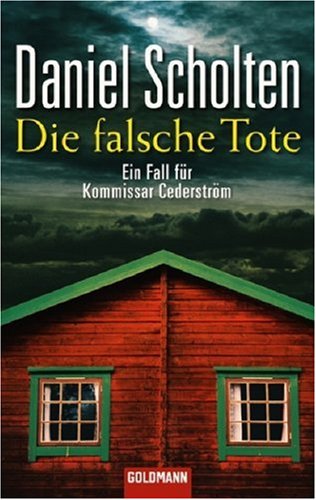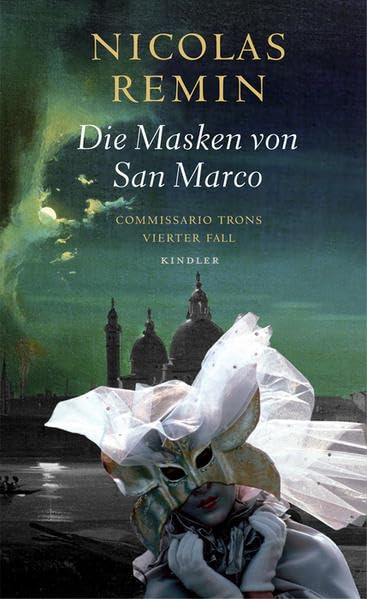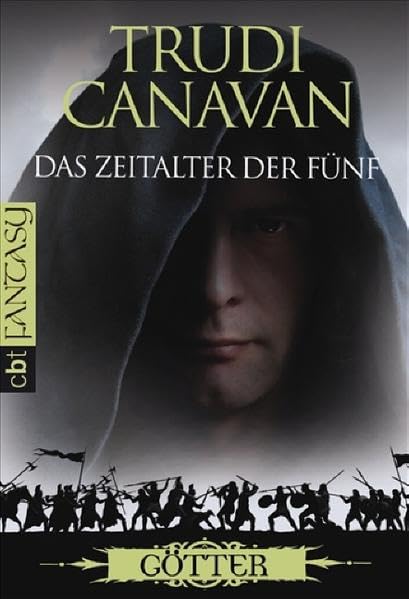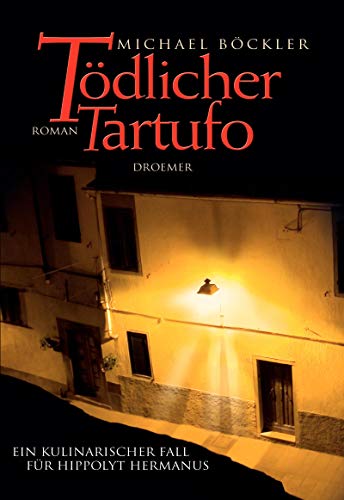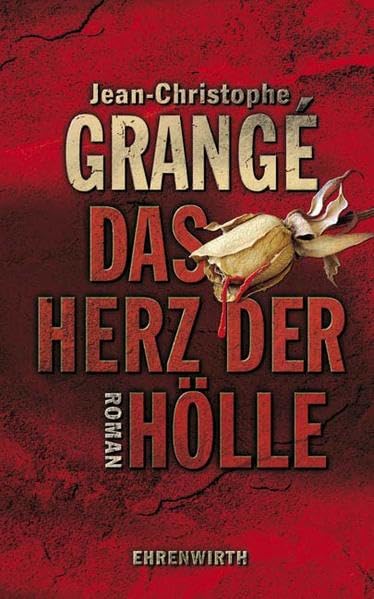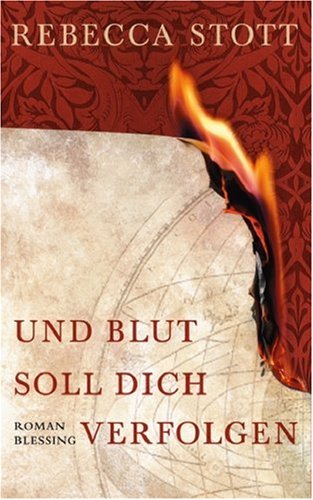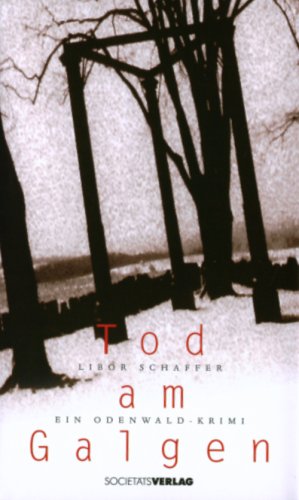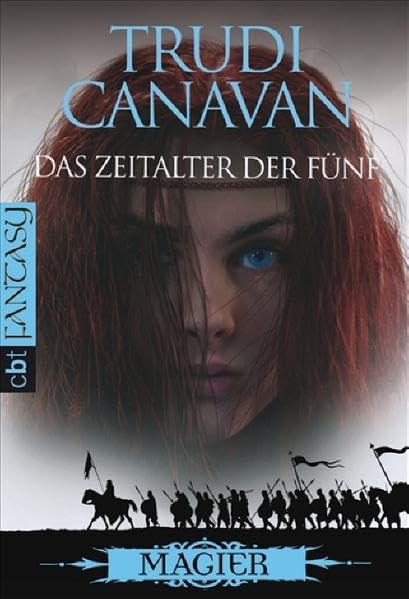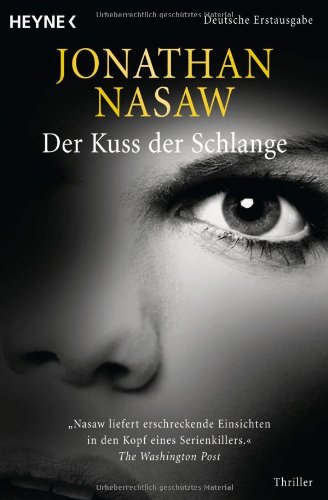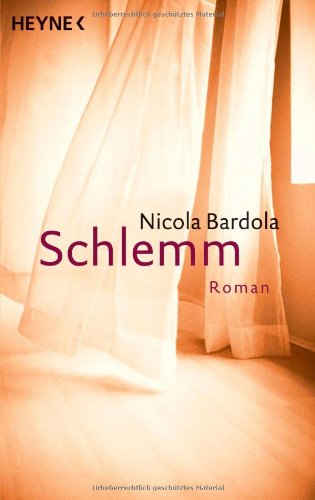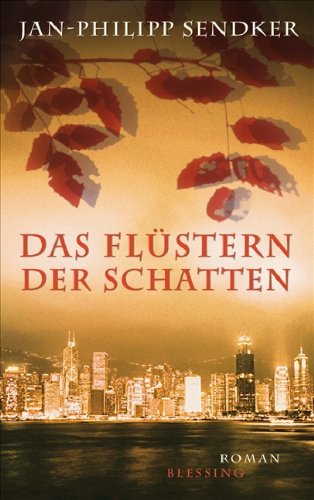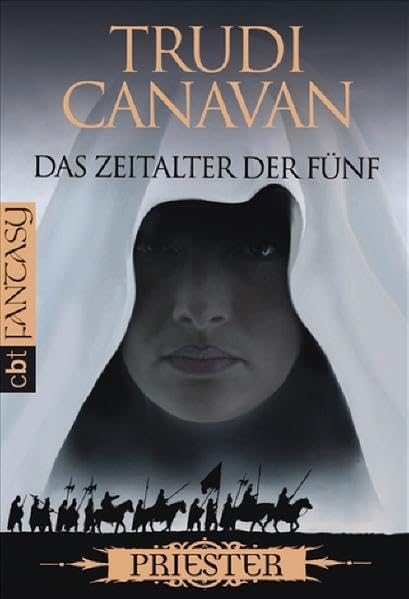„Finsternis“ ist der inzwischen dritte Thriller der niederländischen Senkrechtstarterin Simone van der Vlugt, die mit „Klassentreffen“ und „Schattenschwester“ zwei packende Psychothriller vorgelegt hat. Ähnelte „Schattenschwester“ dem Debütwerk noch auffallend stark, wagt sich van der Vlugt mit dem vorliegenden Thriller nun an eine ganz andere Thematik heran. Ob ihr dieser Ausflug in die Verschwörungsthrillerecke allerdings gelungen ist, bleibt nachzuprüfen …
_Howard Carters Erben_
Durch Zufall macht der niederländische Archäologe Nicolaas Bogaards in Karnak eine unglaubliche Entdeckung. Er findet einen geheimen Durchgang und eine geheime Kammer, in die er alleine eindringt, um sich diese Eroberung von niemandem streitig machen zu lassen. Anschließend verschwindet er allerdings spurlos.
In einer Kneipe lernt die Maklerin Birgit einen gutaussehenden Kerl kennen – als Jef stellt er sich vor und rettet sie beherzt aus einer unangenehmen Situation. Schnell sind die beiden sich einig und vergnügen sich in Birgits Wohnung. Die beiden verbringen eine heiße Nacht und einen wunderschönen Tag, doch danach verschwindet auch Jef ohne eine Nachricht. Birgit kommt die Idee, ihn in einem der leerstehenden Häuser zu suchen, die sie vermitteln will und die sie Jef gezeigt hatte. Und tatsächlich spürt sie ihn auf. Kurz nach ihr taucht allerdings ein mysteriöser Fremder auf, der bewaffnet ist und offensichtlich Böses im Schilde führt. Die beiden können dem Fremden gerade noch einmal entfliehen. Als Birgit Jef zur Rede stellt, erzählt er ihr, dass er auf der Suche nach seinem Vater ist, dem bekannten Archäologen Nicolaas Bogaards, den er nicht mehr erreichen kann.
Gemeinsam fliegen die beiden nach Ägypten, dicht gefolgt vom bewaffneten Fremden, der immer noch nach ihrem Leben trachtet. Auf der Ausgrabung lernen die beiden Nicolaas‘ Vertraute und gute Freundin Frances kennen, die den beiden die geheime Kammer zeigt, in der sich offensichtlich die Bundeslade befunden hat. Damit ist Bogaards Entdeckung eine wirklich großartige. Doch kurz nach dem gefährlichen Ausflug in die geheime Kammer wird Frances ermordet und Birgit und Jef befinden sich wieder auf der Flucht. Dieses Mal verschlägt es sie nach Frankreich, wo Jef einen guten Freund seines Vaters sucht, der vielleicht ein wenig Licht in die Sache bringen kann. In Frankreich jedoch treffen die beiden nicht nur ihren bekannten Widersacher wieder, sondern stehen plötzlich noch weiteren Menschen gegenüber, die nach ihrem Leben trachten…
_Auf Dan Browns Spuren_
Nach ihren beiden doch sehr ähnlichen (wenn auch sehr spannenden) Psychothrillern wagt sich Simone van der Vlugt an etwas ganz anderes heran. Ich hatte zwar wieder einen guten Psychothriller erwartet, fand mich dann aber plötzlich in einem Verschwörungsthriller wieder, der sich recht schnell um die Diskussion rund um die Bundeslade dreht. Löblich natürlich, dass die Autorin ein ganz anderes Genre erobern möchte, doch leider geht hier viel schief und sie orientiert sich in vielen Dingen zu sehr an Dan Brown…
Zunächst lernen wir Birgit und Jef kennen, die schon in der ersten Nacht übereinander herfallen und anschließend das direkte Pendant zu Robert Langdon und Vittoria Vettra bzw. Sophie Neveu darstellen. Die beiden reisen von einem exotischen Ort zum nächsten und kommen dabei einem unglaublichen Geheimnis immer näher auf die Spur. Der Schreibstil der Autorin ist dabei ähnlich kurz angebunden wie bei Dan Brown, obwohl sie zugegebenermaßen mit ihrer Story keine solche Faszination entwickelt, wie Brown es bislang meist geschafft hat. Zu ausgeluscht fand ich auch die Geschichte rund um die Bundeslade, die in Indiana Jones zudem deutlich interessanter und vor allem unterhaltsamer dargestellt wird…
Aber auch im Folgenden bedient sich van der Vlugt weiterer Brownscher Elemente, so präsentiert sie uns zum Ende natürlich den Bösewicht, der das Geheimnis um die Bundeslade wie seinen Augapfel hütet, doch leider identifiziert man ihn sehr schnell, da man ja bereits weiß, dass in einem solchen Buch der beste Freund am Ende zum Feind und zum Strippenzieher hinter all dem Schrecken wird. So bleibt natürlich das Überraschungsmoment völlig aus und weicht eher einem Gähnen ganz nach dem Motto „hab ich es doch geahnt“.
Und natürlich verstrickt die Autorin sich ganz wie ihr männliches Vorbild in abstrusesten physikalischen Verstrickungen und Theorien. So handelt es sich bei der Bundeslade um die schrecklichste Waffe schlechthin, denn die Kiste ist mit einem Pulver gefüllt, das High-Spin-Zustände erzeugen kann. Diese High-Spin-Kerne sorgen dafür, dass sich alle Elektronen mit Höchstgeschwindigkeit synchron bewegen und zu einem Pulver zerfallen, das supraleitende Eigenschaften hat. Dieser Supraleiter kann dann Energie über weite Strecken übertragen und zwar ohne einen elektrischen Leiter. Verbindet man nun zwei Supraleiter, entsteht ein Magnetfeld. Hier will van der Vlugt nicht weiter vertiefen, sondern wirft nur Begriffe wie Quantenkohärenz und das Meißner-Feld in den Raum, in letzterem kann man unbegrenzt Energie speichern. Aktiviert wird der Supraleiter mittels Magnetfeld, in dem dann Energie wie in einem Perpetuum mobile in fortwährender Bewegung begriffen ist. Aufgrund dieser erstaunlichen Eigenschaften ist nun also unendlich viel Energie in der Bundeslade gespeichert, die eine unvorstellbar große Spannung aufbaut, die sich in dem Moment entlädt, wenn sich jemand der Bundeslade zu sehr nähert. Und daher handelt es sich bei der Bundeslade um die tödlichste aller Waffen. So weit, so „interessant“. Leider vergisst die Autorin in ihrer Danksagung zu erwähnen, von welchem Berater sie diese spannende Theorie mitgeteilt bekommen hat…
Inhaltlich greift Simone van der Vlugt meiner Meinung nach folglich total daneben. Sie kupfert nicht nur handwerklich schlecht vieles schon Dagewesene ab, sondern übertreibt es mit ihren Theorien dann leider, wie Dan Brown es vor ihr mit seinen Superakkus und der Antimaterie ebenfalls getan hat.
_Klischees!_
Auch figurentechnisch begnügt Simone van der Vlugt sich mit lieblosen Schablonen. Sie bringt ein junges, gutaussehendes Pärchen aufs Tapet, das dann todesmutig durch die halbe Weltgeschichte reist, immer dicht verfolgt von einem bewaffneten Killer. Beide Hauptfiguren haben für mich im Laufe der Geschichte keinerlei Format erhalten. Natürlich sind beide mit einer wahrlich tragischen Biografie ausgestattet, so ist Birgit nur gezeugt worden, um ihre Leukämie-kranke Schwester zu retten. Ihre ganze Kindheit war Birgit daher nur Spenderin für ihre Schwester, hat ihr Knochenmark und am Ende auch eine Niere gespendet, aber auch Jef steht mit seiner verkorksten Familiengeschichte dem Ganzen in kaum etwas nach. Derlei tragische Geschichten drücken mir wiederum zu sehr auf die Tränendrüse und wirken meiner Meinung nach auch völlig überzogen, sodass ich mich in keiner Situation mit Birgit identifizieren konnte. Hinzu kommt, dass man von vornherein ja weiß, dass diesen beiden blassen Charakteren ohnehin nichts passieren wird und daher auch kaum Spannung aufgebaut wird.
_Netter Versuch, allerdings völlig gescheitert_
Wie gesagt, ich rechne es Simone van der Vlugt hoch an, dass sie mal etwas ganz Neues versucht hat, nachdem ihr zweiter Thriller dem ersten doch zu sehr ähnelte und sie in diesem Genre offensichtlich keinerlei neue Ideen mehr zu Papier gebracht hätte. Was sie uns hier präsentiert, grenzt allerdings schon fast an eine Unverschämtheit. Die Grundstory ist dermaßen ausgelutscht, dass sie einen kaum packen kann, sondern nur noch zum Gähnen animiert und wenn van der Vlugt uns dann am Ende ihre kuriosen Theorien auftischt, ist man kurz davor, das Buch an die Seite zu legen. Im übrigen wirkt das ganze Buch ziemlich ideenlos, da die Parallelen zu anderen Schriftstellern und Büchern so offensichtlich sind, dass der Wiedererkennungsfaktor viel zu hoch ist. Bei „Finsternis“ ist der Name wirklich Programm, finster ist dieses Buch wie es finsterer kaum sein kann …
http://www.diana-verlag.de
_Simone van der Vlugt auf |Buchwurm.info|:_
[„Schattenschwester“ 3625
[„Klassentreffen“ 3850