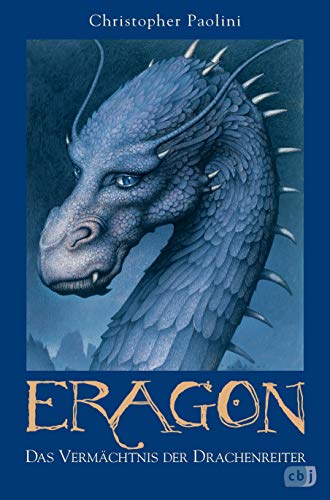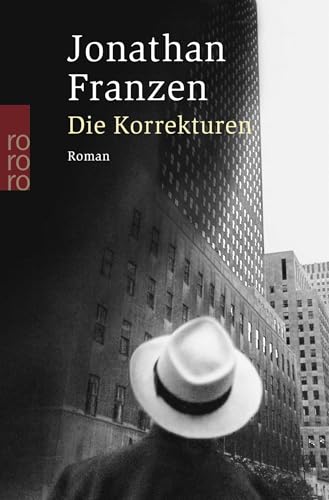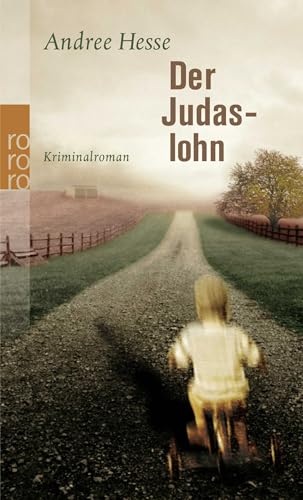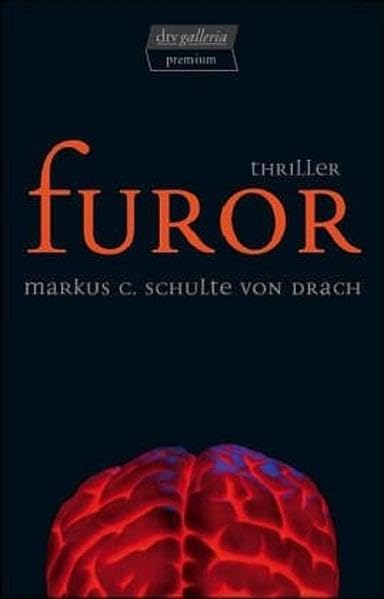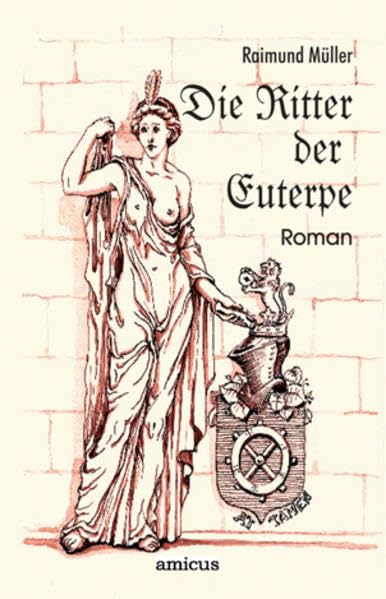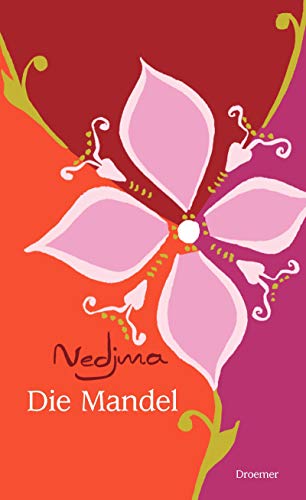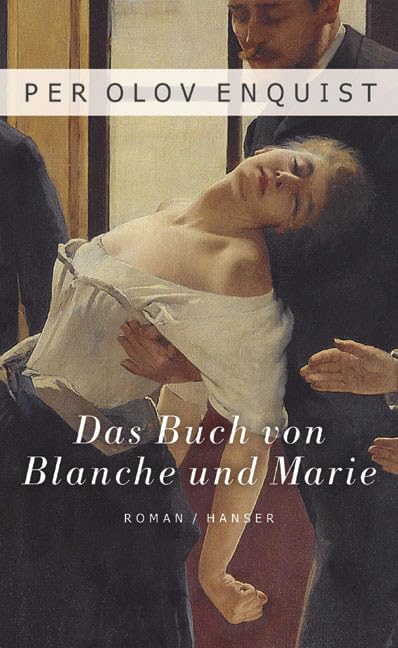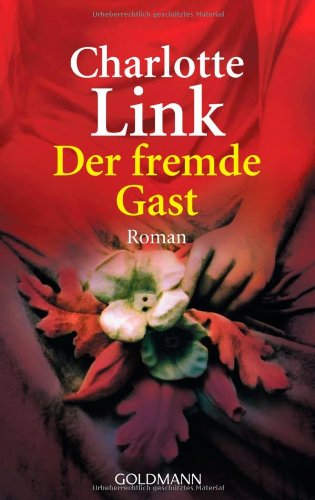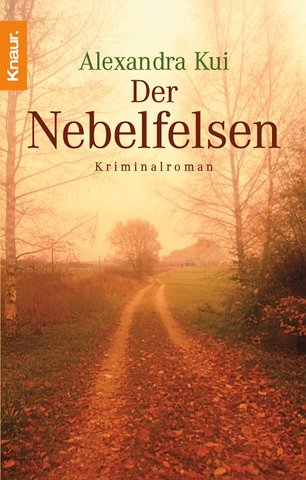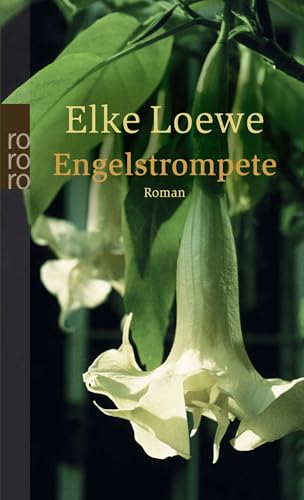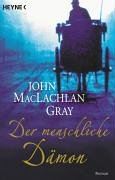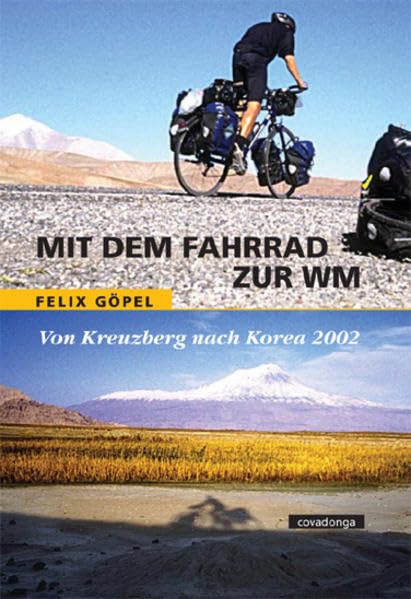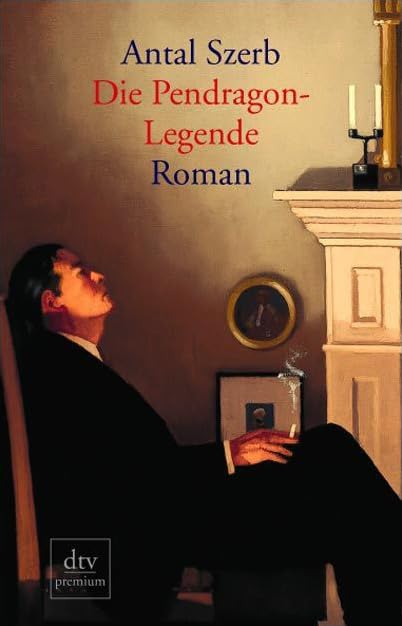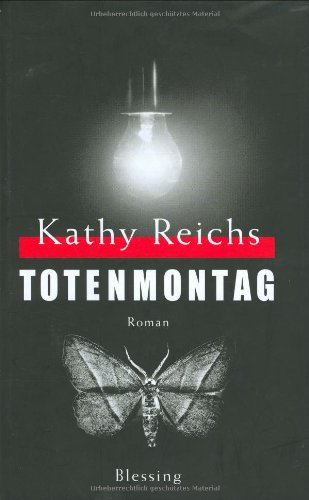|“Ich mag Menschen nicht, die nicht so sind wie andere Menschen. Schon die anderen Menschen sind widerlich genug. Und erst noch die, die nicht so sind.“|
_Honeymoon_
Schon auf ihrer Hochzeitsreise tun sich die ersten Abgründe zwischen Mihály und Erzsi auf: In einer Nacht in Venedig verläuft Mihály sich so lange in den Gässchen der Lagunenstadt, dass er erst morgens zu seiner frisch angetrauten Frau zurückkehren kann, und in Ravenna schließlich wird Mihály von seiner Vergangenheit eingeholt. Die byzantinischen Mosaiken rufen nämlich Erinnerungen an seine Jugendfreunde Tamás und Éva Ulpius wach, die ihn sehr verwirren. Kurz darauf taucht János Szepetneki auf, der ebenfalls zum früheren Freundeskreis gehört hat.
Nach dem Zusammentreffen mit János erzählt Mihály seiner Frau einiges über seine ehemaligen Freunde aus dem Ulpius-Haus, zu denen neben Tamás, Éva und János auch Ervin gehört hat, der damals vom Judentum zum Katholizismus übergetreten war. János glaubt nun, dass Ervin als Mönch in Umbrien oder der Toskana lebt, Tamás dagegen hatte sich damals selbst umgebracht, bevor er richtig erwachsen werden konnte.
Nach einem Brief von Erzsis erstem Ehemann Zoltán, in welchem dieser seinem Nachfolger Tipps für das Zusammenleben mit Erzsi gibt, fürchtet Mihály, seine Frau zu verlieren, da er ihr nicht den Luxus und die Sicherheit geben kann, die sie von Zoltán gewöhnt ist. Auf der Zugfahrt nach Rom beschließt Mihály, während eines Zwischenstopps einen Kaffee zu trinken. Als er den Zug weiterfahren sieht, springt er noch schnell auf, stellt allerdings zu spät fest, dass er sich im falschen Zug befindet. Dieser bringt ihn nach Perugia, wo Mihály eine ganz andere Reise antreten wird – eine, die ihn in seine eigene Vergangenheit und zu sich selbst führen wird …
_Eine Reise ins Ich_
„Reise im Mondlicht“ überzeugt in erster Linie, weil dieses Buch von ganz alltäglichen Dingen berichtet, von Selbstzweifeln eines fehlerhaften Helden, der nicht erwachsen werden mag und immer noch seinen Jugendfreunden und -erinnerungen hinterhertrauert. Antal Szerb erzählt in wunderbaren Worten eine einfache Geschichte, die großartig zu unterhalten weiß, weil man sich auf den Seiten wiederfinden kann und Szerb die Sorgen des Helden so darzustellen weiß, dass man sich mit ihnen identifizieren und sie miterleiden kann.
Schon auf der ersten Seite wird der Abgrund deutlich, der sich unweigerlich zwischen Mihály und Erzsi auftun muss, denn Mihály ist noch gar nicht reif, um die Verantwortung für seine Ehefrau und ihre Lebensgemeinschaft zu übernehmen. Von Kleinigkeiten und winzigen Gedanken lässt er sich ablenken; so benötigt es nur die kleinen Gässchen Venedigs, um ihn eine ganze Nacht lang während der Flitterwochen von Erzsi fernzuhalten. Schon Zoltáns Brief weckt solch starke Zweifel in Mihály, dass er praktisch das Ende seiner Ehe vorhersieht. Eine starke Bindung kann der Leser zwischen den beiden kaum erkennen, auch wenn Erzsi an der Ehe festhalten möchte, selbst nachdem Mihály nicht gedenkt, ihr nach Rom nachzureisen und die Zeit und Gelegenheit lieber nutzt, um eine Entdeckungsreise auf eigene Faust zu unternehmen.
Szerb erzählt auf großartige Weise eine Geschichte, die man einfach lieb gewinnen muss. Feine Ironie und gute Beobachtungsgabe zeichnen diesen Roman ebenso aus wie elegante Sprache und kuriose Begebenheiten, die die Erzählung scheinbar zufällig in eine bestimmte Richtung lenken. So lässt Szerb immer wieder Kleinigkeiten passieren, die dem Geschehen eine ganz neue Wendung geben und Mihály manchmal wie eine Schachfigur wirken lassen, die in einem größeren Spiel eingesetzt wird, welches andere Mächte für ihn entscheiden werden. Die Situationen entlocken uns dabei häufig ein Lächeln, wenn Mihály beispielsweise schusselig auf den falschen Zug aufspringt, sich aber schnell damit anfreundet, alleine Perugia zu erkunden und seine Ehe erst einmal auf Eis zu legen.
Derlei Dinge mögen einem vielleicht unwahrscheinlich erscheinen, sicherlich sind sie etwas überspitzt, aber hegen wir ähnliche Gedanken nicht zwischendurch alle einmal? Ist der Gedanke daran, sein altes Leben hinter sich zu lassen und neu zu beginnen, nicht völlig normal? Mihály lebt ihn schließlich für uns aus, weil er anders nicht sein Glück finden kann, und wir befinden uns in der glücklichen Lage, ihn auf dieser Reise begleiten zu dürfen. So tauchen wir in eine Welt ein, in der vieles möglich wird, und wir müssen sehen, welche Konsequenzen das Abwenden vom gewohnten Leben mit sich bringen kann. Auf diese Weise können wir von Mihály und seinen Fehlern vielleicht sogar noch lernen.
Aber dieses Buch hat noch mehr zu bieten, denn die gesamte Handlung spielt sich an traumhaft schönen Schauplätzen zunächst in Italien und später auch in Paris ab, die ihren ganz eigenen Reiz haben und ebenfalls zum Lesegenuss beitragen. Hierbei und auch bei den nostalgisch gefärbten Jugenderinnerungen Mihálys umschifft Szerb jedoch gekonnt jegliche kitschigen Klischees, die bei derlei Ausführungen so leicht auftauchen könnten.
_Alltagshelden_
In dieser Geschichte liegt einiges im Argen; jeder der Protagonisten offenbart seine guten wie auch schlechten Eigenschaften, Gut und Böse werden jedoch nie schwarz-weiß gezeichnet, die Grenzen dazwischen bleiben verwaschen. Im Zentrum steht natürlich Mihály, den wir auf seiner Reise begleiten. Auf den ersten Blick scheint er ziellos umherzuirren und lediglich vor seinem Leben und seiner Ehe zu fliehen, doch unweigerlich läuft alles auf eine Begegnung mit der eigenen Vergangenheit hinaus. So erahnt Mihály bald Ervins Aufenthaltsort und trifft ihn tatsächlich wieder. Die beiden unterhalten sich und Mihály muss erkennen, wie sehr sein alter Freund sich durch den Klosteralltag verändert hat, dennoch scheint er mit sich im Reinen zu liegen, wovon Mihály weit entfernt ist. Ervin kann seinem Freund noch einen guten Rat auf den Weg geben, doch wird es bei dieser einen Begegnung der beiden Jugendfreunde bleiben.
Mihály begibt sich nach Rom, um dort dem Schicksal seinen Lauf zu lassen. Immer hofft er auf ein zufälliges Zusammentreffen mit Éva, das selbstverständlich eintreten wird. Während seiner Wartezeit muss Mihály erkennen, wie wenig er doch seine eigene Vergangenheit verarbeitet hat, die er für abgeschlossen hielt. Unser Romanheld wird von kräftigen Schicksalsschlägen getroffen; schnell geht ihm das Geld aus, von seinem Bruder aus Ungarn erhält er einen Brief, der seine baldige Rückkehr einfordern will, und auch einen schweren Zusammenbruch mit anschließendem Krankenhausaufenthalt muss Mihály überstehen. Mihály ist alles andere als perfekt, und obwohl er seine Frau frühzeitig sitzen gelassen hat, obwohl sie ihm zuliebe doch ihren ersten Ehemann verlassen hat, wächst er uns ans Herz, sodass wir ihm wünschen, dass er endlich seinen Weg findet und glücklich werden möge.
Derweil sucht Erzsi alleine in Rom ihr Glück und trifft bald János Szepetneki wieder, der schließlich den Vermittler für Zoltán spielen wird. Zunächst hofft Erzsi noch auf Mihálys Rückkehr, doch muss sie bald einsehen, dass damit nicht zu rechnen ist. Dennoch will sie die Hoffnung auf eine Versöhnung nicht aufgeben. In der notwendigen Sparsamkeit geht sie vorerst völlig auf, da sie diese in der Ehe mit Zoltán so vermisst hat, aber schließlich sind es dann die Männer, die Erzsi lenken und ihre Geschicke für sie leiten. Solcherart erscheint uns Erzsi ein wenig als Spielball der Geschichte, dennoch verleiht Szerb natürlich auch ihr Merkmale, die sie liebenswert machen und stark erscheinen lassen können.
Zoltán erhält die Rolle des liebeskranken verlassenen Ehemanns, der zwar in Mihály keine bedrohliche Konkurrenz gesehen hat, jedoch in allen Männern, die Erzsi in Rom und später auch in Paris treffen würde. Um Erzsi zurückzugewinnen, erniedrigt sich Zoltán und will alles in seiner Macht Stehende tun, allerdings kommen dem Leser auch Zweifel, ob es wirklich um die Liebe geht oder einfach nur um den dabei zu erringenden Sieg?!
Antal Szerb zeichnet durchweg glaubwürdige Charaktere, die von vielen Seiten beleuchtet werden, um sie menschlich wirken zu lassen und eine Identifikation zu ermöglichen. Die Sympathien sind jedoch klar verteilt, denn als Leser hängt man sein Herz an Mihály, der kurz vor dem Abgrund zu stehen scheint.
_Traumwelten und Schuldzuweisungen_
Schon die Erlebnisse im Ulpius-Haus entscheiden über Mihálys Zukunft, in den Flitterwochen schließlich wird er von seinen Erinnerungen überrollt. Mit den Ulpius-Geschwistern konnte Mihály beim Theaterspiel viele Träume ausleben und Dinge geschehen machen, die im wirklichen Leben nicht möglich erschienen. Mit großer Hingabe sind die damaligen Freunde in unterschiedliche Rollen geschlüpft, die sicherlich charakteristisch für die Schauspieler waren. Mit Tamás und Éva war nichts unmöglich und in dieses Bild passt auch Tamás’ Selbstmord, der ihn vor einer Zukunft bewahrt hat, in der er sich unweigerlich von seinen Traumvorstellungen hätte lösen und Verantwortung für sich und andere hätte übernehmen müssen.
In etwas naiver Manier schafft Mihály es, sämtliche Schuld von sich zu weisen, immer sind es die kleinen Momente, die für ihn entschieden haben. In Venedig sind es die unübersichtlichen Gassen, in denen er sich verläuft, auf der Fahrt nach Rom ist der Zug schuld, der zu früh abfährt, und später ist es Ervin, der die Entscheidung für Mihály trifft und ihn nach Rom schickt. Nur selten scheint Mihály bewusst Entscheidungen für sein Leben zu treffen und so passt besonders das gelungene Buchende perfekt in das Gesamtbild.
_Klein, aber fein_
Antal Szerb benötigt weder Mord noch Totschlag und auch keine perfekten Charaktere, um eine absolut gelungene Geschichte zu präsentieren. Gerade die Fehler des Romanhelden sind es, die den Leser schmunzeln lassen und eine Identifikation ermöglichen. Auf jeder Seite fiebert man mit und wünscht Mihály so sehr, dass er endlich sein Glück finden möge, doch geschehen immer wieder Dinge, die seine Geschicke für ihn lenken. Auch sprachlich ist „Reise im Mondlicht“ eine erfreuliche Abwechslung vom oft anzutreffenden literarischen Einheitsbrei der „Massenschreiber“; jeder Zeile merkt man an, dass ein Literaturprofessor am Werke war, der die Sprache liebt – so macht das Lesen richtig Spaß. „Reise im Mondlicht“ ist ein Muss für jeden Buchliebhaber, der sich an den Kleinigkeiten erfreuen kann, an feiner Ironie und wunderbaren Sätzen, die eine liebevolle Geschichte von Alltagsmenschen erzählen. Dieses Buch ist einfach großartig!
http://www.dtv.de
|Ergänzend dazu: Michael Matzers [Rezension der Hörbuchfassung 2724