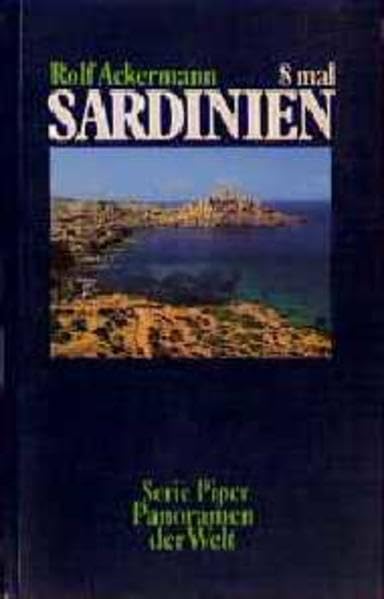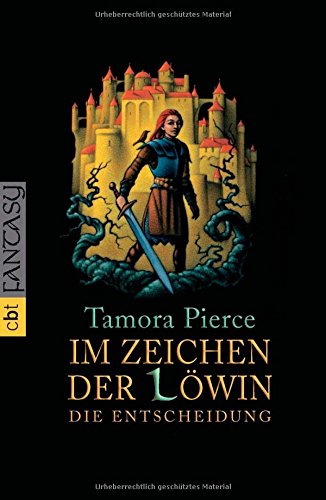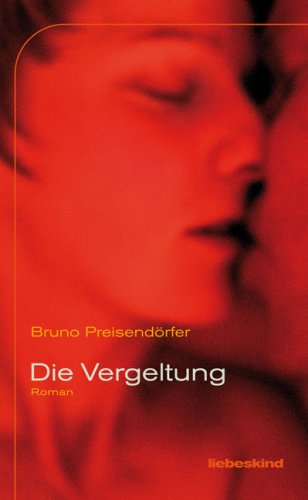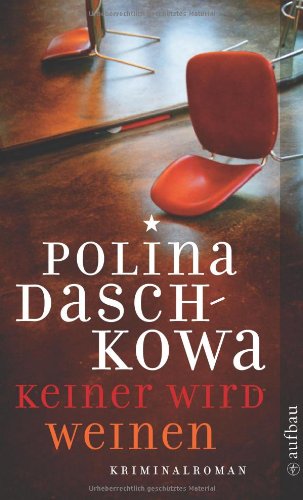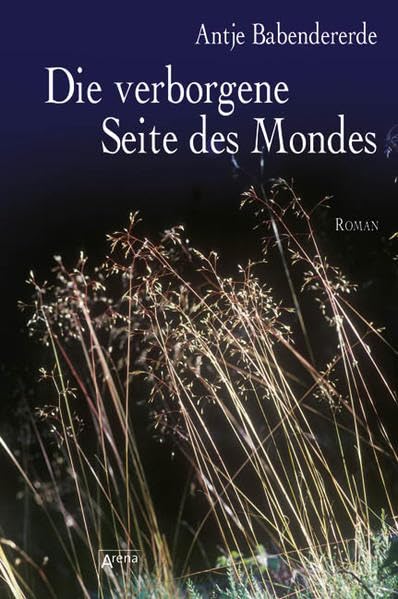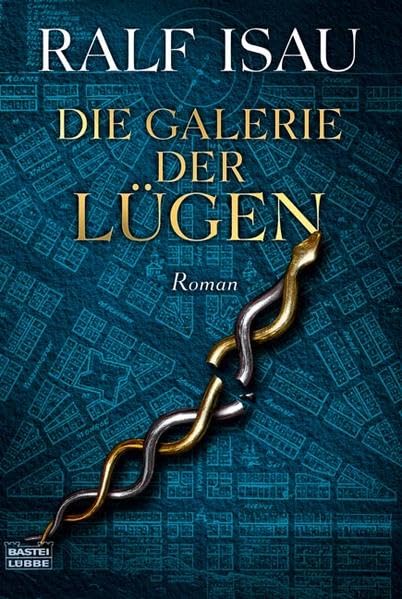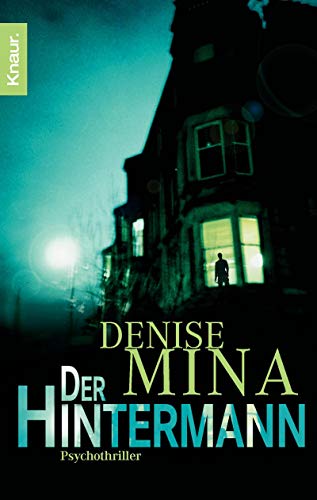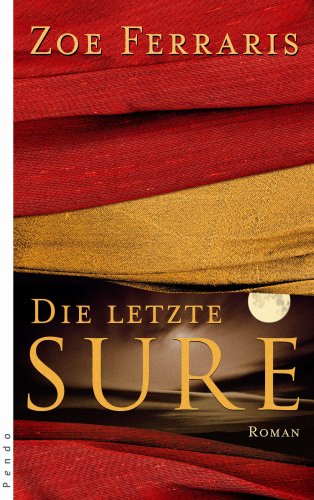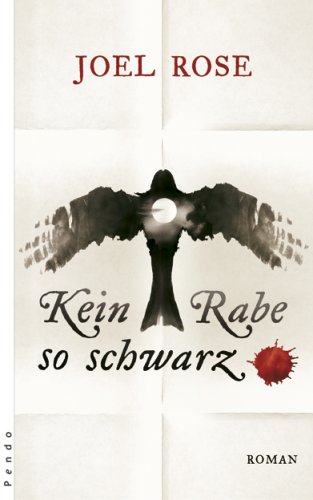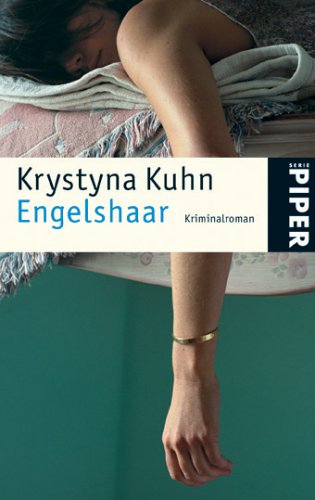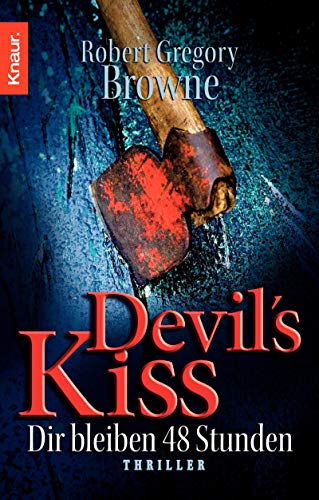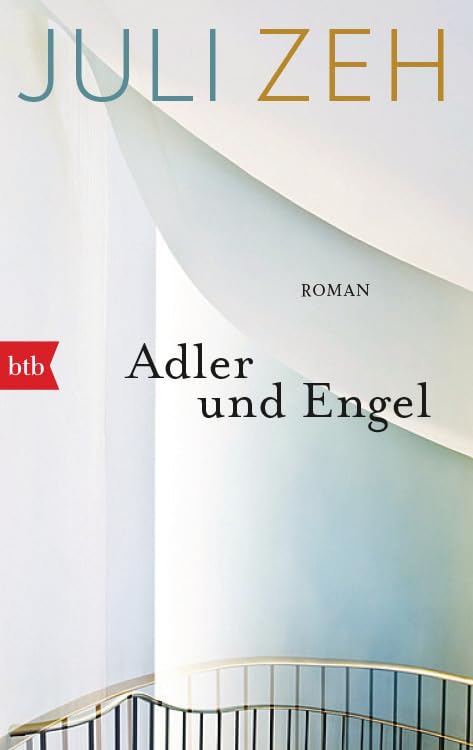Schon seit vielen Jahren versuchen die Palästinenser ihren anerkannten Anspruch auf ein eigenes Staatsgebiet durchzusetzen – bislang ohne Erfolg. Der schwedische Schriftsteller Jan Guillou entwirft in seinem Roman „Madame Terror“ ein Szenario, wie die Palästinenser ihrem Ziel ein Stückchen näher kommen könnten.
Eine tragende Rolle spielt dabei Mouna al-Husseini, eine einflussreiche Agentin der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO. Sie ist diejenige, die den wahnwitzigen Plan entworfen hat, mit einem U-Boot die israelische Flotte unschädlich zu machen, um der Forderung nach einem rein palästinensischen Gaza-Streifen Nachdruck zu verleihen. Aus diesem Grund lässt sie mit der Hilfe von Russlands Präsident Putin ein bis dato unerreichtes Wunderwerk von U-Boot bauen und wirbt russische und arabische Männer an, die ihr im Kampf zur Seite stehen sollen. Doch bei der ersten Testfahrt geht einiges schief. Die Russen und die Palästinenser geraten sich in die Haare, was unter anderen Umständen das Ende von Mounas Mission bedeutet hätte.
Kurz und gut: Es muss ein Mann her, der nicht nur ein U-Boot befehligen kann, sondern auch Russisch, Englisch und Arabisch spricht, der Charisma hat und ihr Anliegen versteht. Da kann es selbstverständlich nur einen geben: Carl Hamilton alias Coq Rouge, der Held aus Guillous früheren Büchern. Hamilton sitzt eigentlich in der Falle. Wegen Mordes müsste er in Schweden eine lebenslängliche Haftstrafe abbüßen, aber ihm gelang die Flucht, und nun lebt er im Zeugenschutzprogramm des FBI mit neuer Identität in Kalifornien. Als eines Abends seine alte Freundin Mouna auftaucht und ihn um Hilfe bittet, ziert er sich nicht lange: Er hat es satt, in Kalifornien festzusitzen. Gemeinsam mit der Agentin arbeitet er einen Plan aus, wie man eine möglichst kompetente U-Boot-Mannschaft zusammenstellt und den Krieg gegen Israel am geschicktesten führt. Hamilton stellt sich als Glücksgriff heraus, den Mouna auch bitter nötig hat. Der Anschlag auf den israelischen Marinestützpunkt in Haifa verläuft zwar mehr oder weniger nach Plan, doch ehe die U-Boot-Mannschaft sich versehen hat, wird sie von der ganzen Welt gejagt. Von der ganzen Welt? Nein, eigentlich gibt es nur einen, der glaubt, das U-Boot unbedingt versenken zu müssen, und das ist der amerikanische Präsident …
… und der amerikanische Präsident ist, wie wir wissen, momentan George W. Bush. Jan Guillou nimmt in „Madame Terror“ kein Blatt vor den Mund. Viele politische Figuren in dem Buch existieren auch im realen Leben, darunter Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice, Tony Blair, Wladimir Putin oder der palästinensische Präsident Mahmud Abbas. Doch der Schwede baut diese Personen nicht nur in seine Geschichte ein, er schreibt sogar aus ihrer Perspektive. Dabei lässt er es sich nicht nehmen, einige Politiker als eher einfältig und dumm darzustellen, ohne den Bogen aber wirklich zu überspannen.
Er geht dabei sehr selbstverständlich mit den Personen um und führt jede neue erst einmal mit ihrer Biografie und der Darstellung ihres momentanen Gefühlszustandes ein. Dadurch schweift er gelegentlich etwas ab, was aber letztendlich für gut ausgearbeitete Charaktere sorgt. Dabei liegt sein Fokus nicht wirklich auf einer einzigen Person. Vielmehr hat man das Gefühl, dass jede vorkommende Perspektive des Romans gleichberechtigt ist. Das ist natürlich sehr gewagt. Viele Personen sorgen oft dafür, dass ein Buch zerfasert und inkonsistent wird. Nicht in diesem Fall. Guillou schafft es, die Geschichte zusammenzuhalten, und verleiht ihr durch die Vielzahl von Charakteren unterschiedlichster Nationalität und Aufgabe eine bemerkenswerte Tiefe.
Die Handlung unterstreicht diese Tiefe. Sie ist bis ins kleinste Detail ausgefeilt. „Madame Terror“ ist einer dieser Polit-Thriller, die Konzentration erfordern, weil sie so detailreich sind. Widmet man dem Roman diese Konzentration, wird man mehr als entlohnt. Das Buch ist spannend, der Autor scheint zu wissen, worüber er schreibt. Gerät der Anfang noch etwas zäh, kommt das Buch später wie ein schweres U-Boot in Fahrt und gewinnt an Spannung, die man aufgrund des eher trockenen Sujets nicht erwartet hätte. Die politischen Verwicklungen sind an der einen oder anderen Stellen für Leser, die sich auf diesem Gebiet nicht so gut auskennen, etwas verworren, aber im Gesamtkontext sind diese Stellen trotzdem verständlich und mindern die Spannung nicht. Selbige wird im Übrigen auch durch das handwerkliche Geschick des Autors erzeugt. Er weiß mit Perspektivenwechseln zu spielen. Sobald ein großes Ereignis naht, setzt er einen Schnitt, um dann während oder nach dem Ereignis wieder einzusetzen. Meistens tut er dies aus der Sicht einer außenstehenden Person, wie zum Beispiel der amerikanischen Außenministerin Condoleezza Rice, die des Öfteren zu Worte kommt.
Gestützt wird das gut recherchierte und realistisch wirkende Material durch einen gestochen scharfen und intelligenten Schreibstil. Guillou gelingt es dabei, Abwechslung in die Geschichte zu bringen, indem er unterschiedliche Stimmlagen verwendet. Kommen beispielsweise die Amerikaner zum Zuge, wird die Sprache oft etwas ordinärer, so, wie man sich einen – leicht überspitzten – George W. Bush eben vorstellt. Ansonsten lässt sich das Buch wunderbar flüssig lesen. Guillou greift auf einen großen Wortschatz zurück, und obwohl er auf einem hohen technischen Niveau schreibt, vermisst man weder Leben noch Gefühl, auch wenn darauf sicherlich nicht sein Hauptfokus liegt.
In der Summe ist dem Schweden mit „Madame Terror“ ein sehr ausgefeiltes, technisch gut geschriebenes und vor allem spannendes und realistisch dargestelltes Schreckensszenario gelungen, wie es hoffentlich nie passieren wird. Was das Buch für viele sicherlich besonders interessant macht, ist die Tatsache, dass die Amerikaner und ihre Kriegspolitik nicht besonders gut wegkommen. Das hebt die Geschichte auch positiv ab von vielen amerikanischen Thrillern, die sich mit dieser Thematik befassen. Dennoch begeht Guillou nicht den Fehler, die Vereinigten Staaten zu einseitig darzustellen. Im Gegenteil schafft er mit der des Öfteren eingesetzten Perspektive von Condoleezza Rice ein angenehmes, unaufdringliches Gegengewicht, das sehr gefällt.
http://www.piper-verlag.de/nordiska/