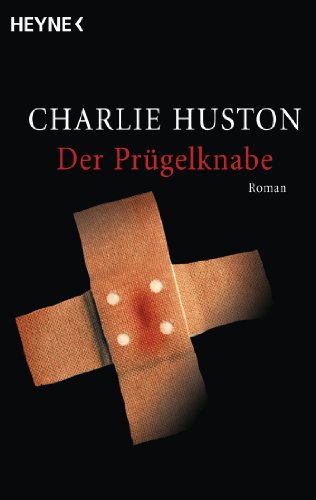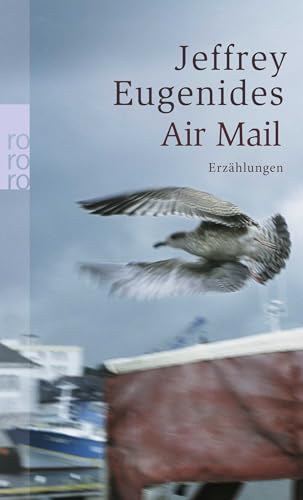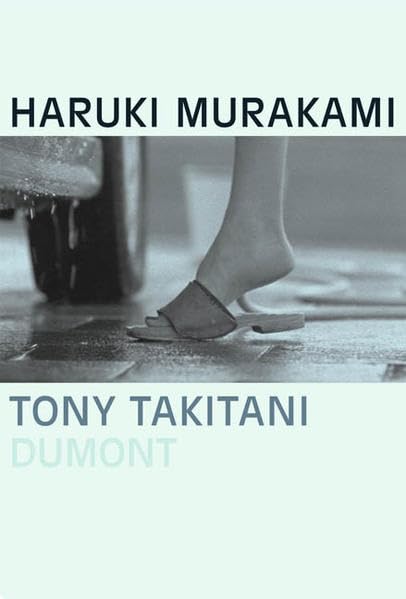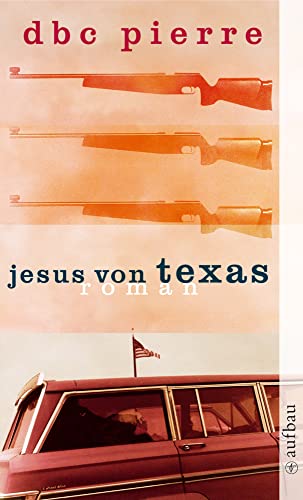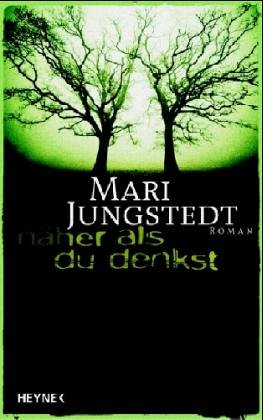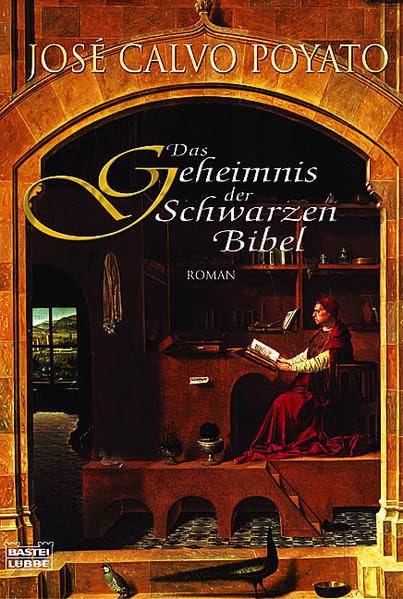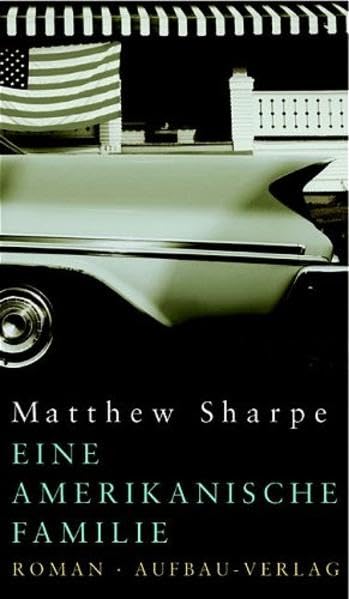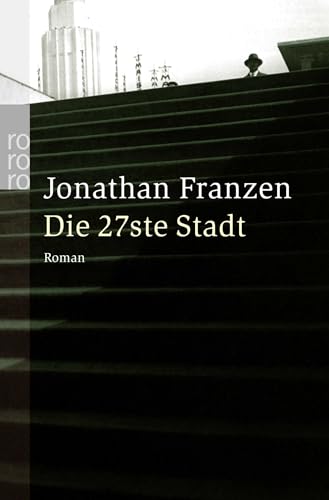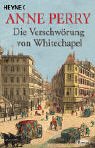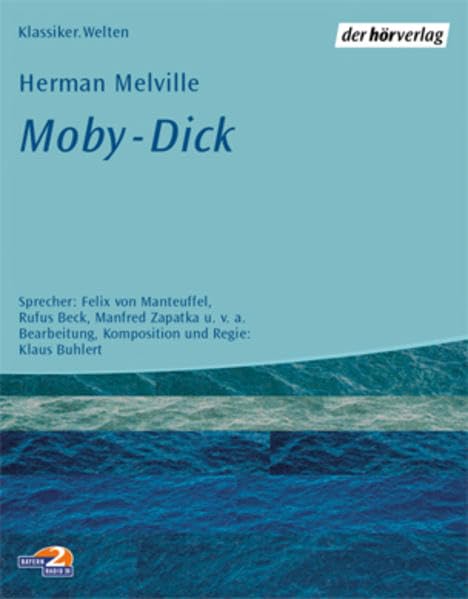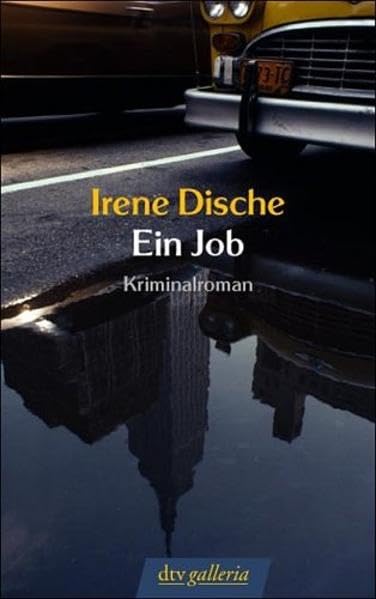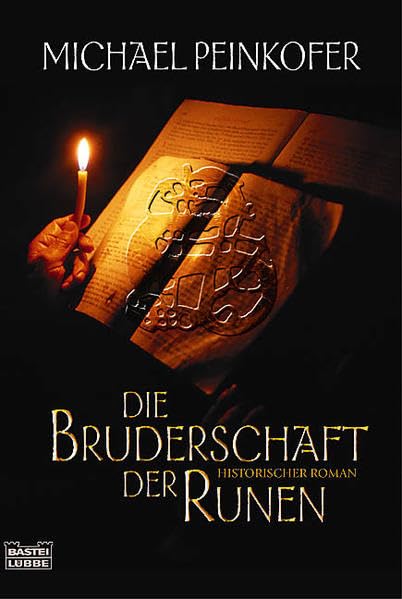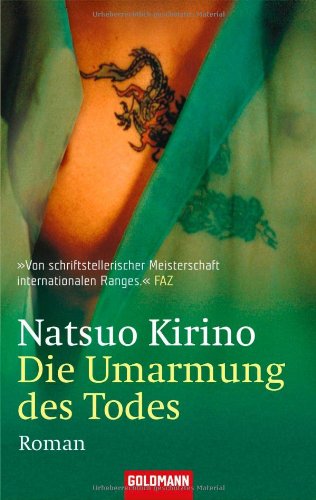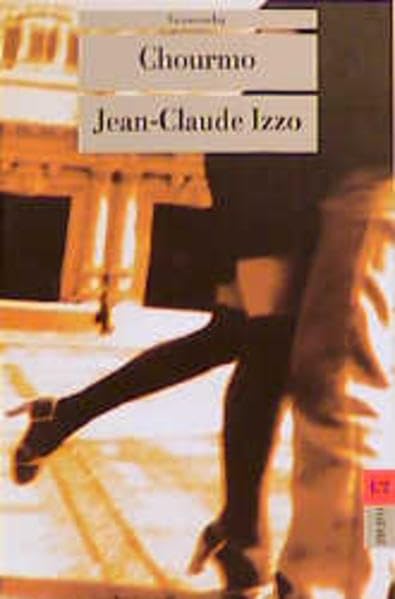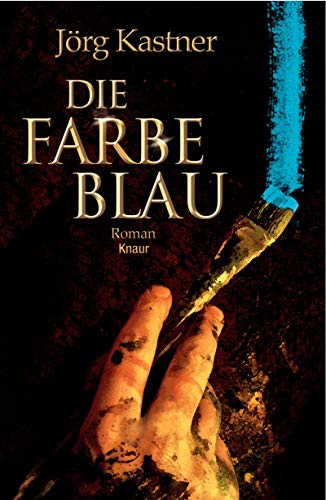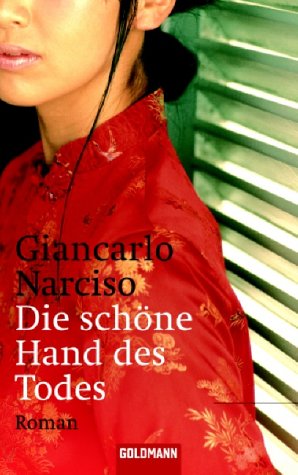Was dabei herauskommt, wenn Drehbuchautoren anfangen Romane zu schreiben, sieht man an „Der Prügelknabe“ von Charlie Huston: Ein Buch, das verständlicherweise wie geschaffen dafür ist, verfilmt zu werden. Kein Wunder also, dass die Filmrechte zu Hustons Debütroman schon verkauft sind. Doch funktioniert das Buch als eigenständiger Roman genauso gut wie als möglicher Film? Oder ist es als Vorlage für den Film eher Mittel zum Zweck?
„Der Prügelknabe“ erzählt die Geschichte des sympathischen Verlierers Hank. Nachdem er aufgrund einer schweren Sportverletzung seine hoffnungsvolle Baseballkarriere an den Nagel hängen musste, zog es Hank von Kalifornien nach New York. Dort führt er ein bescheidenes Leben als dem Alkohol arg zugeneigter Barkeeper. Alles in allem eine unspektakuläre Existenz – bis er eines Abends in der Bar von zwei Russen übel zugerichtet wird. Einige Tage später wird Hank aus dem Krankenhaus entlassen, um eine Niere ärmer und den (zugegebenermaßen vom Arzt aufgezwungenen) Vorsatz, sein Leben zu ändern, reicher.
Hank soll dem Alkohol entsagen (was ihm verständlicherweise nicht ganz leicht fällt) und sich von den Strapazen der Nieren-OP erholen, doch Ruhe ist ihm nicht vergönnt. Kaum ist er zu Hause angekommen, tauchen die beiden Russen wieder auf. Dass die Sache offenbar mit seinem Nachbarn Russ zu tun hat, dämmert ihm, als dessen Bude von einem Haufen Gangstertypen durchwühlt wird.
Russ ist derweil untergetaucht, während Hank brav dessen Katze hütet. Was Hank allerdings nicht ahnt, ist, dass in dem Käfig, mit dem Russ vor seiner Abreise vor Hanks Tür stand, nicht nur die Katze war, sondern auch ein ominöser Schlüssel. Und auf den sind plötzlich eine Menge Leute scharf. Für Hank ist dies der Beginn einer Odyssee kreuz und quer durch den New Yorker Großstadtdschungel. Skrupellose Gangster, korrupte Polizisten, die Russenmafia – alle sind sie hinter Hank her, und der lernt in den folgenden Tagen eine Menge einzustecken …
„Der Prügelknabe“ ist eine recht rasante Geschichte. Ohne viel Umschweife steigt Huston direkt ins Geschehen ein, keine Worte werden verschwendet, keine Zeile ist zu viel. Hustons Erzählstil ist ein Stil der schnellen Schnitte und der sprunghaften Überleitungen. Kurze, knappe Sätze, schnelle Wortwechsel und ein hohes Erzähltempo sind die markantesten Eigenschaften des Romans. Huston wechselt schnell von einer Szene zur nächsten, springt, ohne den Leser lang und breit darauf vorzubereiten, in der Handlung vor und zurück und dokumentiert die Dialoge als rasante Wortwechsel, bei denen man als Leser schon mal hier und da nachdenken muss, wer jetzt eigentlich was gesagt hat.
Das wirkt manchmal ein wenig abgehackt und hastig, zum Handlungsbogen passt dieser direkte Erzählstil aber dennoch sehr gut. Huston konzentriert sich auf Hanks Odyssee durch New York. Es gibt nur eine Handvoll Nebenfiguren, deren Charakterisierung aber stets oberflächlich bleibt. Umso detaillierter setzt Huston sich mit seinem Protagonisten auseinander. Hank, der auf den ersten Seiten noch einen etwas asozialen und unsympathischen Eindruck hinterlässt, wächst dem Leser schnell ans Herz. Hank wirkt natürlich und glaubwürdig. Eine gescheiterte Existenz, die irgendwie ihre Lebensziele aus den Augen verloren hat, so wie Menschen nun einmal Ziele aus den Augen verlieren. Er hatte Pech und hat sich zwischenzeitlich damit abgefunden. So wie Hank sind viele Menschen, und das macht ihn als Protagonisten so großartig. Man kann sich in ihn hineinversetzen, findet sich vielleicht sogar ein Stück weit in ihm wieder. Das lässt die Geschichte authentisch wirken und fesselt den Leser in Anbetracht der Dinge, die Hank erlebt, umso mehr.
Zugegeben, was Hank in „Der Prügelknabe“ so alles erlebt, das mag auf Ottonormalverbraucher doch recht unwahrscheinlich wirken. Es ist nun einmal eine actiongeladene Thrillergeschichte, authentische Hauptfigur hin oder her. Hank hat alle möglichen Leute an den Hacken, von denen der eine skrupelloser als der andere ist. Aber Hank bleibt in all diesem Trubel so erfrischend normal, dass die Geschichte auf ihre Art wirklich glaubwürdig erscheint. Er glaubt anfangs beharrlich an ein Missverständnis, glaubt, dass sich schon alles aufklären wird, wenn Russ erst einmal zurückkommt und er glaubt, dass er den Gangstern schon irgendwie begreiflich machen kann, dass er der Falsche ist, doch so einfach ist das natürlich nicht. Hank hat niemanden, den er um Hilfe bitten kann, und steht ziemlich allein vor dem ganzen Schlammassel.
Ein wenig naiv wirkt er, wie er, stets begleitet von Russ‘ Katze Bud (um deren Wohlergehen er sich permanent und geradezu rührend sorgt), durch die Geschichte stolpert. Dieser Umstand hat schon eine gewisse schwarzhumorige Seite, die auch an anderen Stellen des Romans gelegentlich wieder aufblitzt. So knallhart, wie die Geschichte verläuft, so komische Momente hat sie eben auch immer wieder mal, wenngleich der Humor dahinter eher ein unterschwelliger, indirekter ist.
Hank entwickelt sich innerhalb der Geschehnisse weiter, und auch das durchaus glaubwürdig. Zunehmend frustriert darüber, für alle nur der titelstiftende Prügelknabe zu sein und dementsprechend einstecken zu müssen, obwohl er sich das augenblicklich gesundheitlich gar nicht leisten kann, wird Hank mit der Zeit hart im Nehmen. Er beginnt das Spielchen mitzuspielen und entwickelt sich dabei zu einem durchaus ernst zu nehmenden Gegenspieler. Und dann wird das, was im Roman innerhalb weniger Tage passiert, richtig spannend und temporeich.
So rasant wie „Der Prügelknabe“ daherkommt, so blutig ist er teilweise auch. Das, was manche der Figuren an Kaltblütigkeit und Brutalität auffahren, ist nicht unbedingt für die zartesten Gemüter geeignet. Besonders im Gedächtnis bleiben da die Szenen, die mit Nähten und Wunden zu tun haben, denn einmal ist es Hank, der durch eher unsachgemäßes Fädenziehen an seiner OP-Wunde zum Reden gebracht werden soll, ein anderes Mal ist es Hank, der mit Nadel und Faden versucht, Russ‘ Schädel zusammenzuflicken. Alles nicht unbedingt appetitlich in all seiner Deutlichkeit und Detailliertheit. Sehr deutlich ist Huston auch sprachlich. Es wird viel geflucht, der Ton ist derbe, teils vulgär – wie man es von einer echten New Yorker Gangstergeschichte nun einmal erwartet.
Im Klappentext fällt übrigens das gefährliche Wort |Kultroman|. Kultromane lassen sich natürlich nicht durch Klappentexte zu eben solchen machen, insofern bin ich bei dieser Vokabel immer äußerst skeptisch. Es werden allerhand Vergleiche gezogen (Tarantino, Hitchcock, „The Big Lebowski“, „Der Marathon-Mann“, „American Psycho“). Nicht alles zwangsläufig nachvollziehbar, aber die Zielgruppe lässt sich damit immerhin recht ordentlich einkreisen. Meine These ist eigentlich immer die, dass Bücher, auf denen Dinge wie |“der perfekte Kultroman“| stehen, niemals genau das werden können. Schließlich wird Kultstatus nur durch die Resonanz des Publikums erzeugt und nicht durch den Willen des Verlags. Kult geht die merkwürdigsten und unvorhersehbarsten Wege. Ob „Der Prügelknabe“ also jemals in irgendeiner Weise „Kultstatus“ erreichen wird, kann einzig und allein die Zeit zeigen.
Woran der Verlag aber ruhig noch einmal arbeiten dürfte, ist das Lektorat. „Der Prügelknabe“ enthält eine ganze Reihe nervtötender und überflüssiger Fehler, die eigentlich vor der Veröffentlichung ausgemerzt gehören. Da gibt es nicht nur Tippfehler (über die man eventuell noch hinwegsehen könnte), sondern durchaus auch mal Wortdreher und vertauschte Namen und das sind dann Fehler, die wirklich stören.
Ansonsten gibt es abschließend kaum Negatives festzuhalten. Charlie Huston ist ein rasantes, spannendes und ernst zu nehmendes Romandebüt gelungen, mit einem Protagonisten, der dem Leser schnell ans Herz wächst. Er skizziert eine intensive, nervenaufreibende Odyssee durch New York, die zu verfolgen bis zur letzten Seite Freude bereitet. Der sprunghafte, teils etwas abgehackte Erzählstil mit den rasanten Wortwechseln erfordert zwar eine gewisse Konzentration und mag hier und da etwas stören, passt aber gut zum Inhalt.
Wem „Der Prügelknabe“ gefallen hat, der darf sich obendrein auf zwei weitere Bücher um den sympathischen Verlierertypen Hank freuen, denn Huston hat die Geschichte als Trilogie geschrieben, deren zweiter Teil („Der Gejagte“) in diesem Monat in die Buchläden kommt.