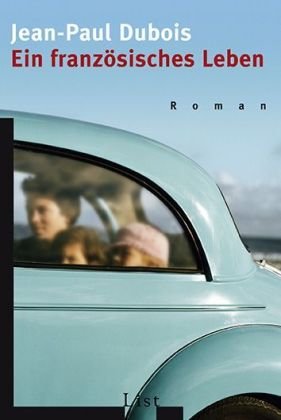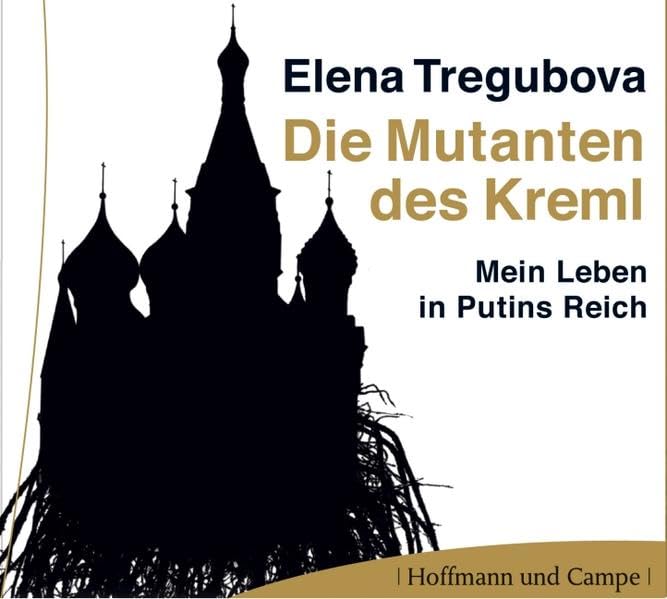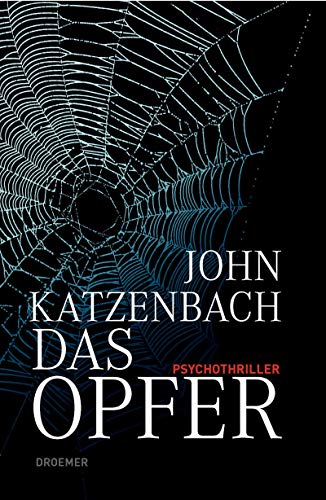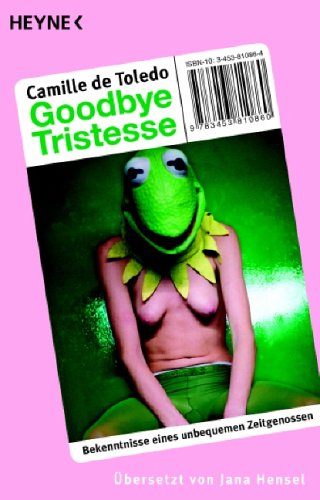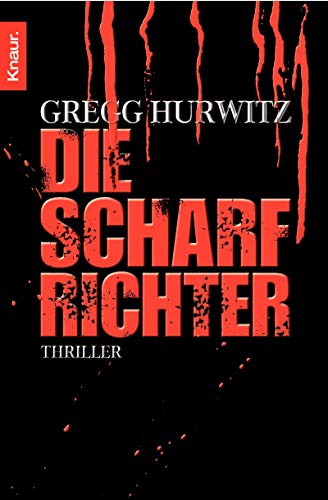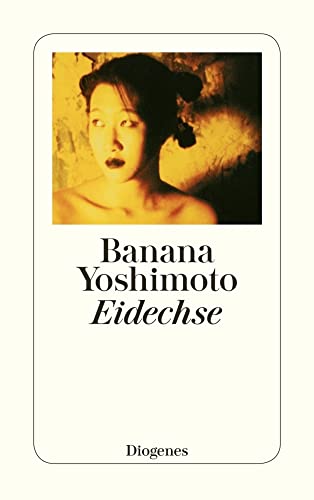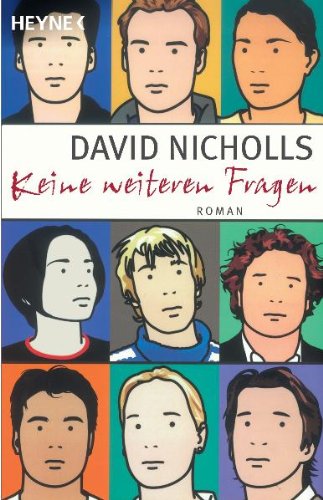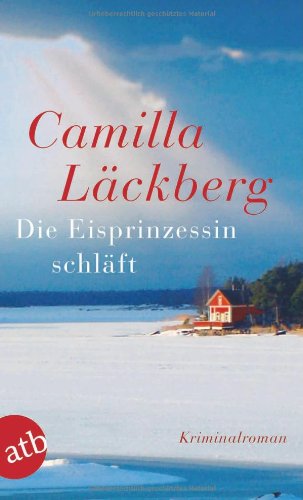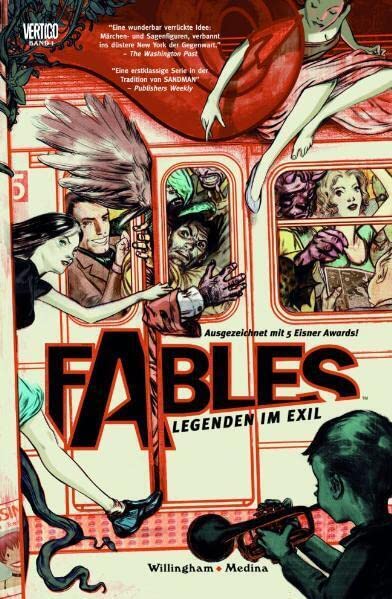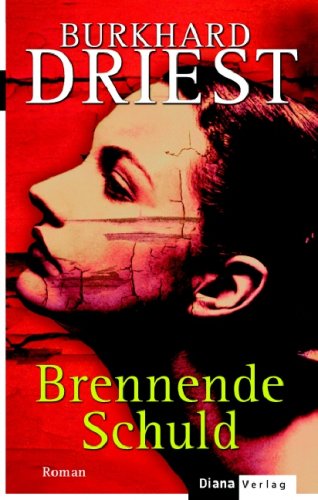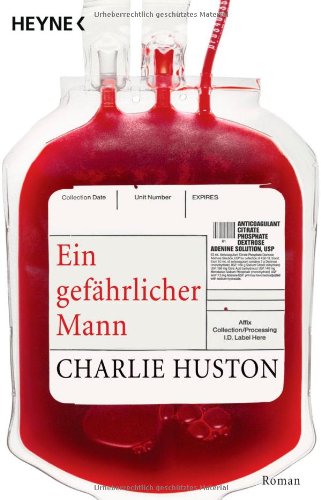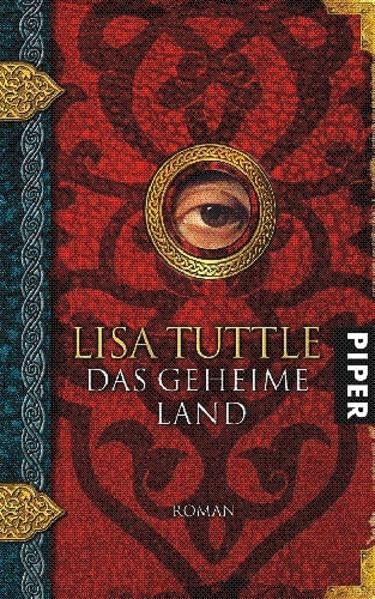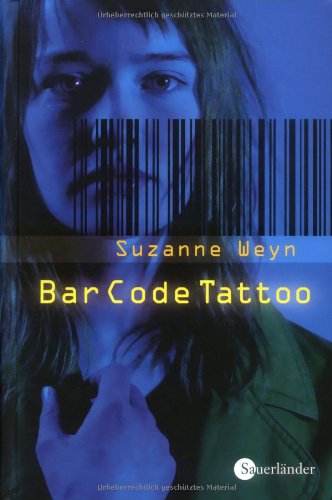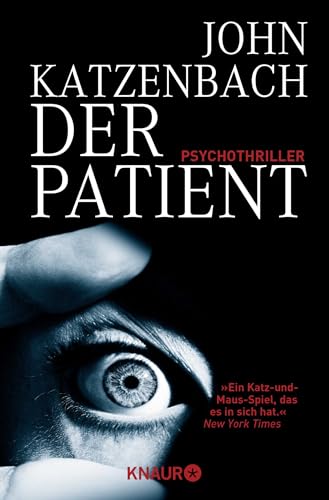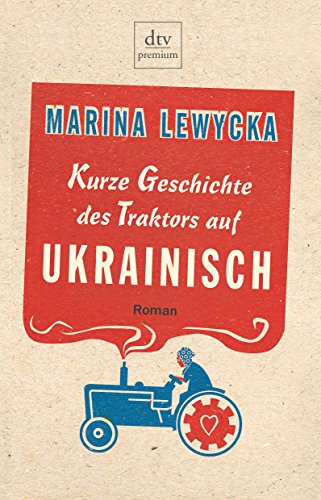Ganz unspektakulär klingt der Titel von Jean-Paul Dubois‘ Roman „Ein französisches Leben“. Ganz pragmatisch beschreibt er den Inhalt und wirkt dabei gleichermaßen banal wie unaufregend. Und so läuft man beinahe Gefahr, ein schönes Kleinod zu verpassen, das man angesichts des unscheinbaren Titels in der Masse der Neuerscheinungen kaum wahrnimmt.
„Ein französisches Leben“ erzählt in der Tat ein solches, und zwar das von Paul Blick. Eine Kindheit in den fünfziger Jahren, das Aufbegehren der Achtundsechziger und später der Rückzug in die Bürgerlichkeit. Pauls erstes einschneidendes Erlebnis ist der Tod des Bruders am Tag der Wiederwahl von Charles de Gaulle. Paul verliert einen wichtigen Haltepunkt, den großen, starken Bruder, der ihn auf alles im Leben hätte vorbereiten können.
Doch Paul geht auch so seinen Weg, wenngleich die Familie nicht mehr die Gleiche ist wie vor dem Tod des Bruders, dessen Platz am Abendbrotstisch schon bald ein Fernsehgerät einnimmt. Paul entflieht dem Elternhaus, so früh er kann, und beginnt sein Studium mitten in den unruhigen Zeiten der achtundsechziger Bewegung. Auch Paul steckt mittendrin. Zügelloses WG-Leben, Bandproben statt Vorlesungen, politische Debatten anstelle von Klausuren – Paul entwickelt viele Leidenschaften, aber keine für sein Studienfach Soziologie.
Irgendwie bekommt er sein Diplom, wenngleich man sich fragt, wofür. Er nimmt einen Job als Sportjournalist an und verliebt sich in Anna, die Tochter seines Chefs. Als Anna schwanger wird, beugt Paul sich den gesellschaftlichen Konventionen und heiratet Anna. Mit der Heirat schwenkt er wieder in ein konventionelleres Leben ein, wenngleich die Rollenverteilung in der jungen Familie Blick für die damalige Zeit noch eher unkonventionell ist. Während Anna im eigenen Betrieb Karriere macht, hütet Paul Haus und Kinder und kocht das Abendessen.
Als die Kinder größer werden, entdeckt Paul zwei neue Leidenschaften: das Fotografieren von Bäumen und Laure, die Freundin seiner Frau. Zwischen Laure, Dunkelkammer und Hausarbeit spielt sich Pauls Leben in den folgenden Jahren ab, und mit seiner Ehe geht es dabei ganz leise bergab. Als dann nacheinander mehrere persönliche Katastrophen über die Blicks hereinbrechen, ist das beschauliche Leben für Paul vorbei. Er muss sich dem Schicksal stellen …
Eine Lebensgeschichte erzählt „Ein französisches Leben“ nur in erster Linie. In zweiter Linie ist Jean-Paul Dubois‘ Roman auch ein Abbild der Gesellschaft zwischen 1958 und heute. Wie schon am Tag, als Pauls Bruder stirbt, durchkreuzen die politischen Ereignisse immer wieder das persönliche Schicksal des Paul Blick. Paul ist ein Mensch mit hochgesteckten, linken Idealen, und so spielt Politik immer wieder eine Rolle in seiner Biographie. Dubois schildert Pauls Leben mit einem stetigen Auge auf die politischen Entwicklungen der jeweiligen Zeit, und so ist „Ein französisches Leben“ gleichzeitig ein Resümee der französischen und europäischen Geschichte der letzten fünfzig Jahre.
Paul ist dennoch der Dreh- und Angelpunkt der Handlung. Alles wird aus seinem Blickwinkel beschrieben und an ihm kann man wunderbar die unterschiedlichen Ausprägungen der Epochen nachvollziehen, die er erlebt hat. Interessant wird es mit dem Aufbegehren Ende der sechziger Jahre, als Paul gerade sein Studium antritt. Wie ein Befreiungsschlag vom dumpfen Alltag seines Elternhauses, auf dem noch immer der Tod des Bruders lastet, wirkt der Start in sein neues Leben. Paul will so schnell wie möglich auf eigenen Füßen stehen, sein Leben nach seinen Vorstellungen führen.
Der rebellische Charakter des Achtundsechzigers wird unter den Konventionen des Ehelebens jedoch schnell gebrochen. Paul zieht sich zurück, bleibt zu Hause und kümmert sich um den Nachwuchs, während seine Frau als erfolgreiche Geschäftsfrau immer mehr in eine Rolle schlüpft, die ihm als Linken nicht in den Kram passen kann. Und so schleift das Leben nicht nur die Ecken und Kanten von Pauls Persönlichkeit ab, sondern auch die des Ehelebens. Das Zusammenleben wird zunehmend farbloser. Die Leidenschaft der erste Jahre weicht wortkargen Mahlzeiten und einsamen Abenden auf dem Sofa.
Dabei führt Paul eigentlich ein so bewundernswert ruhiges Leben. Da seine Frau die Brötchen verdient, bleiben ihm alle Freiheiten, die er sich wünschen kann. Er hat Zeit, sich der Fotografie zu widmen, die immer mehr zu seiner einsamen Insel wird, die ihn von den anderen isoliert. Stundenlang hockt er in der Dunkelkammer, während sich Bäume auf dem Fotopapier materialisieren und die Welt um ihn herum immer weiter wegrückt.
Es muss unweigerlich irgendwann zu einem Bruch in diesem Leben kommen, das voller Entfremdung und Müßiggang ist, und so schlägt das Schicksal am Ende gnadenlos zu. Es passiert wahnsinnig viel auf den letzten Seiten des Buches, und man kann sich ausmalen, welch radikalen Umbruch das im Leben eines Paul Blick bedeuten muss.
Das Leben des Paul Blick ist sicherlich nicht in jeder Hinsicht exemplarisch für das einer ganzen Generation, dennoch gelingt es Jean-Paul Dubois durch seine weitsichtige Erzählweise, das Abbild einer Epoche darzustellen. Mit präzisem Blick porträtiert er die unterschiedlichen Generationen und skizziert das Leben der unterschiedlichen Menschen in Paul Blicks Leben.
Auch wenn das nicht immer spannend ist (von Spannung kann eigentlich erst gegen Ende des Buches die Rede sein), so ist es dennoch stets sehr schön zu lesen. Dubois hat einen absolut fantastischen Erzählstil, an dem einzig die häufigen und teils skurrilen Fremdwörter stören. Ansonsten jongliert er so wunderbar mit Worten und setzt sie auf so erstaunliche Weise zu punktgenauen und wohlakzentuierten Formulierungen um, dass die Lektüre ein wahrer Genuss ist. Es ist vor allem Dubois‘ Erzählstil, der den Leser leichtfüßig durch die Handlung trägt.
Dubois schreibt mit wunderbar klarem Blick und bringt dabei eine solche bunte Palette an Emotionen unter, die so herrlich treffsicher in Worte verpackt sind, dass man sich das Buch einfach auf der Zunge zergehen lassen muss. Ein Roman, der langsam und genießerisch gelesen werden will und dann das ganze Kaleidoskop seiner Emotionen entfaltet.
Bleibt unterm Strich ein positiver Eindruck zurück. „Ein französisches Leben“ ist sicherlich nichts für Leser, die eine fesselnde Erzählung erwarten. Wer sich aber auf eine schöne Sprache voller Gefühl und Leben einlassen kann und wer einfache Geschichten zu schätzen weiß, die das Leben halt so schreibt, der wird an der Lektüre sicherlich seine Freude haben. Dubois‘ Erzählstil bereitet sehr viel Freude und verlangt genießerisches Lesen. Wer sich darauf einlässt, der wird mit einer Geschichte voller intensiver Gefühle belohnt.
http://www.ullsteinbuchverlage.de