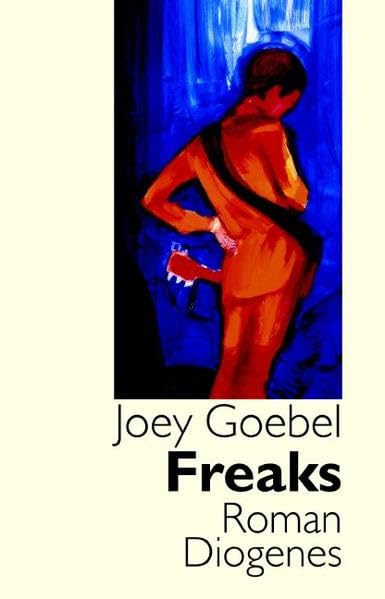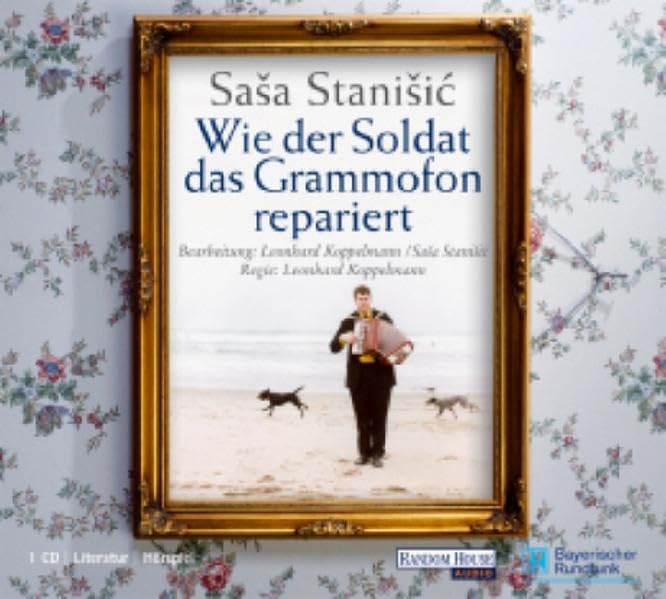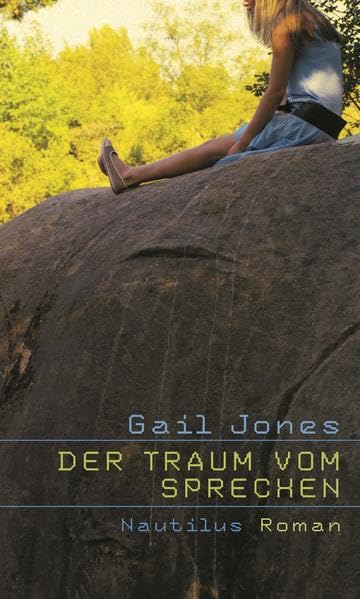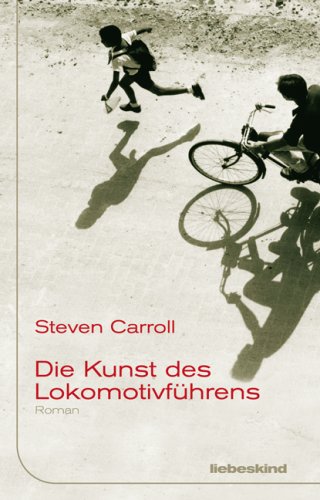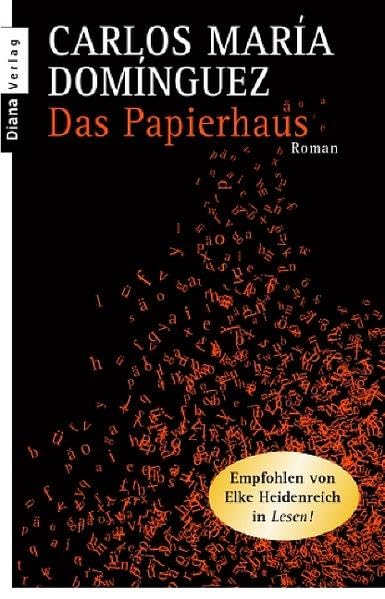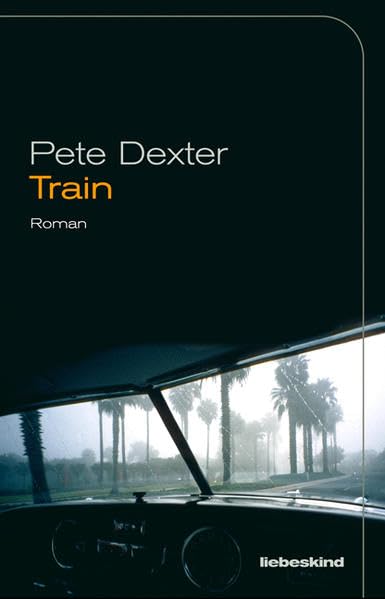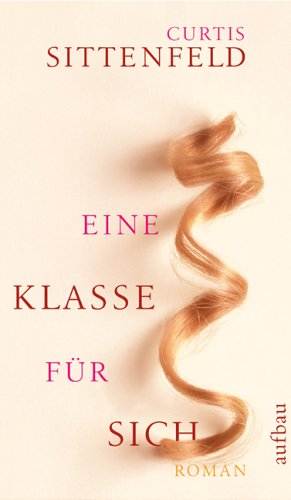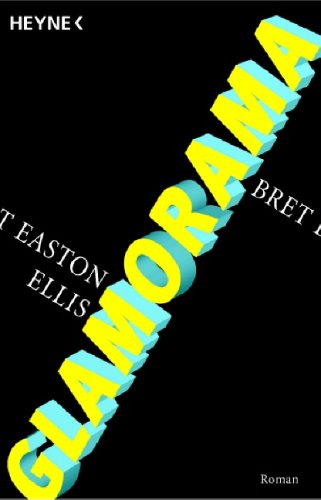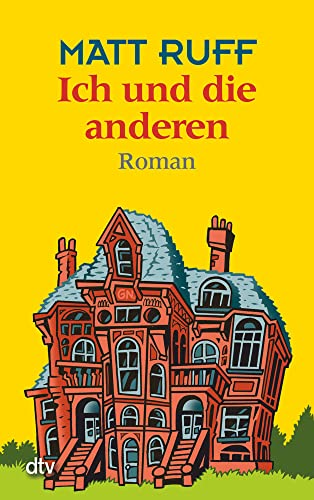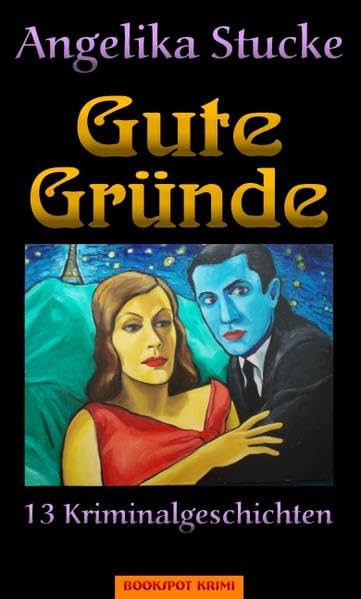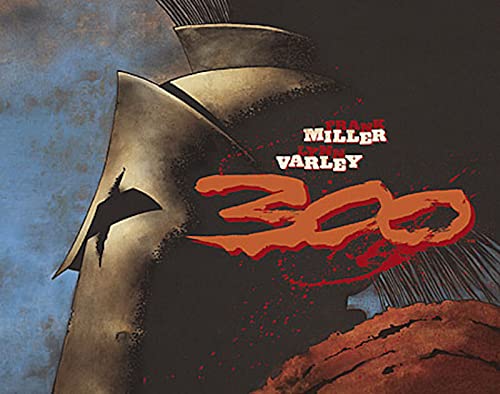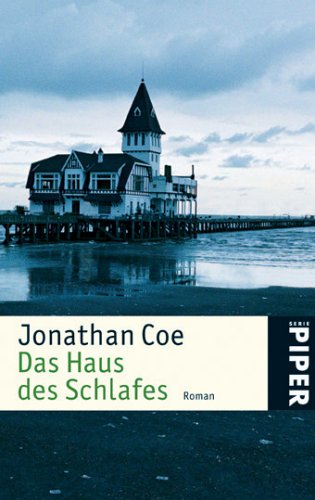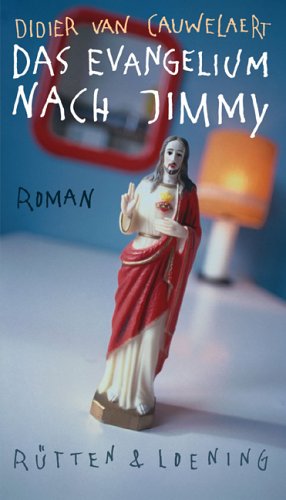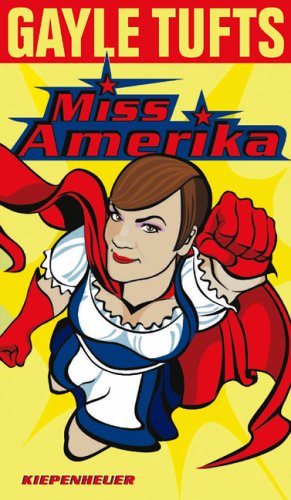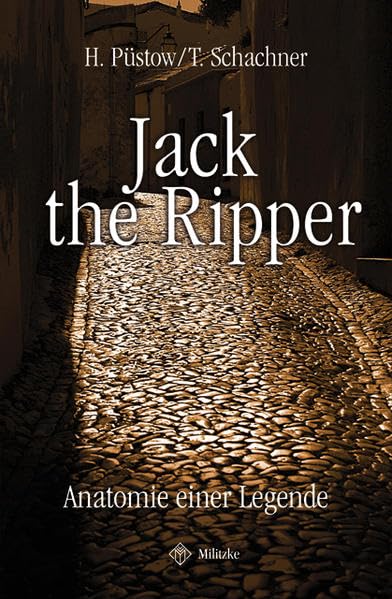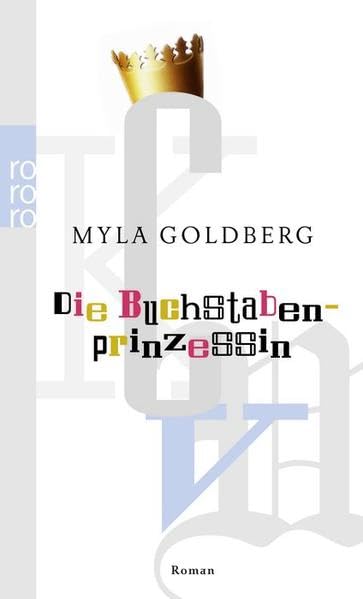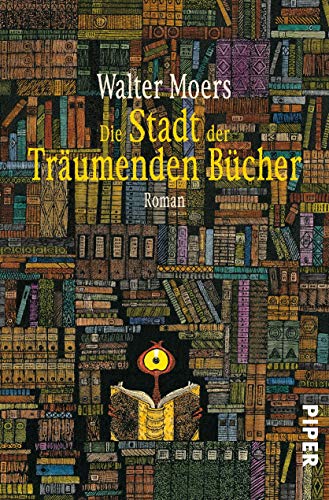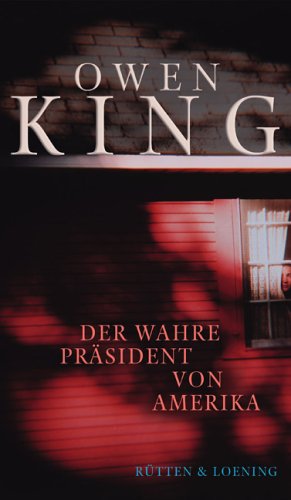Bevor Joey Goebel für seinen Roman [„Vincent“ 1827 reichlich Applaus erntete, schrieb er bereits ein Drehbuch, das, umgeschrieben zum Roman „Freaks“, nun zu etwas verspäteter Ehre kommt. „Freaks“ ist ein Roman, der gleich mit dem ersten Satz bereits Punkte sammelt, steigt er doch mit einem der vermutlich besten Romananfänge der Literaturgeschichte in die Handlung ein: |“Leicht war es nicht, sechs Milliarden gebrochene Herzen auf einmal zu flicken, doch ich schaffte es.“| (S. 9)
Bei „Freaks“ ist der Name Programm. Die titelgebenden Freaks sind eine Band, zur der kaum ein Name besser passen dürfte als „The Freaks“. Eine bunter zusammengewürfelte Truppe dürfte man in noch keinem Probenraum der Welt gesehen haben.
Frontman und Sänger der Gruppe ist Luster, ein schwarzer Hobbyphilosoph und Möchtegern-Weltverbesserer. Aufgrund seiner schnellen Zunge und seines nie enden wollenden Redeschwalls sonderbaren Inhalts glauben die meisten Leute, er wäre durchgehend auf Drogen. Das mag auch schon deswegen naheliegen, weil seine Brüder stadtbekannte Dealer sind, hat mit der Realität aber nichts zu tun, denn Luster ist konsequent drogenfrei.
An den Drums sitzt die bildschöne, im Rollstuhl sitzende, 19jährige Aurora. Derzeit versucht sich die ehemalige Stripperin als Satanistin, was ihr permanentes Konfliktpotenzial in der ohnehin schon angekratzten Beziehung zu ihrem Vater, einem Pfarrer, liefert.
Gitarristin Opal zieht mit ihren 80 Jahren den Altersdurchschnitt der Band enorm nach oben. Sie will auf ihre alten Tage noch einmal richtig abrocken und fühlt sich eigentlich zu jung fürs Altersheim. Sie will noch mal richtig Spaß haben, ohne sich darum zu scheren, dass sie mit ihren Cowboystiefeln und dem Sex-Pistols-T-Shirt von den meisten Leuten ausgelacht wird.
Das krasse Gegenteil (zumindest dem Alter nach) ist Ember, die Bass spielt. Ember ist gerade einmal acht Jahre alt und damit kaum größer als ihre Bassgitarre. Auch Ember hat ein etwas gestörtes Verhältnis zu ihrer Umwelt, vor allem zu Eltern und Lehrern. Sie hasst alles und jeden, außer ihren Bandkollegen. Sie will alles sein, aber nicht süß.
Der fünfte im Bunde ist Ray, der Keyboarder. Ray ist ein irakischer Ex-Soldat, der sich nach Kentucky aufgemacht hat, um den amerikanischen Soldaten zu suchen, den er im ersten Golfkrieg verwundet hat. Ray will sich eigentlich nur entschuldigen, hat sich aber inzwischen so gut in Amerika eingelebt, dass er amerikanischer ist als so mancher Amerikaner.
Das Thema von „Freaks“ – eine kleine Band aus dem Mittleren Westen, die ihr Glück versucht – dürfte Joey Goebel aus persönlicher Erfahrung vertraut sein. Goebel, in Kentucky geboren, tourte früher mit seiner Punkrockband „The Mullets“ durch den Mittleren Westen.
Joey Goebel erzählt die Geschichte der Band aus ständig wechselnden Perspektiven. Jeder Absatz gibt in der Überschrift an, aus wessen Sicht er erzählt wird. Dabei werden auch vermeintliche Statisten zu Erzählern. Immer wieder lässt Goebel Außenstehende die Hauptfiguren beobachten – ein kleiner Kniff, um seine kuriosen Hauptfiguren auch immer wieder aus der Distanz betrachten zu können. Ihre Wirkung auf Außenstehende, ihr kurioser Eindruck, wenn sie zusammen einen Raum betreten, all das wird so besonders deutlich vermittelt.
Durch die ständigen perspektivischen Sprünge liegt dem Roman ein recht hohes Tempo zugrunde. Die Geschichte entwickelt sich mit einiger Dynamik und die perspektivischen Wechsel sorgen für eine gewisse Spannung. Teils bekommt man erst durch das Zusammensetzen der unterschiedlichen Beobachtungen und Gedanken ein vollständiges Bild der Geschehnisse, was den Reiz, der Geschichte weiter zu folgen, mit fortschreitender Seitenzahl erhöht.
Auf den ersten Blick mag „Freaks“ wie ein oberflächlicher Unterhaltungsroman erscheinen. Die Figuren wirken allesamt zu abgedreht, um realistisch zu erscheinen. Vielmehr polarisieren sie, stellen jeder für sich ein eigenes Extrem dar und erfordern auch beim Leser ein gewisses Maß an Toleranz. Wenn Goebel allerdings die Gedanken der unterschiedlichen Protagonisten schildert, dringt er tiefer in die Persönlichkeiten ein. Man kann zwar dennoch nicht gerade sagen, man würde in die Figuren eintauchen und mit ihnen fühlen können, dennoch macht Goebel ihre Motive und Gedanken größtenteils recht gut deutlich.
Das alles reicht verständlicherweise noch nicht für einen überragenden Roman, aber es gibt da noch die sprachliche Komponente, die Joey Goebel besonders auszeichnet. Auch sprachlich legt Goebel ein recht hohes Tempo vor. Er formuliert vor allem aber gewitzt und mit einer gewissen Ironie. Der Humor geht dabei gar nicht so sehr auf Kosten der Protagonisten, wie man mit Blick auf ihr Erscheinungsbild meinen möchte, sondern mehr auf Kosten ihrer Umwelt. Immer wieder kann man über komische Situationen und sonderbare Gespräche schmunzeln, die stets auch ein Stück weit den Geist der Zeit einfangen und die gesellschaftliche Situation portraitieren. Und darüber mag man den Protagonisten so manche Abgedrehtheit verzeihen.
Verglichen mit „Vincent“ wirkt „Freaks“ dennoch nicht ganz so ausgereift. Man merkt deutlich, dass „Freaks“ dem Ursprung nach ein etwas älteres Werk ist. Mit „Vincent“ hat Goebel sich schon erheblich weiterentwickelt. Mag manches an „Freaks“ noch etwas kindisch wirken, auch wenn Goebels Talent zwischendurch immer wieder zwischen den Zeilen hindurchfunkelt, so wirkt „Vincent“ eben schon ein ganzes Stück ausgegorener und zeigt wesentlich deutlicher als „Freaks“, dass Goebel ein ernstzunehmender und talentierter Autor ist, der großartige Ideen hat und diese sprachlich gelungen umsetzen kann.
Bleibt unterm Strich der Eindruck, dass „Freaks“ gegenüber „Vincent“ etwas schwächer daherkommt. Man merkt bei der Lektüre sehr schnell, dass es sich um ein früheres, nicht ganz so ausgereiftes Werk des Autors handelt. Dennoch weiß der Roman zu unterhalten. Die Figuren sind interessant, wenngleich ziemlich abgedreht, Goebels Sprache ist gewitzt und sein Erzählstil temporeich und voller spannungssteigernder Perspektivenwechsel. Alles in allem also durchaus gute Unterhaltung, obwohl man weiß, dass Goebel es eigentlich noch besser kann.
http://www.diogenes.de