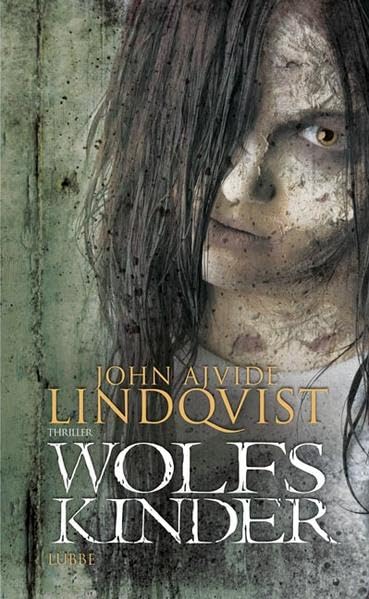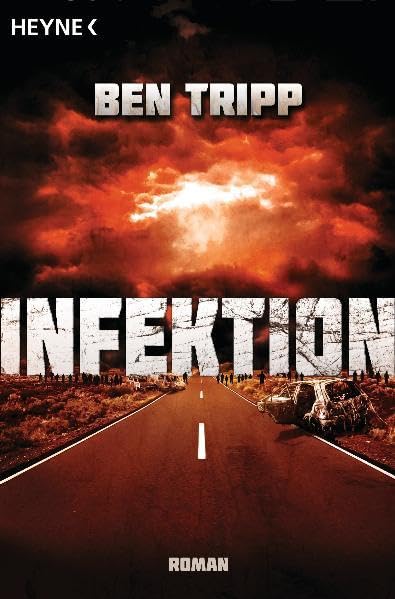Susan Hill – Die Frau in Schwarz weiterlesen
Alle Beiträge von Michael Drewniok
Frost, Scott – Pray – Du kannst nicht entkommen
_|Alex-Delillo-Serie:|_
(2004) |Run the Risk| [(Risk – Du sollst mich fürchten)]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=3924
(2006) |Never Fear| (Fear – Angst hat einen Namen)
(2008) |Point of No Return| (kein dt. Titel)
(2009) |Don’t Look Back| (Pray – Du kannst nicht entkommen)
(2010) |Wait for Dark| (kein dt. Titel)
_Das geschieht:_
Ein neuer Fall bringt die Mordkommission der Polizei im kalifornischen Pasadena und ihre Leiterin, Lieutenant Alex Delillo, rasch unter Druck. Ein irrer aber sehr bedacht vorgehender Killer meldet sich mit einem Paukenschlag: Ausgerechnet in einem großen Sportstadium deponiert er die Leiche der vor drei Jahren spurlos verschwundenen Kari Bishop – tief gefroren und in einen Schlafsack gesteckt.
Dylan Harrison, Delillos Partner und derzeitiger Lebensgefährte, hatte den Fall damals vergeblich bearbeitet. Nun macht er sich Vorwürfe, zumal der Täter Folgemorde ankündigt: Unweit der Leiche findet die Polizei die Kopie einer Radierung des spanischen Künstlers Francisco de Goya (1746-1828), der in seinem Spätwerk politische und soziale Missstände seiner Zeit aufgriff, anprangerte und dabei die Kirche nicht ausklammerte.
Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen dem Mord und einer Klage, die drei Jahre zuvor gegen die Erzdiözese von Los Angeles geführt wurde. Ihr wurde die Duldung und Vertuschung von Kindesmissbrauch durch Geistliche vorgeworfen. Kari Bishops Vater, ein Anwalt, vertrat damals die Anklage, doch der Prozess wurde durch einen Vergleich vermieden, bei dem die Kirche viel Geld fließen ließ.
Offensichtlich will sich eines der Opfer nicht mit dem erkauften Schweigen abfinden. Nächstes Mordopfer wird ein TV-Reporter. Weitere Goya-Kopien werden gefunden. Die Ermittlungen hat der Mörder in seinen Racheplan einkalkuliert, denn auch Delillos Chef und verehrter Mentor ist in den Missbrauchs-Skandal verwickelt und wird kurz darauf von Goya entführt. Nun wird die Fahndung erst recht zum Wettlauf mit der Zeit, zumal der Papst nach Pasadena kommen wird – die ideale Zielperson für einen wütenden Killer mit einer Mission …
|Der Mensch als Schachfigur|
Kritik an der Kirche ist beileibe kein Phänomen des 21. Jahrhunderts. Missstände gibt es bekanntlich weiterhin in deprimierender Zahl fest- und abzustellen. Heutzutage müssen diejenigen, die dies versuchen, immerhin nicht mehr fürchten, von einem Rollkommando der Inquisition verschleppt zu werden – es sei denn, man gehört zu denen, die davon ausgehen, dass der Vatikan eine Art Geheimorden betreibt, dessen Mitglieder genannte Kritiker heimlich, still & leise aus dem Verkehr ziehen. Auch diese Theorie ist alt, aber seit Dan Brown solche kirchlichen Munkeleien auf ein globales und multimediales Niveau erhob, hat sie sowohl Befürworter als auch Trittbrettfahrer in erstaunlicher Kopfstärke bekommen.
Die (Beinahe-) Gewissheit, vor Killern des Vatikans in relativer Sicherheit zu leben, schürt den angenehmen Schauder angesichts immerhin möglicher Geheimnistuereien einer Kirche, die seit zwei Jahrtausenden existiert und deren Repräsentanten zur Verschwiegenheit neigen, wenn es darum geht, Außenstehenden Einblicke in eine Geschichte (oder Gegenwart) zu gewähren, die nie frei von dunklen Flecken war (und ist). Hinzu kommt das durchaus erschreckende Selbstverständnis einer angeblich für Gott sprechenden Institution, die ihre Existenz höher gewichtet als das sterbliche Individuum.
Diese Realitäten werden mit Spekulation aufgeladen zur unterhaltsamen Fiktion, die wie gesagt ein zahlenreiches und vor allem zahlungskräftiges Publikum findet. Dan Brown wurde inzwischen quasi geklont, die Zahl seiner Epigonen nimmt weiterhin zu. Dem steht eine Palette von Situationen, Schauplätzen und Figuren entgegen, die zumindest im ‚reinen‘ Kirchen-Thriller bei nüchterner Betrachtung eine geringe Variationsbreite aufweist. Dieser wird deshalb gern mit anderen Genres verschnitten.
|Der serienkillende Genius|
Scott Frost kombiniert ihn mit dem klassischen Cop-Krimi. Die daraus erwachsende Herausforderung besitzt doppeltes Gewicht, weil der Verfasser dabei auf einen Plot zurückgreift, der seinerseits zum Klischee geronnen ist: Zu Dan Brown gesellt sich Thomas Harris, dem wir nicht nur Hannibal Lecter, sondern eine Heerschar notorisch genialer aber chronisch irrsinniger Serienkiller verdanken, die seit zwei Jahrzehnten über die Buchhandlungen dieser Welt herfallen; ein Ende ist keineswegs in Sicht.
Dieses Mal nennt sich der fromme Unhold „Goya“, denn er orientiert sich bei seinen Taten an den düsteren Grafiken und Gemälden des gleichnamigen Künstlers. Man könnte vermuten, dass moderne Serienkiller wie Goya vor allem deshalb so sorgfältig planen, weil sie um Publicity und Unterhaltungsgehalt ihres Wirkens wissen. Sie investieren jedenfalls so viel Zeit darin, sich mehrdeutige Sprüche auszudenken und mysteriöse Zeichen auszulegen, dass man sich außerdem fragt, wie sie die eigentlichen Übeltaten zwischen solche Rätselspielchen einschieben können. Trotz mehrjähriger Vorbereitungsphase kann Goya nicht überall gleichzeitig sein; darüber hinaus müsste ihm das Schicksal mehr als ein Quäntchen Glück gewähren, um die auf vielen Ebenen gleichzeitig ablaufenden Aktivitäten unter Kontrolle zu halten.
|Die Ermittlung ist das Ziel|
Da „Pray“ jedoch ungeachtet aller Klischees (und trotz eines denkbar bescheuerten deutschen Titels) erstaunlich gut funktioniert, muss Verfasser Frost etwas anders machen als der übliche Brown/Harris-Imitator – anders bzw. richtig. Hat der Leser das erste, etwas zäh anlaufende Viertel dieses Romans hinter sich gebracht, weiß er, worin die Unterschiede liegen.
Frost ist kein Künstler, sondern ein Handwerker. Diese Bezeichnung kommt hier mit Respekt und Anerkennung zur Verwendung, denn Frost weiß dies offensichtlich gut. Er hat nie den Ehrgeiz, das Rad neu zu erfinden. Nicht einmal durch das zwanghafte Ausdenken neuer, noch nie beschriebener Folter- und Mordmethoden macht er sich lächerlich. „Pray“ ist drastisch genug, wo es der Handlung dient, denn diese steht jederzeit im Vordergrund.
Was selbstverständlich sein sollte, ist es auch oder gerade im modernen Thriller leider keineswegs. Dieser begräbt seine Plots gern förmlich unter plakativer Gewalt, übt sich in aufgesetzter Gesellschaftskritik und schlägt Unmengen von Seifenoper-Schaum. „Pray“ ist keineswegs frei von diesen Übeln. Gerade deshalb fällt Frosts allgemeine Zurückhaltung angenehm auf. Er hätte sich in persönlichen Schicksalen förmlich suhlen können. Seine Hauptfigur ist weiblich und mit beruflichen wie privaten Schwierigkeiten reichlich geschlagen. Im dritten Band der Serie – die uns in Deutschland aus unerfindlichen Gründen bisher vorenthalten wurde, weshalb sich der Leser zahlreiche Andeutungen, die auf Band 3 zielen, zusammenreimen muss – wurde Alex Delillo u. a. vergewaltigt und leidet unter den Folgen.
|Wider den Strich gebürstet|
Sie leidet – aber dies wird nicht zur Handlung, sondern fließt ein und bleibt später unerwähnt, weil es nicht von Relevanz ist. Die Jagd auf den Killer, das Entdecken und Entschlüsseln von Spuren tritt in den Vordergrund. Hier kennt sich Frost, der als Drehbuchautor bekannt wurde, eindeutig aus, hier gelingt ihm eine an Irrungen & Wirrungen reiche und trotz bekannter Elemente spannende Geschichte, die vor dem inneren Auge des Lesers in der Tat wie ein Film abläuft.
Dieser verläuft außerdem nicht so stringent wie erwartet. Goya ist nicht der verbitterte Rächer, den seine Verfolger lange auf ihn projizieren. Auch andere Spuren werden zunächst falsch interpretiert, was das Geschehen fatal beeinflusst. Frost gelingt das Kunststück, die daraus resultierende Unsicherheit zu wahren.
Das Finale offenbart abermals die Dominanz der Handlung. Endlich zeigt sich der geniale Goya – und entpuppt sich als beinahe unwichtige Nebenfigur. Frost geht sehr richtig von der Prämisse aus, dass der ‚reale‘ Goya mit der überlebensgroßen Gestalt, die seine Verfolger aus ihm gemacht haben, nicht mithalten kann. Folgerichtig findet das eigentliche Finale ohne ihn statt.
Scott Frost gelingt ein ungewöhnlicher Spagat: Obwohl eindeutig als „Bestseller des Monats“ für die Abverkaufs-Tische moderner Buch-Supermärkte geschrieben, ist „Pray“ ein Pageturner im positiven Sinn, und obwohl Originalität nirgendwo durchschimmert und auch gar nicht versucht wird, schlägt man diesen Thriller nicht mit dem dumpfen Gefühl zu, um viele Stunden Lese- und Lebenszeit betrogen worden zu sein. Man wurde einfach gut unterhalten, und manchmal ist es genau das, was eine gelungene Lektüre ausmacht.
|Taschenbuch: 412 Seiten
Originaltitel: Don’t Look Back (London : Headline Publishing Group 2009)
Übersetzung: Karl-Heinz Ebnet
ISBN-13: 978-3-426-50769-8
Als eBook:
ISBN-13: 978-3-426-41031-8|
http://www.knaur.de
Seth Grahame-Smith: Abraham Lincoln – Vampirjäger

Seth Grahame-Smith: Abraham Lincoln – Vampirjäger weiterlesen
Ellery Queen – Die verräterische Flasche
_Das geschieht:_
Der Alltag des Privatdetektivs Ellery Queen wird in Kurzgeschichten nachgezeichnet. Beileibe nicht immer steht Mord im Mittelpunkt; stattdessen gilt es, ausgeklügelte Schurkentaten aufzuklären:
– Die verräterische Flasche (|The Telltale Bottle|, 1946): Statt seiner Begleiterin stolz den Hergang eines Verbrechens zu erläutern, hätte Ellery Queen darauf achten sollen, wer ihm außerdem zuhört.
– Der Sturz des Engels (|The Fallen Angel|, 1951): Nicht immer geschieht ein Mord, wenn der tödliche Schuss fällt, wie Ellery Queen durch intensive Indizien-Deutung nachweist und einen gar zu geschickten Täter entlarvt.
– Das Nadelöhr (|The Needle’s Eye|, 1951): Die Schatzsuche auf einer ehemaligen Pirateninsel wird für Ellery Queen zur Fahndung nach einem sehr gegenwärtigen Mörder.
– Die drei Buchstaben (|The Three R’s|, 1946): Die Klärung der Frage, warum der exzentrische Professor verschwand, als er an seinem ersten Kriminalroman schrieb, wird für Ellery Queen auf mehreren Ebenen zur Herausforderung.
– Der tote Kater (|The Dead Cat|, 1946): Nur Ellery Queen findet heraus, wie es dem Mörder gelang, im Dunkeln unbemerkt durch ein Zimmer voller Menschen zum Tatort zu schleichen.
– Die Puppe des Dauphin (|The Dauphin’s Doll|, 1948): Ausgerechnet zu Weihnachten misst sich Ellery Queen mit einem Juwelendieb, der ihn öffentlich herausgefordert hat.
|Ein Detektiv geht auf Sendung|
Die Vettern Frederic Dannay und Manfred Bennington Lee, verbargen sich höchstens in ihren ersten Schriftstellerjahren hinter dem Pseudonym „Ellery Queen“, das später eher als Markenzeichen diente. Dem entsprach die Geschäftstüchtigkeit des Autorenduos, das von Anfang an interessiert war, die Beliebtheit des Detektivs und die Einkünfte zu steigern. Deshalb waren Dannay & Lee gern bereit, Ellery Queen für die beiden Massenmedien Radio und Kino zu rekrutieren.
Berühmte Detektive tauchten dort seit den 1930er Jahren verstärkt auf. Während ihre Verfasser jedoch höchstens den lukrativen Namen verkauften, behielten die Vettern ihre Figur fest in der Hand. Sie beschäftigten sich intensiv mit den Formaten Hörspiel und Drehbuch und wurden schließlich selbst aktiv. Auf diese Weise konnten sie Qualität und Integrität der Romane bewahren.
Die Hörspiele der Serie „The Adventures of Ellery Queen“, die zwischen 1939 und 1948 ausgestrahlt wurden, schrieben ebenfalls Dannay & Lee. Der Titel kam nicht von ungefähr. Das Radio war kein Ort für allzu kunstvoll verrätselte Fälle. Ellery Queen musste stärker in den Mittelpunkt gestellt und als Figur deutlicher herausgearbeitet werden. Behutsam betonten Dannay & Lee eine durchaus bereits in den Romanen durchschimmernde Abenteuerlust. Dieser Ellery Queen war dynamisch und legte bei seinen Ermittlungen ein höheres Tempo vor, ohne dabei gegen die Regeln des Kriminalromans zu verstoßen.
Dem Radio verdanken wir auch eine Frau an Ellerys Seite. Nikki Porter ist seine Sekretärin, sein Watson und womöglich seine Bettgenossin; der moralisierende Zeitgeist gestattete dem Detektiv, der unverheiratet und dadurch ‚begehrenswerter‘ bleiben musste, jedoch keine Lebensgefährtin. So wurde auch weibliches Publikum durch eine Identifikationsfigur an das Programm gebunden.
|Aus dem Ohr zurück auf das Papier|
Dannay & Lee waren ökonomisch arbeitende Autoren. Nachdem ihre Hörspiele gesendet waren, griffen sie gern auf die Vorlagen zurück und schrieben sie zu Kurzgeschichten um. Diese erschienen zunächst in dem 1941 gegründeten „Ellery Queen Mystery Magazine“, dem Dannay vier Jahrzehnte als Herausgeber vorstand (und das noch heute erscheint). In einer weiteren Inkarnation wurden die Storys gesammelt und in Buchform herausgegeben.
Zwölf dieser Geschichten bildeten 1952 den „Calendar of Crime“: Ein typisches Jahr im Leben des Privatdetektivs Ellery Queen wurde episodisch nachgezeichnet – ein geschickter Trick, der den Recycling-Faktor dieser Neuveröffentlichung abschwächte. (Womöglich ließen sich Dannay & Lee dabei von ihrer Kollegin Agatha Christie inspirieren, die 1947 zwölf Storys mit ihrem Detektiv Hercule Poirot unter dem Titel „Die zwölf Arbeiten des Herkules“ neu herausgegeben hatte.)
Die Storys nahmen die Verkürzung des Hörspiels auf – und sie bekam ihnen gut: Während die Ellery-Queen-Romanen nach 1940 oft unter einem Zuviel an emotionalem Seifenschaum litten, mussten entsprechende Love-Story-Herz/Schmerz-Exzesse in den Kurzgeschichten unterbleiben. Zwar überlebte Nikki Porter auch in den gedruckten Storys, aber sie blieb nur Beiwerk. Im Mittelpunkt stand der jeweilige Kriminalfall.
|Geniale Fälle im Schnelldurchgang|
Die Kalender-Storys zeigen Dannay & Lee auf dem Höhepunkt ihrer Schaffenskraft. Höchstens „Die verräterische Flasche“ fällt aus dem Rahmen, weil es hier nicht um die Lösung eines Falls geht, sondern ein Fall von Künstlerpech aufgedeckt wird, gegen das auch ein Ellery Queen nicht gefeit ist. Diese Geschichte ist auf ein zwar spannendes aber vor allem überraschendes bzw. humorvolles Finale getrimmt – und beweist dabei, dass Dannay & Lee auf diesem Gebiet keine Meister waren. Das bestätigt auch „Die drei Buchstaben“. Diese Geschichte funktioniert dort, wo sie Queen dabei folgt, wie er Indizien sucht, findet und zu einer so vom Leser nicht erwarteten Wahrheit zusammensetzt. Leider soll auch hier die Auflösung witzig sein, was anno 1946 möglicherweise tatsächlich so empfunden wurde.
In seinem Element ist Ellery Queen, sobald er ‚richtige‘ Ganoven jagt. „Der Sturz des Engels“ fasziniert nicht nur durch eine fundierte Spurensuche, sondern wird noch interessanter durch die Tatsache, dass die von Queen entdeckten Indizien einfallsreich manipuliert wurden. Erst weitere, vom Täter übersehene Spuren lassen Queen den Braten riechen.
Einem ähnlichen Konzept folgt „Das Nadelöhr“. Hier steigern Dannay & Lee den Unterhaltungswert, indem sie die Handlung auf eine Insel verlegen. Zu allem Überfluss trieb hier einst der legendäre Piratenkapitän Kidd sein Unwesen und vergrub womöglich einen Schatz. Diese von den Autoren kurz aber präzise geschilderte Vorgeschichte bereitet den Boden für eine erste Überraschung: Sehr gegenwärtige Strolche gehen auf der Insel um, die Ellery Queen zwecks Vertuschung ihrer Taten instrumentalisieren wollen.
|Faszination der Vergangenheit|
Auch in „Die Puppe des Dauphin“ greifen Dannay & Lee ein historisches Rätsel auf. Genannte Puppe ist das tragische Relikt einer gruseligen Vergangenheit. Da sie zudem einen hohen Wert besitzt, erregt sie das Interesse eines Meisterdiebes, der Ellery Queen, der die Puppe bewachen soll, herausfordert. Schon dieser ironische Verweis auf die 1948 eigentlich längst vergangene Ära genialer, an Planung und Tatumsetzung mehr als an der Beute interessierter „Gentleman-Verbrecher“ deutet an, dass diese Geschichte nicht gar zu ernst genommen werden sollte. In der Tat ist „Die Puppe des Dauphin“ eine Weihnachtsgeschichte mit allen entsprechenden Elementen bzw. Klischees, die von den Autoren genüsslich und gelungen beschworen werden und in der niemand zu Schaden kommt.
Dagegen ist „Der tote Kater“ ein ‚ernstes‘ Miniatur-Psycho-Drama. Der Kriminalfall als solcher ist reizvoll – ein „locked-door-mystery“, bei dem sich nicht nur das Opfer, sondern auch die potenziellen Täter und der Detektiv in ein und demselben Raum befinden. Leider bedienen Dannay & Lee zur Begründung der Tat ein Frauenbild, das zeitgenössisch sein mag, aus heutiger Sicht jedoch zu stark auf Hysterie und weibliche Gefühlsduseligkeit setzt.
Nichtsdestotrotz zeigen diese sechs Storys, dass und wieso Ellery Queen auch in der kurzen Geschichte seine Leser fesseln kann. In Deutschland wurde der „Calendar“ nur einmal und in zwei Teilen (s. u.) veröffentlicht. Dies ist schon sehr lang her, was zumindest die gröbsten Kuriositäten einer in die Jahre gekommenen Übersetzung erklärt und entschuldigt, die des Lesers Geduld auf manche harte Probe stellt.
|Krimineller Kalender in zwei Teilen|
Wie viel zu üblich in Deutschland, wurde die Originalausgabe gekürzt, um sie in ein Verlagsschema zu pressen, das höchstens 160 Seiten pro Blau-Gelb-Kriminalroman gestattete. Wenigstens ging diese Praxis dieses Mal nicht an die Substanz der Texte. Stattdessen wurden sechs der ursprünglich zwölf Storys unterschlagen. Es fehlen:
– |The Inner Circle| (1947)
– |The President’s Half Disme| (1947)
– |The Ides of Michael Magoon| (1947)
– |The Emperor’s Dice| (1951)
– |The Gettysburg Bugle| (1951)
– |The Medical Finger| (1951)
Der zweite Teil des „Calendar of Crime“ wurde vier Jahre später übersetzt und veröffentlicht. Diese Sammlung erschien 1963 unter dem Titel „Der verhängnisvolle Ring“ im Sigbert-Mohn-Verlag als Signum-Kriminalroman Nr. 189.
_Autoren_
Mehr als vier Jahrzehnte umspannt die Karriere der Vettern Frederic Dannay (alias Daniel Nathan, 1905-1982) und Manfred Bennington Lee (alias Manford Lepofsky, 1905-1971), die 1928 im Rahmen eines Wettbewerbs mit „The Roman Hat Mystery“ als Kriminalroman-Autoren debütierten. Dieses war auch das erste Abenteuer des Gentleman-Ermittlers Ellery Queen, dem noch 25 weitere folgen sollten.
Dabei half natürlich die Fähigkeit, die Leserschaft mit den damals so beliebten, möglichst vertrackten Kriminalplots angenehm zu verwirren. Ein Schlüssel zum Erfolg war aber auch das Pseudonym. Ursprünglich hatten es Dannay und Lee erfunden, weil dies eine Bedingung des besagten Wettbewerbs war. Ohne Absicht hatten sie damit den Stein der Weisen gefunden: Das Publikum verinnerlichte sogleich die scheinbare Identität des ‚realen‘ Schriftstellers Ellery Queen mit dem Amateur-Detektiv Ellery Queen, der sich wiederum seinen Lebensunterhalt als Autor von Kriminalromanen verdient!
In den späteren Jahren verbarg das Markenzeichen Queen zudem, dass hinter den Kulissen zunehmend andere Verfasser tätig wurden. Lee wurde Anfang der 60er Jahre schwer krank und litt an einer Schreibblockade, Dannay gingen allmählich die Ideen aus, während die Leser nach neuen Abenteuern verlangten. Daher wurden viele der neuen Romane unter der mehr oder weniger straffen Anleitung der Cousins von Ghostwritern geschrieben.
|Taschenbuch: 160 Seiten
Originaltitel: Calendar of Crime (Boston : Little, Brown & Co. 1952)
Übersetzung: Heinz F. Kliem|
[Autorenhomepage]http://neptune.spaceports.com/~queen
_Ellery Queen bei |Buchwurm.info|:_
[„Chinesische Mandarinen“ 222
[„Der nackte Tod“ 362
[„Drachenzähne“ 833
[„Das Geheimnis der weißen Schuhe“ 1921
[„Die siamesischen Zwillinge“ 3352
[„Der verschwundene Revolver“ 4712
[„Der Giftbecher“ 4888
[„Das Haus auf halber Straße“ 5899
[„Und raus bist du!“ 6335
[„Schatten über Wrightsville“ 6362
[„Spiel mit dem Feuer“ 6459
[„Die trennende Tür“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=7138
[„Sherlock Holmes und Jack the Ripper“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=7343
Sutton, David A. (Hg.) – Solo für einen Kannibalen
_Das geschieht:_
1971 schrieben neun Autoren exklusiv für diese Anthologie Horrorgeschichten, die ausdrücklich in der Gegenwart angesiedelt sind:
– Robin Smyth: Der unrühmliche Aufstieg des Katzenfleischhändlers |(The Inglorious Rise of the Catsmeat Man)|: Das Geschäft läuft gut, bis Mama sich in die Hauptzutat verliebt.
– David Compton: Satansbrut |(Goat)|: Mit gutem Grund hasst jeder den alten Goat, doch leider steht er mit dem Teufel im Bund, was Rache gefährlich werden lässt.
– E. C. Tubb: Der letzte Hexensabbat |(The Winner)|: Die Rekonstruktion eines klassischen Sabbats gelingt, wie der Auftritt eines höllischen Überraschungsgastes demonstriert.
– Kenneth Bulmer: Grabschmaus |(Under the Tombstone)|: Auf der Suche nach einem Nervenkitzel gerät eine Gruppe gelangweilten Jungvolks nicht zufällig auf einen Friedhof.
– David A. Riley: Der Eroberer |(The Farmhouse)|: Was der grausig geendete Künstler in dem alten Haus fand, wartet dort immer noch auf unvorsichtige Besucher.
– W. T. Webb: Hirngespinste |(Phantasmagoria)|: Seiner Warnung vor dem Beginn einer Invasion aus der 7. Dimension will niemand Glauben schenken.
– Bryan Fortey: Tivoli-Terror |(Prison)|: Auf dem Gelände eines verlassenen Vergnügungsparks hat eine bizarre, mörderische Parallel-Gesellschaft eingenistet.
– Julia Birley: Die Lauernden |(The People Down Below)|: Beunruhigende Ereignisse werfen die Frage auf, ob die Etage unter der Wohnung tatsächlich leer steht.
– Michael G. Coney: Das Tal des Schicksals |(The Hollow Where)|: Als er sein verpfuschtes Leben gegen seine Wunschexistenz austauschen kann, kommt Farmer Ed zu einer unerfreulichen Erkenntnis.
|Die Vergangenheit der gruseligen Gegenwart|
Seit jeher kämpft die Phantastik mit vielen Vorurteilen. Zu den weniger dramatischen gehört der Vorwurf, sie beschränke sich auf die Beschwörung längst altertümlich gewordener Schrecken. Vampire im schwarzen Umhang, Monster mit Elektroden im Hals, Trolle unter der Brücke: Was hatten diese Schreckgestalten einer abergläubischen Vergangenheit hoch im 20. Jahrhundert, das u. a. durch zwei Weltkriege nie gekannte Schrecken real werden ließ, für eine Existenzberechtigung?
Die Befürworter der Phantastik antworteten diesen Kritikern nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Sie standen richtig auf dem Standpunkt, dass der Horror – sei es in seiner rein unterhaltenden Form oder als spielerische Beschäftigung mit dem Grauen der Gegenwart – sehr wohl mit der Zeit gegangen war. Die alten Schreckgespenster hatten ihre Nischen gefunden, und neue, auf sehr moderne Weisen für Grusel sorgende Phantome hatten sich an ihre Seiten gestellt.
„New Writings in Horror and the Supernatural“ lautete recht trocken aber dadurch beinahe akademisch der Titel einer Anthologie, die der noch junge und engagierte David A. Sutton 1971 herausgab. Er hatte eine Reihe aktuell aktiver Autoren angeschrieben und um exklusive Beiträge für eine Sammlung von Gruselgeschichten gebeten, die in der Gegenwart angesiedelt waren.
|Hehres Ziel, harte Realität|
Man sollte allerdings dieses Projekt literarisch nicht gar zu hoch aufhängen. „New Writings …“ erschien als kaum 160-seitiges Taschenbuch und wurde von einem nur mäßig engagierten Verlag im Gesamtprogramm versteckt. Ernüchtern musste auch die Qualität der eingegangenen Storys, die sich in der Regel reiner Horror-Routinen bedienten. Erstaunen konnte dies eigentlich nicht, da auf Suttons Liste einige zeitgenössische Fließband-Autoren standen.
Zu ihnen gehörte Edwin Charles Tubb (1919-2010), der sich im Laufe eines mehr als ein halbes Jahrhundert währenden Vielschreiber-Laufbahn ca. 50 Pseudonyme bediente. Allein seine 1967 begonnene Serie um den raumfahrenden Abenteurer Earl Dumarest umfasst 37 Bände. „Der letzte Hexensabbat“ ist eine unfertig wirkende, wohl aus dem Ärmel des Schreibarms geschüttelte Story, die unerhört aufwändig von den Vorbereitung besagten Sabbats durch junge, bilderstürmerische Filmleute erzählt; mit einem simplen Schlussgag bricht die Story plötzlich ab und lässt den Leser irritiert zurück.
Von der Erzählstruktur gelungener aber inhaltlich hart zwischen Schreibökonomie und Flachsinn manövrierend ist „Grabschmaus“ von Henry Kenneth Bulmer (1921-2005), der sogar noch produktiver als Tubb war und diesen u. a. (als „Alan Burt Akers“) mit einer 53-bändigen Serie um den Seemann Dray Prescott, der auf fremden Planeten aufregende Abenteuer erlebte, in den Schatten stellt. Auch seine Story ist auf ihren Finaleffekt getrimmt, der sich freilich allzu früh ankündigt und höchstens durch den Verzicht auf die üblichen Verdächtigen – Vampire und Ghule – überrascht.
|Neue Zeiten mit losen Sitten|
Schon in diesen beiden Storys fällt ein deutlicher Anstieg der Spannungsfaktoren Gewalt bzw. Ekel und Sex auf. 1971 war (scheinbar) Schluss mit dem schattenhaften Spuk. Das Jenseits manifestierte sich nun handfest und äußerte einst nur verschämt angedeutete Begierden mit nie gekannter Deutlichkeit. Schnell entstanden neue Klischees: Junge Frauen – immer noch „Mädchen“ genannt – kleiden sich aufreizend und sind willig, junge Männer rücksichtslos und ungehobelt, und alle zusammen sind sie geil und potenziell gefährlich: Aus den „Rebellen“ der 1950er Jahre wurden für eine konservative, vorurteilsreiche, erschrockene Gesellschaft die „Chaoten“ der (nicht nur) „Swinging Sixties“. Bryan Forteys „Tivoli-Terror“ erschien 1971. In diesem Jahr kam Stanley Kubricks „Uhrwerk Orange“ in die Kinos, der grandios auf die Spitze trieb, was Fortey höchstens andeutete bzw. als simplen Schauereffekt für seine Story ausbeutete.
Wie eine moderne und sich dabei nicht an angebliche Moralverstöße anbiedernde Geschichte aussehen konnte, zeigte Robin Smyth alias Robbie Smith, der 1971 ein überaus aktiver Autor war und hauptsächlich Hörspiele für das Radio und Drehbücher für das Fernsehen schrieb. „Der unrühmliche Aufstieg des Katzenfleischhändlers“ ist geschmacklos aber witzig; die nicht nur kannibalischen, sondern auch inzestösen Elemente der vollständig gespensterfreien Handlung werden ebenso drastisch wie elegant in ihren Dienst gestellt; ein wenig fühlt man sich sogar an Lord Dunsany und – sicher nicht unbeabsichtigt – seinen kleinen, fiesen Klassiker „Zwei Flaschen Würze“ (1932) erinnert.
Mit dieser Reminiszenz fährt Smith deutlich besser als David A. Riley (*1951), der ein wenig inspiriertes H.-P.-Lovecraft-Pastiche vorlegt. David Guy Compton (*1930) bleibt sehr klassisch; seine „Satansbrut“ könnte auch im Jahre 1871 problemlos funktionieren, da sich der Verfasser klug auf das Wesentliche beschränkt und den menschlichen Faktor des Phänomens Horror betont: Bosheit ist ein besserer Zünder für Gräueltaten als übernatürliches Wirken, das deshalb oft nur begleitend oder die Untat ausführend geschildert wird.
Ebenso gern gesellt sich zum Grauen der Wahnsinn; er sollte jedoch – siehe Robin Smyth – effektvoller ausgereizt werden als in der müden, einmal mehr auf einen finalen Knalleffekt ausgerichteten Story von W. T. Webb. Julia Birley (*1928) macht es besser: Der Absturz in den Wahn ist bei ihr ein langsamer Prozess, der logisch in einen blutigen Höhepunkt mündet.
Aus dem Rahmen dieser Sammlung bzw. diese dadurch ergänzend fällt die Erzählung von Michael G. Coney (1932-2005). Horror wird bei ihm zur Phantastik, Gewalt und plakatives Grauen fallen aus und werden durch Stimmung ersetzt. Das Ergebnis überzeugt und straft den (deutschen) Titel Lügen: Diese Sammlung bietet mehr als das Splatter-Solo eines Kannibalen.
|Deutscher Horror-Fan – dummer Horror-Fan|
„New Writings in Horror and the Supernatural“ erschien 1976 in Deutschland. Ein mögliches Wiedererkennen wurde erschwert, indem der Sammlung u. a. ein denkbar schwachsinniger Titel aufgeprägt wurde: Sicherlich konnte keiner der intellektuell auf Kurzrasenniveau vegetierenden deutschen Grusel-Leser einem Locktitel wie „Solo für einen Kannibalen“ widerstehen! Ein entsprechendes, also mit dem Inhalt überhaupt nicht in Beziehung zu bringendes (aber schön buntes) Titelbild rundete den gewünschten Trash-Eindruck ab.
Da der Pabel-Verlag seine Taschenbücher 1976 auf 146 Seiten normierte, wurden zu schlechter Letzt einige Geschichten der englischen Vorlage, die diese Vorgabe gesprengt hätten, einfach weggelassen. Es fehlen:
– Richard Davis: |The Time of Waiting|
– R. W. Mackelworth: |Mr. Nobody|
– David Rome: |Charley’s Chair|
– Ramsey Campbell: |Broadcast|
Gestrichen wurde selbstverständlich auch David Suttons Einleitung. Profitdenken, Ignoranz und Hochmut haben viele Gesichter. Dank des genannten Verlags lernen wir wieder einige kennen.
_Herausgeber_
In der englischen Horrorliteratur besitzt sein Name einen guten Klang: David A. Sutton, 1944 geboren, aufgewachsen und noch heute lebend in Birmingham, hat ihn weniger als Schriftsteller erworben; sein Werk ist schmal und beschränkt sich auf allerdings vorzügliche Kurzgeschichten, die seit den 1960er Jahren in vielen Anthologien veröffentlicht wurden.
Wesentlich prominenter ist Sutton als energischer Herausgeber des Magazins „Fantasy Tales“ (1977-1991, mit Stephen Jones) und Anthologien geworden, wofür er 1994 mit einem „British Fantasy Society Special Award“ und einem „World Fantasy Award“ (für „Fantasy Tales“) sowie mit inzwischen zwölf „British Fantasy Awards“ ausgezeichnet wurde.
|Taschenbuch: 145 Seiten
Originaltitel: New Writings in Horror and the Supernatural: No. 1 (London : Sphere Books 1971)
Übersetzung: Helmut Pesch|
[www.vpm.de]http://www.vpm.de
[avidasutton.co.uk]http://davidasutton.co.uk
Bill Knox – Spanische Dukaten

Bill Knox – Spanische Dukaten weiterlesen
Colin Harvey – Gestrandet

Colin Harvey – Gestrandet weiterlesen
Bill Knox – Der Mann in der Flasche

Bill Knox – Der Mann in der Flasche weiterlesen
Ketchum, Jack/McKee, Lucky – Beuterausch
_Das geschieht:_
Christopher Cleek ist ein König in seiner Kleinstadtwelt. Als Anwalt zieht er skrupellos die Fäden so, dass er am Ende finanziell stets besser dasteht als seine Klienten. Sein wahres Gesicht in aller Hässlichkeit zeigt Cleek jedoch nur in seinem bedacht abgelegen errichteten Haus. Dort tyrannisiert er seine Familie, die ihm aufs Wort zu gehorchen hat. Gattin Belle hat er längst gebrochen, sodass er nachts problemlos Tochter Peggy vergewaltigen und schwängern kann: Niemand wird reden – auch die fünfjährige Darlene nicht und ganz bestimmt nicht Sohn Brian, der den Sadismus des Vaters längst verinnerlicht hat.
Wenn er sich erholen will, geht Cleek gern auf die Jagd. Der Wald des US-Staates Maine ist riesig und wildreich. Dieses Mal geht dem Anwalt eine ganz besondere Beute ins Netz – eine verwilderte Frau, die letzte eines Stammes von Menschenfressern, der viele Jahre Angst und Schrecken verbreitet hatte, bis er ausgerottet wurde. Die Frau konnte flüchten. Sie ist verletzt und allein, weshalb Cleek sie zu überwältigen vermag.
Er ist fasziniert von dem starken Wesen, das ihn nicht fürchtet. Für Cleek liegt der Reiz darin, diesen Willen zu brechen. Deshalb richtet er im Keller seines Hauses ein Gefängnis ein und beginnt, sein Opfer zu ‚zähmen‘. Dabei bezieht er die Familie ein, die ihm wie üblich zu Willen ist. Die Frau ist trotz ihrer Fesseln jedoch keineswegs hilflos. Sie wartet geduldig auf ihre Chance, die kommt, als Cleek die Kontrolle über die Situation zu entgleiten beginnt. Der pubertierende Brian bedrängt die Gefangene immer offensiver, was Belles lange unterdrückten Widerstandswillen weckt. Als eine Lehrerin auftaucht, die Peggys Zustand erkannt hat, verliert Cleeks jegliche Hemmungen. Er lässt seine Hunde los. Um Vater und Sohn Einhalt zu gebieten sowie die kleine Schwester zu beschützen, wendet sich Peggy an ihre einzige Verbündete: Sie lässt die Frau frei, die umgehend zur mörderischen Tat schreitet und in deren Verhaltenskodex Begriffe wie Vergebung oder Dankbarkeit unbekannt sind …
|Menschenfresser mit Vorgeschichte/n|
1980 ließ Jack Ketchum erstmals die US-amerikanische Version der „Sawny-Bean“-Sippe wüten, die wie ihre schottischen Vorfahren aus dem 15. Jahrhundert als Clan in der Wildnis hauste und sich von unvorsichtigen Reisenden (und später Touristen) ernährte. „Off Season“ (dt. „Beutezeit“) hieß das tugendwächterseits schockiert und zornig zur Kenntnis genommene sowie heftig entschärfte Werk, das selbstverständlich umgehend berühmt & berüchtigt wurde, aber erst zwei Jahrzehnte später in seiner unzensierten Form erscheinen durfte. 1991 legte Ketchum mit „Offspring“ (dt. „Beutegier“) ähnlich drastisch nach.
Im 21. Jahrhundert haben sich die Gemüter einerseits beruhigt, während die Messlatte in Sachen Scheußlichkeit seit 1980 andererseits angehoben wurde. Jack Ketchum gilt inzwischen als anerkannter Meister eines Horrors, der sich nicht in Schnetzel-Splatter erschöpft, sondern Licht in die unerfreulich dunklen Bereiche der menschlichen Seele wirft: So sind ’seine‘ Kannibalen zwar grausam, dies aber nicht aus selbstzweckhaftem Vergnügen, sondern als Folge eines harten, unmittelbaren Lebenskampfes. Demgegenüber zeigen die ‚zivilisierten‘ Menschen moralische Schwächen, was sie, die es besser wissen müssten, vorsätzlich brutal und grausam handeln lässt. Diese gemeinsame, auch in der modernen Gegenwart keineswegs überwundene Gewaltbereitschaft thematisierte Ketchum in vielen anderen Romanen, darunter im deprimierend eindrucksvollen „The Girl Next Door“ (dt. „Evil“), der auf einer wahren Geschichte basiert.
Nachdem diese Seite des einst verteufelten Jack Ketchum anerkannt war, wurde der kultige Geheimtipp allmählich vom Mainstream entdeckt und damit auch geschäftlich interessant. 2006 wurde Hollywood aufmerksam, was binnen kurzer Zeit eine ganze Serie auf Ketchum-Werken basierender Filme nach sich zog. Schon 2009 inszenierte Andrew van der Houten „Beutegier“ und blieb dabei so konsequent, dass zumindest der Nerv der deutschen Zensur empfindlich getroffen wurde, was die üblichen Scherenschläge zur Folge hatte.
|Die Kannibalen von Maine – Version 2.0|
Zur Schar der Ketchum-Bewunderer gehört der Regisseur und Drehbuchautor Edward „Lucky“ McKee. 2005 produzierte er „The Lost“ und lernte dabei den Schriftsteller kennen. Es entwickelte sich nicht nur eine Arbeitsbeziehung, sondern eine Freundschaft. 2009 setzte McKee „Red“ (dt. „Blutrot“) selbst in Szene. Das nächste gemeinsame Projekt wurde eine ‚inoffizielle‘ Fortsetzung der „Off-Season“-Saga. Ketchum und McKee schrieben sie gemeinsam als Drehbuch und als Roman zum Film, der 2011 als „The Woman“ ins Kino kam.
Chronologisch schließt die Handlung lose an die bekannte Vorgeschichte an. Der Kannibalen-Clan, dessen Attacken die ersten beiden Romane beschrieben, ist bis auf eine einzige Überlebende ausgelöscht. „The Woman“ dreht deshalb die bisher typische Konstellation um und lässt nicht einen Menschen unter Menschenfresser, sondern eine Kannibalin unter Barbaren geraten. Überhaupt ist „The Woman“ ein Spiegel der Vorgeschichte: Handlung und Figurenzeichnung erschöpfen sich unter bloßer Verkehrung ihrer Ausprägung in der Nacherzählung banaler Horror-Elemente.
Wohl nicht grundlos hatte Ketchum selbst bisher auf eine Fortsetzung verzichtet, nachdem er aus dem Thema herausgeholt hatte, was interessant und aufregend war. Die erschütternd konventionelle Schauermär „The Woman“ wurde wohl nicht von ihm, sondern von McKee geprägt: Mit einer dem Roman angehängten Kurzgeschichte („Das Vieh“) belegt Ketchum, dass er der Story durchaus noch neue und provozierende Aspekte abgewinnen kann.
|Erschreckend aber nicht schockierend|
Im Vergleich dazu ist die Rezeptur, nach der „The Woman“ zubereitet wurde, allzu offensichtlich. Grundsätzlich werden „Beutezeit“ und „Beutegier“ mit „Evil“ gemischt. Im Keller baumelt zwar dieses Mal kein Aschenputtel, sondern eine wehrhafte Kannibalen-Frau, doch bis sie vom Haken los ist, wird sie kräftig gedemütigt, gefoltert und geschändet. Dies wird mit dem endgültigen Niedergang einer beschädigten Familie verquickt, deren Geschichte sich aufdringlich in den Vordergrund schiebt, bis die Frau aus dem Wald zur Statistin degeneriert. Sie ist ohnehin nur der Katalysator für die Selbstzerfleischung der Cleeks. Das echte Duell zwischen der Frau und Cleek fällt aus, die direkte Konfrontation kommt viel zu kurz.
Dabei geizen die Autoren nicht mit den üblichen „Ab-18“-Grusel- & Nackedeien, mit denen im Kino gern Fließband-Horror aufgepeppt wird. Dass sich höchstens Ekel aber niemals Entsetzen einstellen will, liegt sicherlich auch in der Tatsache begründet, dass selbst die gefesselte Kannibalen-Frau niemals ein hilfloses Opfer ist. Diese Rolle spielt Peggy, die zur Hauptrolle wenig taugt. Zwar behaupten Ketchum & McKee eine unsichtbare Kette zwischen Tochter und Vater, aber diese zerreißt ganz nebenbei und war offenbar nie wirklich wichtig.
Statt sich auf die Cleek-Familie und ihre Gefangene zu konzentrieren, fügt das Autorenduo einen Handlungsstrang um eine empathische Lehrerin ein. Sie hat mit ihren eigenen Sorgen und Nöten in dieser Geschichte nichts verloren. Selbst als zusätzliches Opfer ist sie überflüssig; ein Cleek hätte diese Rolle problemlos übernehmen können. Das Finale ist verworren genug; da bekriegen sich nicht nur Kannibalin und Cleeks, es stoßen auch noch böse Hunde und ein Reserve-Monster hinzu. Wen wundert’s, dass der angeblich so starke, schlaue, mächtige Cleek in einem Halbsatz sang- und klanglos aus der Handlung ausscheidet? Er war seiner ‚Gefangenen‘ nie ein echter Gegner.
Das eigentliche Ende ist ebenfalls weder schockierend noch überraschend, sondern läuft vor allem auf eine Fortsetzung hinaus: Die Kannibalen-Sippe wird neu gegründet. Dafür wird die Wahrscheinlichkeit, die mit der Spannung längst auf dem Boden liegt, noch einmal kräftig mit Füßen getreten. Der Leser kann sich glücklich schätzen, dass Ketchum noch einmal aktiv wird, um dem enttäuschenden Gemeinschafts-Roman mit der schon erwähnten Story eine kräftige Coda anzuschließen. Sie versöhnt wenigstens ansatzweise mit dem glatten Als-ob-Terror der Hauptgeschichte.
_Autor_
Das Pseudonym „Jack Ketchum“ wählte Dallas William Mayr (geb. 1946) nach eigener Auskunft nach dem Vorbild des Wildwest-Outlaws Thomas „Black Jack“ Ketchum, der es Ende des 19. Jahrhunderts sogar zum Anführer einer eigenen Bande – der „Black Jack Ketchum Gang“ brachte, letztlich jedoch gefangen und aufgehängt wurde. Im Vorwort zur deutschen Erstausgabe von „The Girl Next Door“ (dt. „Evil“) weist Stephen King außerdem darauf hin, dass „Jack Ketch“ in England der Spitzname für den Henker war, der Mayr ebenfalls charakterisiert: „Immer klappt die Falltür auf, immer zieht sich die Schlinge zusammen, und auch die Unschuldigen müssen baumeln.“
Der junge Mayr versuchte sich als Schauspieler, Sänger, Lehrer, Literaturagent, Handlungsvertreter usw. – die typische Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Laufbahn à la USA, nur dass Mayr nie wirklich seinen Durchbruch schaffte, da er sich als reichlich sperriger Schriftsteller erwies, der lieber im Taschenbuch-Ghetto verharrte als der Bestsellerszene Mainstream-Zugeständnisse zu machen. Noch heute ist der Autor stolz auf eine Kritik der „Village Voice“, die sein Romandebüt „Off Season“ 1980 als „Gewaltpornografie“ verdammte.
Die Literaturkritik musste Mayr alias Ketchum inzwischen zur Kenntnis nehmen. 1994 gewann seine Story „The Box“ einen „Bram Stoker Award“, was Ketchum 2000 mit „Gone“ wiederholen konnte. Zudem wurde Ketchum mehrfach nominiert. Längst ist auch Hollywood aufmerksam geworden.
|Taschenbuch: 286 Seiten
Originaltitel: The Woman (New York : Leisure Books/Dorchester Publishing 2010)
Übersetzung: Marcel Häußler
ISBN-13: 978-3-453-67615-2
Als eBook: Januar 2012 (Wilhelm Heyne Verlag)
ISBN: 978-3-641-06380-1|
[www.jackketchum.net]http://www.jackketchum.net
[www.randomhouse.de/heyne]http://www.randomhouse.de/heyne
_Jack Ketchum auf |Buchwurm.info|:_
[„Evil“ 2151
[„Beutezeit“ 4272
[„Amokjagd“ 5019
[„Blutrot“ 5488
[„Beutegier“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=6045
[„The Lost“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=6924
[„Die Schwestern“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=6982
Nicholas Blake – Ende des Kapitels
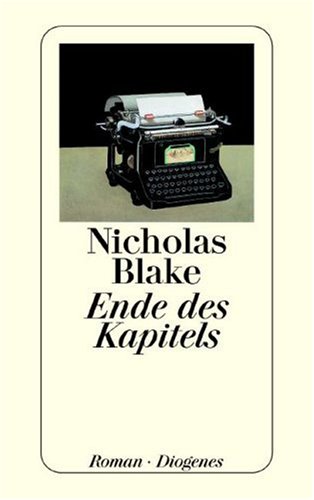
Nicholas Blake – Ende des Kapitels weiterlesen
Lindqvist, John Ajvide – Wolfskinder
_Das geschieht:_
Im Wald findet der gescheiterte Musiker Lennart Cedarström einen lebendig begrabenen Säugling. Er rettet das kleine Mädchen, das seine Aufmerksamkeit erregt, weil es nicht schreit, sondern glockenreine Töne ertönen lässt: Das Kind verfügt über die absolute Stimme.
Cedarström sieht seine Chance zur triumphalen Rückkehr in die Musik. Er beschließt, das Mädchen – dem später der Sohn Jerry den Namen „Theres“ geben wird – quasi zu adoptieren, seine Existenz jedoch den Behörden zu verheimlichen, es von der Außenwelt zu isolieren und zu einer perfekten Sängerin zu dressieren.
Wie üblich beugt sich Cedarströms labile Lebensgefährtin Laila ihm, zumal sie Theres allmählich liebgewinnt. Das ist keineswegs einfach, da dieses Kind kaum Emotionen an den Tag legt und stets wörtlich nimmt, was man ihr sagt. Auf diese Weise können ihre ‚Eltern‘ sie zwar kontrollieren, doch sie ziehen ein gefühlskaltes Wesen heran, das eines Tages ihr Verderben wird.
Anderenorts wächst die junge Teresa heran. Sie ist ein einsames, unglückliches Kind, das von ihren Eltern nicht verstanden und von den Klassenkameraden gemobbt wird. In Theres, die inzwischen bei ihrem ‚Bruder‘ Jerry lebt, meint sie eine verwandte Seele zu erkennen. Auf ihre verquere Art will Theres tatsächlich helfen. Gemäß ihrer Philosophie ist des Todes, wer sie bedroht. Diese Lehre gibt sie an Teresa und eine wachsende Schar junger Mädchen weiter, die ebenfalls Außenseiter sind.
Ihr Gesangstalent gibt Theres die Möglichkeit, möglichst viele ‚Feinde‘ an einem Ort zu versammeln. Ein öffentlicher Bühnenauftritt soll ihr und ihrem ‚Rudel‘ die Möglichkeit geben, es der gleichgültigen Gesellschaft heimzuzahlen …
|Unter trügerisch ruhiger Oberfläche|
Seit jeher werden viele Köpfe über der Frage zerbrochen, wann oder gar ob der Mensch ‚zivilisiert‘ geworden ist. Man kann es angesichts spektakulärer technischer oder wissenschaftlicher Leistungen glauben, und auch das Element der Nächstenhilfe wird erkennbar, wenn sich mit Milchpulver und Aspirin beladene Flugzeuge und Lastwagen dorthin auf den Weg machen, wo sich wieder einmal ein Erdbeben oder eine Flut ausgetobt haben.
Doch die Antwort auf genannte Frage sowie die Definition von Zivilisation gestaltet sich schwieriger, wenn man nicht die Ausnahme, sondern den gesellschaftlichen Normalzustand als Maßstab nimmt. Hier hat der Barbar im Menschen auch im 21. Jahrhundert offensichtlich mehr als eine Nische gefunden. Sein Wirken wird verwaltet, gemaßregelt und verschwiegen, er ist aber präsent und springt hervor, wenn allzu großer Druck die Grenzen seines Territoriums sprengt.
John Ajvide Lindqvist schrieb und veröffentlichte „Wolfskinder“ 2010 und damit ein Jahr vor dem Amoklauf des Anders Behring Breivik, der in Oslo und auf der norwegischen Ferieninsel Utøya 77 Menschen umbrachte. Zwischen Buch und Amoklauf gibt es somit keine direkte Verbindung, und man sollte mögliche Parallelen weder überbewerten noch nachträglich auf das Romangeschehen projizieren. In einem Punkt gibt es allerdings eine echte Überschneidung. Zwar sind seine „Wolfskinder“ nicht politisch motiviert und verblendet, doch sie geraten in einen Teufelskreis, die sie in ihrer eigenen, verzerrten Welt isoliert, wo sie die Signale der Realität zunehmend falsch interpretieren, ihren Zorn und ihrer Frustration aufstauen und schließlich in mörderischer Gewalt explodieren.
|Die Fremden unter uns|
Das Verdrängen und Unterpflügen nicht gesellschaftskonformer Individuen ist ein düsteres Erbe aus uralter Zeit: Wer nicht mit der Meute heulen kann oder will, wird von ihr verschlungen. Die Mehrheit geht schweigend unter. Manchmal lassen die Umstände eine Theres oder eine Teresa (oder einen Breivik) entstehen. Diesem Mechanismus, dem „Drehen der Schraube“, wie Henry James es bereits 1898 bildhaft in Worte fasste, geht Lindqvist auf den Grund. Das Ergebnis ist ein Horror-Roman, gegen dessen realistische Schrecken kein Zombie und kein Vampir ankommen.
Ignoranz, Missbrauch, Mobbing, Eifersucht, Gier, Bosheit, Eigennutz: Grundsätzlich sind es die klassischen sieben Todsünden, die Lindqvist mit deprimierendem Einfallsreichtum modernisiert und abwandelt. Eltern, Lehrer, Polizisten, Politiker, Priester: Sie alle werden in einem Alltag, der wie ein Mahlwerk wirkt, so zerrieben und ausgelaugt, dass sie nicht merken, welches Unheil in ihrer Mitte entsteht, und unterschätzen, welches Unheil sie quasi selbst heranzüchten.
Das klassische Wolfskind wurde angeblich im Säuglingsalter ausgesetzt oder ist auf andere Weise in die Wildnis geraten. Dort wird es von wilden Tieren – im europäischen Kulturkreis meist Wölfen – aufgezogen und nimmt deren Verhalten an. Später wird das Findelkind entdeckt und muss mühsam zum Menschsein erzogen werden, was niemals vollständig gelingt. Wissenschaftlich belegbare Fälle sind rar; sie regen die Fantasie des Menschen an, die ideenreich für ‚Fakten‘ sorgt; Romulus und Remus, die mythischen Gründer Roms, sollen von einer Wölfin aufgezogen worden sein, in der modernen Literatur taucht das „wilde Kind“ als Mowgli oder Tarzan auf.
|Auf beiden Seiten des Spiegels|
Lindqvist konfrontiert uns mit modernen Wolfskindern. Sie wachsen unter Menschen auf und sind doch einsam. Die Gefahr entsteht aus der Negierung durch eine Gesellschaft, die sie ignoriert und ausschließt. Theres, Teresa und ihre Gefährtinnen finden daraufhin zu einer Parallel-Gesellschaft mit eigenen Regeln zusammen. Sie bilden ein „Rudel“ und identifizieren sich dabei in fehlgeleiteter Faszination mit DEM Symbol der wilden, ungebändigten Kreatur: dem Wolf, der gleichzeitig bedingungslose Solidarität zu den Angehörigen seines Rudels beweist.
Teresa steht für die ‚menschliche‘ Seite dieser ‚Auswilderung‘. Lindqvist gelingt die bemerkenswert dichte Darstellung einer alltäglichen Hölle, die von außen als normales Schuldasein durchgeht. Tatsächlich wird Teresa auf erfinderisch boshafte und bösartige Weisen gepeinigt, gemobbt und schließlich in den Wahnsinn getrieben.
Theres repräsentiert das übernatürliche Element dieser Geschichte. Lindqvist thematisiert ihre mysteriöse Herkunft nicht, aber Theres erinnert an die Hauptfigur der Erzählung „Grenze“ (2006 erschienen in der Story-Sammlung „Im Verborgenen“), die erkennt, dass sie kein Mensch ist, sondern zu den höchstens menschenähnlichen „Anderen“ gehört, die in einer Art Parallelwelt existieren.
Lindqvist postuliert zufällige Schnittpunkte zwischen der hiesigen und der anderen Welt. Schon in „So finster die Nacht“ (2004) hatte er sie miteinander konfrontiert und dabei eine generelle Unverträglichkeit mit meist üblen Folgen festgestellt. In „Menschenhafen“ (2008) hatte er das Konzept verfeinert, beschränkte sich aber weiterhin klug auf Andeutungen. Auch „Wolfskinder“ bringt beileibe kein Licht in dieses Rätsel.
|Das Zeigen der Instrumente|
Eine besondere Ironie liegt in der Tatsache, dass die Unmenschlichkeit von Theres zu einem Gutteil andressiert ist: Womöglich wäre selbst aus dem ‚anderen‘ Wechselbalg ein halbwegs angepasstes Menschenkind geworden, hätten seine selbsternannten Eltern es nicht systematisch von der Gesellschaft ferngehalten und in dem Glauben erzogen, alle anderen Menschen trachteten ihm nach dem Leben. Nicht Theres‘ Gefühlskälte aber ihre mangelhafte Anpassungsfähigkeit ist hausgemacht, was ihrem Verhalten eine verhängnisvolle Konsequenz verleiht.
Die Gefahr liegt im Grunde ’nur‘ in einem Hirn, das nach dem Prinzip der Wortwörtlichkeit arbeitet. In der modernen Gesellschaft, die zu einem guten (bzw. schlechten) Teil auf Übertreibung und Lüge aufbaut, muss dies Folgen haben. Der mit allen Wassern gewaschene Musikproduzent Max Hansen nimmt vor allem deshalb ein böses Ende, weil er sich außerstande ist zu begreifen, dass es Menschen wie Theres gibt, die sich durch Schmeicheleien, Unwahrheiten oder Drohungen nicht beeinflussen lassen, sondern entsprechende Versuche geradezu alttestamentarisch, d. h. direkt und blutig ahnden.
|Wasser und Säure|
Womöglich hätten Theres und Teresa einsame, unglückliche Leben geführt, wären sie nicht zusammengekommen. Damit kam zueinander, was keinesfalls zueinander hätte finden dürfen, weil es im Negativsinn zu perfekt passt: Durch Teresa findet Theres aus ihrer Isolation in die Welt hinaus, wo sie weitere ‚Jüngerinnen‘ finden und ‚befreien‘ kann. Durch Theres findet Teresa die Kraft, sie zu unterstützen und dabei eigene Fesseln abzuwerfen.
Dabei liegen sie nie wirklich auf einer Wellenlänge. Theres ist nicht ‚böse‘. Als sie ihr ‚Rudel‘ schult, will sie wirklich helfen. Allerdings hilft sie auf ihre Weise, was zur finalen Katastrophe führt. Teresa ist menschlich und deshalb bewusst böse. Ihre Frustration im realen Leben reagiert sie an noch Schwächeren u. a. als „Troll“ in Internet-Foren ab und ist geht dabei ähnlich planvoll und tückisch vor wie ihre Schulfeindinnen. Das Böse – so Lindqvists Fazit – benötigt keine Unterstützung aus dem Jenseits. Der Mensch erschafft, nährt und verbreitet es selbst perfekt.
Ihre Sogwirkung erhält diese Geschichte daher nicht durch das Wüten übernatürlicher Kreaturen. Nicht einmal die zahlreichen Bluttaten sind wirklich wichtig. „Wolfskinder“ fesselt – und deprimiert – als spannender Trip durch eine reale Hölle. Es gibt keine Rettung, nicht einmal Erlösung, es endet in sinnlosem Elend. Nicht einmal das von den amoklaufenden Mädchen befreite Zoo-Wolfsrudel mag sich ihnen anschließen. Die Freiheit, die Theres meint, funktioniert in der Menschenwelt nicht.
_Autor_
John Ajvide Lindqvist wurde 1968 in Blackeberg, einem Vorort der schwedischen Hauptstadt Stockholm, geboren. Nachdem er schon in jungen Jahren als Straßenmagier für Touristen auftrat, arbeitete er zwölf Jahre als professioneller Zauberer und Comedian.
Sein Debütroman „Låt den rätte komma” (dt. „So finster die Nacht“), eine moderne Vampirgeschichte, erschien 2004. Bereits 2005 folgte „Hanteringen av odöda“ (dt. „So ruhet in Frieden“), ein Roman um Zombies, die in Stockholm für Schrecken sorgen. „Pappersväggar” (2006; dt. „Im Verborgenen“) ist eine Sammlung einschlägiger Gruselgeschichten. Lindqvist schreibt auch Drehbücher für das schwedische Fernsehen. Das prädestinierte ihn dafür, das Script für die erfolgreiche Verfilmung seines Romanerstlings zu verfassen, die 2008 unter der Regie von Tomas Alfredson entstand. Schon 2010 drehte Matt Reeves ein ebenfalls gelungenes US-Remake unter dem Titel „Let Me in“.
Als Buchautor ist Lindqvist in kurzer Zeit über die Grenzen Schwedens hinaus bekannt geworden. Übersetzungen seiner Werke erscheinen in England, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Polen und Russland.
|Paperback: 557 Seiten
Originaltitel: Lilla stjärna (Stockholm : Ordfront Förlag 2010)
Übersetzung: Thorsten Alms
ISBN-13: 978-3-7857-6056-7
eBook-Download: Oktober 2011 (Lübbe Verlag)
ISBN-13: 978-3-8387-1036-5|
[johnajvide.com]http://johnajvide.com
[www.luebbe.de]http://www.luebbe.de
_John Ajvide Lindqvist bei |Buchwurm.info|:_
[„So finster die Nacht“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=5218
[„So ruhet in Frieden“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=5364
[„Menschenhafen“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=5938
[„Im Verborgenen“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=6512
Dorothy L. Sayers – Ärger im Bellona-Club
Der alte General Arthur Fentiman besitzt nicht nur die Rücksichtslosigkeit, im Salon des ehrwürdigen Bellona-Clubs zu London das Zeitliche zu segnen. Sein Tod ruft außerdem die Justiz auf den Plan, denn beinahe zeitgleich verblich Lady Felicity Dormer, Arthurs Schwester, die ebenfalls betagt sowie ungemein vermögend war. Mindestens eine halbe Million Pfund sind im Topf, doch wer wird sie erben? Das Geld der Lady sollte an den Bruder fallen und würde nunmehr an dessen überlebenden Nachkommen, die Enkel und Brüder George und Robert Fentiman, gehen. Ist der General jedoch vor seiner Schwester gestorben, erbt Ann Dorland, Lady Felicitys Gesellschafterin und Quasi-Tochter. Dorothy L. Sayers – Ärger im Bellona-Club weiterlesen
Downs, Tim – Totenwache
_Die |Nick Polchak|-Romane:_
(2003) Fliegenfutter |(Shoofly Pie)| – Goldmann TB 46527
(2004) Totenwache |(Chop Shop)| – Goldmann TB 46528
(2007) |First the Dead|
(2008) |Less Than Dead|
(2009) |Ends of the Earth|
(2011) |Nick of Time|
_Das geschieht:_
Die Karriere der Pathologin Dr. Riley McKay will am Rechtsmedizinischen Institut von Allegheny County im US-Staat Pennsylvania nicht recht in Gang kommen. Dr. Nathan Lassiter, ihr Chef, nutzt sie aus und verbietet ihr, an bestimmten Obduktionen teilzunehmen. Letzteres erregt ihre Neugier. Riley beschafft sich einige auf diesen Leichen gesammelte Insekten und bittet Dr. Nicholas Polchak um Hilfe.
Der forensische Entomologe lehrt als Dozent an der North Carolina State University und genießt zumindest fachlich einen guten Ruf. Privat ist Polchak ein kritisch denkender Exzentriker, dem seine Forschung über alles geht und der nicht bereit ist, sich als gut geschmiertes Rädchen in die Universitätsmaschine einfügen zu lassen.
Da Polchak sich quasi auf Anhieb in die nicht nur kluge, sondern auch schöne Riley McKay verliebt, ist er bereit, ihr bei den Ermittlungen zu helfen. Weil er dabei ebenso unorthodox wie erfolgreich vorgeht, werden schnell Lassiters Verbindungen zu einer aufstrebenden Firma namens „PharmaGen“ offenbar. Dort will man Medikamente entwickeln, die speziell auf das Genom von Kranken abgestimmt werden und dadurch besonders gut wirken.
Doch „PharmaGen“ steckt in finanziellen Schwierigkeiten, denn die Vorarbeiten ziehen sich hin. Dies macht die Firma anfällig für die Einflüsterungen des manipulativen Dr. Julian Zohar, der als Geschäftsführer der Koordinationsstelle für Organbeschaffung in Pittsburgh seit Jahren darum bemüht ist, die Organspende-Bereitschaft seiner Mitmenschen zu erhöhen. Da er damit erfolglos blieb, ging Zohar zu unredlichen Methoden über. Er hat sich der Dienste einiger skrupelloser Schergen versichert, die ‚Spender‘ auf offener Straße überfallen und ihrer wertvollen Organe berauben. Zohar verkauft sie für viel Geld reichen aber kranken und schweigsamen Zeitgenossen. Schnüffler wie Polchak und McKay sind schlecht fürs Geschäft, und Zohar macht sich Gedanken, ob und wie er sie am schnellsten ausschalten kann …
|Nicht allzu ausführliche Körperwelten|
Ein Kriminalroman mit zwei Forensikern in den Hauptrollen, von denen der eine sich der Erforschung leichenfleischhungriger Insekten verschrieben hat: Erwarten ‚durfte‘ man den Versuch, die „CSI“-gestählte Leserschaft durch die neuerlich auf die Spitze getriebene Schilderung verwesungsbedingter Scheußlichkeiten aufmerksam zu machen.
Da sogar dieser Fraktion allmählich übel zu werden beginnt, ist es erfreulich zu erfahren, dass Tim Downs sich in diesem Punkt zurücknimmt. Detaillierte Leichenschauen sind in diesem zweiten Teil seiner Serie um den Entomologen Nick Polchak weder Selbstzweck noch ein Drehen an der Ekel-Schraube, sondern nur dort angesagt, wo sie der Story dienen.
Der zynische Rezensent könnte nun einwenden, dass dies der erste deutliche Hinweis auf einen zwar routinierten aber gleichzeitig glatten, seine Leser etwas zu offensichtlich manipulierenden Krimi ist. Für vor allem unterhaltsame Dutzendware gibt es jedoch ein kopfstarkes Publikum, dem Downs Interesse – wenn auch nicht unbedingt als Krimi-Autor – seit jeher gilt. Er orientiert sich deshalb am US-Fernsehen, dessen Erfolg u. a. auf das möglichst geschickte Neu-Arrangement bewährter Elemente zurückzuführen ist.
|Grissom 2.0 – dieses Mal mit Gefühl|
Dazu gehört die Balance zwischen „Handlung“ und „Hintergrund“: Während das Geschehen seinen Lauf nimmt, wird das Privatleben der Hauptfiguren thematisiert. Auf diese Weise steigert sich die Identifikation zwischen Leser und Figur. Dies funktioniert bei geschickter und wohldosierter Anwendung sogar bei denen, die solche seifenoperliche Einschübe mit Misstrauen betrachten.
Alte Tricks lassen sich verpacken. So hilft es, den Figuren ‚interessante‘ Eigenarten auf den Papierleib zu schreiben. Dabei sollte nicht übertrieben werden. Ein bisschen exzentrisch ist liebenswert, richtig schräg dagegen riskant, weil es das Zielpublikum verschrecken könnte. Also setzt Autor Downs seinem Dr. Polchak eine monumentale Brille auf, die allein ihn bereits optisch vom Gros seiner Mitmenschen absetzt. Ansonsten und trotzdem ist Nick ein Chaot und sanfter Meuterer gegen das Establishment, was ja jeder von uns gern wäre, sich zu sein in der Regel aber nicht traut.
Dazu kommen eine tragische, allmählich enthüllte Familiengeschichte, ein nettes Wesen, das trotz der unkonventionellen Fassade sogar von schönen Frauen wahrgenommen wird, sowie einige gute Freunde, denen Downs den Realismus zugunsten offensiver Schnurrigkeit ausgetrieben hat, was sie stets gut für ulkige Zwischenszenen werden lässt: Fertig ist der kantenfreie Grissom 2.0, der nie irritiert, sondern völlig für sich einnimmt.
Ihm zur Seite steht eine Heldin, die wie schon erwähnt nicht nur schön, sondern auch intelligent bzw. klug ist und die positiven Seiten des zerknautschten Dr. Nick sogleich erkennt. Sie trägt keine dicke Brille, sondern ist mit einem Nierenleiden geschlagen, das den gutherzigen Leser um sie bangen lässt. Zwar ist die nette Riley ein wenig zu steif in Wesen und Charakter, aber Nick lehrt sie, lockerer zu werden, d. h. sich auf Prominenten-Partys einzuschleichen, in die Häuser Verdächtiger einzubrechen oder heimlich Leichen zu untersuchen.
|Immer verdächtig: Krimi mit Moral|
Der Plot bzw. der Fall klingt alarmierend aktuell und authentisch, ist aber tatsächlich völlig abgehoben. Dass ein verrückter aber (selbstverständlich) genialer Nachfahre von Dr. Frankenstein Organtransplantate im Stil des organisierten Verbrechens beschafft, die erforderliche ‚Ware‘ dabei jedoch durch Mord und nach Operation im Straßengraben beschafft werden muss, will einfach nicht logisch klingen und würde nicht nur einer neugierigen Nachwuchs-Pathologin auffallen.
Downs geht es auch nicht um Realismus. Auf der einen Seite findet sich – als Absicht redlich – der Wunsch, eine möglichst spannende Handlung zu kreieren. Dem gegenüber steht das Bedürfnis, dem Publikum außerdem eine Lehre zu erteilen. Tim Downs ist nicht ’nur‘ Autor, sondern auch Missionar. Dies darf man wörtlich nehmen, denn er gehört zu den treibenden Kräften innerhalb des „Campus Crusade for Christ“, einer Bewegung, die christliches Denken und entsprechende Werte in den Köpfen zukünftiger Wissenschaftler verankern will. (Die US-Leser finden „Totenwache“ übrigens im Programm eines auf ‚christliche‘ Literatur spezialisierten US-Verlags.)
Was damit gemeint ist, verdeutlicht u. a. eine ausführliche Unterhaltung zwischen Dr. Nick und einem alten, weisen, gar liebenswürdigen Theologen, in deren Verlauf vermittelt wird, dass Gott dort verortet werden sollte, wo schnöde Fakten das Universum aus jenen Fugen geraten lassen, innerhalb derer die frommen Anhänger eines göttlich-„smarten“ Weltbilds es lieber gebettet sehen. Die Argumentation ist hinterlistig aber in ihrem geschmeidigen Zurechtbiegen der Fakten interessant, für die Handlung hat sie freilich keinerlei Bedeutung.
Zwar trägt Downs nie ganz dick auf, doch er kann und will seinen Hintergrund nicht verleugnen. Das erschwert allerdings die publikumswirksame Annäherung von Dr. Nick und Dr. Riley, die zwar wollen aber nicht können, weil sie Vorbildfunktionen erfüllen müssen. Sie verstecken sich daher hinter scheinbar unverbindlichen Witzeleien (Nick) oder persönlichen Ängsten (Riley) und eiern auf diese Weise viele Kapitel ziellos umeinander. Als es so nicht mehr weitergeht und unkeusche Ferkeleien drohend bevorstehen, löst ein tragisches Ereignis dieses Dilemma.
|Schwach ist der Mensch, schlau das Böse|
Der Teufel tritt heutzutage lieber im Anzug gewandet und ohne Forke auf. Downs gibt sich große Mühe, den Organräuber Zohar nicht als selbstgerechten Schurken, sondern als fehlgeleiteten Menschen darzustellen. Er wollte einst das Richtige und hat sich erst nach dem Scheitern seines Plans entschlossen, den Doppelpfad von Recht und Ethik zu verlassen. Auch dies wird uns im Rahmen einer lehrreichen Diskussion zwischen Polchak und Zohar dargelegt, was wie vorauszusehen mit einem moralischen Sieg des guten Dr. Nick endet, während sein Gegner sich als schlechter Verlierer in Mordankündigungen ergeht.
Damit es im Finale noch ein wenig dramatischer zugeht, enthüllt ein Mitglied von Zohars Mord-und-Ausschlacht-Teams seine schockierende Doppel-Identität. Noch ist der Gipfel der Unwahrscheinlichkeit nicht erklommen, denn nicht das Gesetz, sondern eine Art göttliche Gerechtigkeit richtet (in selbstgerechter Zusammenarbeit mit Dr. Nick) Zohar und seine Strolche. Das soll nach Downs Willen seine Leser bis ins Mark treffen, ist aber vor allem eines: lächerlich.
So scheitert dieser Roman nicht an seiner Plotschwäche oder einem schlechten Stil, sondern am Sendungsbewusstsein seines Verfassers. Downs schreibt gut genug, um erkennbar zu machen, wie er seine Geschichte durch die ihr aufgezwängte Mission erst hemmt und schließlich ruiniert. Das ist interessant zu verfolgen aber dem Krimi-Genuss keinesfalls förderlich.
_Autor_
Die erste Karriere des Tim Downs begann während seiner Studienzeit an der Indiana University. Dort schuf er 1974 den Comic Strip „Downstown“, der zunächst die harmlosen Alltags-Abenteuer zweier Studenten erzählte, die 1979 in die Erlebnisse zweier Single-Freunde überführt wurden, als Downs seinen Strip an das „Universal Press Syndicate“ verkaufen konnte. In den dort angeschlossenen Zeitungen erschien „Downstown“ sieben Jahre, bevor Downs die Serie 1986 auf eigenen Wunsch beendete.
Als Schriftsteller begann Downs in Zusammenarbeit mit seiner Ehefrau Joy sowie in seiner Eigenschaft als Gründer des „Communication Center“, einer mit dem „Campus Crusade for Christ“ verbandelten Einrichtung, die auf den Erhalt christlicher Werte (in der Definition genannter Kreuzfahrer) in der Welt der Wissenschaft zielt. Diesbezügliches Gedankengut floss 1999 in Downs Erstling, das Sachbuch „Finding Common Ground“, ein.
2003 ergänzte er sein Repertoire um Kriminalromane, in denen er seine Lehren in Unterhaltung verpackt. „Shoofly Pie“ wurde gleichzeitig das Debüt des forensischen Entomologen Dr. Nicholas Polchak, zu dessen weiterhin fortgesetzten Aktivitätsbeschreibungen als privater und genrekonform auf eigene Faust handelnder Ermittler sich einige Stand-Alone-Thriller gesellten. Zumindest ein Publikum, das geistliche Anleitung à la Downs schätzt, ließ seine Bücher recht erfolgreich werden.
Mit seiner Familie lebt und arbeitet Tim Downs in Cary, US-Staat North Carolina.
|Taschenbuch: 448 Seiten
Originaltitel: Chop Shop (West Monroe/Louisiana : Howard Books 2004)
Übersetzung: Christian Quatmann
ISBN-13: 978-3-442-46528-6
Als eBook: November 2010 (Wilhelm Goldmann Verlag)
ISBN: 978-3-641-05160-0|
[www.timdowns.net]http://www.timdowns.net
[www.randomhouse.de/goldmann]http://www.randomhouse.de/goldmann
Richard Essex – Lesley mit der leichten Hand

Richard Essex – Lesley mit der leichten Hand weiterlesen
H. P. Lovecraft – Azathoth. Vermischte Schriften

H. P. Lovecraft – Azathoth. Vermischte Schriften weiterlesen
Victor Gunn – Spuren im Schnee

Victor Gunn – Spuren im Schnee weiterlesen
A. E. W. Mason – Das Geheimnis der Sänfte

A. E. W. Mason – Das Geheimnis der Sänfte weiterlesen
Sanborn, B. X. – Wahrsager, Der
_Das geschieht:_
Das Schicksal scheint es endlich gut mit John Perseus, einem aufstrebenden Maler, zu meinen. Gerade konnte er ein erstes Bild an ein bedeutendes Kunstmuseum verkaufen, was seinem Ruf ebenso zugutekommen wird wie seiner Geldbörse. Die Heirat mit der schönen Vivian MacDonald ist nur noch eine Frage der Zeit, der Umzug aus dem New Yorker Künstlerviertel Greenwich Village in eine noblere Gegend absehbar.
Noch haust Perseus kostengünstig im behaglich verlotterten Haus von Miss Serana Soolie, die gern an Künstler vermietet. Allerdings war die Kellerwohnung gerade Schauplatz einer Tragödie: Tänzerin Fay Farrell hat sich mit Chloralhydrat vergiftet. Perseus hilft der aufgeregten Hauswirtin beim Sortieren des Nachlasses. Er stößt dabei auf die Adresse des mysteriösen Marcolf, den auch er kennengelernt hat.
Marcolf bezeichnet sich als Wahrsager, seine Prophezeiungen äußert er nach eigener Auskunft unentgeltlich sowie zum Wohle und zur Warnung betroffener Mitmenschen. Perseus hatte er im Vorjahr beruflichen Erfolg angekündigt. Vivian wurde von ihm gewarnt und konnte einen gefährlichen Autounfall vermeiden. Wie sich herausstellt, gehören noch andere Perseus-Bekannte zum Kreis der Marcolf-Jünger.
Als diese plötzlich diversen ‚Unfällen‘ zum Opfer zu fallen beginnen, wird Perseus misstrauisch. Wer ist dieser Marcolf, und was könnte er planen? Da polizeilich gegen den Wahrsager nichts vorliegt, beginnt der Künstler selbst zu ermitteln. Er stößt dabei auf die Spur einer raffiniert eingefädelten Intrige, stellt sich jedoch nicht sehr geschickt an. Auch ohne seherische Fähigkeiten werden einige unsympathische Zeitgenossen auf Perseus aufmerksam, die ihre einträglichen Machenschaften keinesfalls aufgedeckt sehen wollen …
|Klasse kann & muss man suchen!|
In der Regel sind es die klassischen Rätsel-Krimis, die im Strom der Zeit auch weit flussabwärts noch an der Oberfläche treiben. Sie bestechen durch die ‚mechanische‘ Struktur eines Plots, der auf ein Rätsel konzentriert ist. Darüber hinaus spielen sie in der „guten, alten“ Zeit und unterhalten durch zeitgenössische Drolligkeiten, die der Geschichte eine zusätzliche Patina verleihen.
Klassikerstatus dürfen daneben auch die „Hard-Boiled“-Krimis der 1930er und 1940er Jahre beanspruchen, die umgekehrt von den großen Filmen der „Schwarzen Serie“ profitierten: Krimi kann gesellschaftskritisch und trotzdem unterhaltsam sein, ohne dafür in seifenoperlichem Beiwerk ertränkt zu werden.
Natürlich behaupteten sich in beiden Genres primär die Autorinnen und Autoren mit den kräftigen Stimmen. In Deutschland traten eigene Vorlieben der Leserschaft hinzu. Sie verurteilte nicht wenige wunderbare Autoren zu einem Schattendasein, das sie objektiv nicht verdien(t)en. B. X. Sanborn alias William S. Ballinger gehört eindeutig in diese Kategorie.
|Sagt der Wahrsager die ganze Wahrheit?|
„Der Wahrsager“ wird nie die Bedingungen eines ‚richtigen‘ Klassikers erfüllen. Auch als „Pulp“-Perle kann dieser Roman nicht gelten, denn hier gibt es weder offene Gewalt noch wogende Busen oder spektakuläre Gefühlsaufwallungen. Sanborn erzählt stattdessen eine Kriminalgeschichte. Dies war sein selbst gewählter Job, und er produzierte rasch, was angesichts schmaler Gewinnmargen auch notwendig war: Der Zenith-Verlag verkaufte „Der Wahrsager“ als „The Blonde on Borrowed Time“ im März 1960 für 35 Cents, was auch inflationsbereinigt keine besonders hohe Summe ist.
Trotzdem gelang Sanborn ein Krimi, der sich viele Jahrzehnte später mit großem Vergnügen lesen lässt. Der Autor beschränkt sich auf das Wesentliche: einen Plot, der interessiert, für eine Geschichte, die linear aber wendungsreich und schnell auf ihren Höhepunkt zusteuert. Für jenen Ballast, der heutzutage Kriminalromane auf bis zu tausend Seiten anschwellen lässt, hatte Sanborn weder Sinn noch Zeit.
Siehe da: „Der Wahrsager“ funktioniert wunderbar ohne jede Zeilenschinderei. Langeweile stellt sich nicht ein, der Verfasser hat sein Publikum fest im Griff. Wie sich das Rätsel lösen wird, steht früh fest: Dass Marcolf kein echter Wahrsager ist, dürfte niemanden überraschen. Nichtsdestotrotz schürt Sanborn unsere Neugier. Was ist Marcolfs Trick? Wir wollen es wissen, und als auch unser Held endlich schlauer ist, wird es ebenso spannend zu verfolgen, wie er sich sehr diesseitigen Gangstermethoden ausgesetzt sieht.
|Figuren mit Zügen|
Der Detektiv ist dieses Mal ein Kunstmaler. Dies steht nicht im Widerspruch, denn John Perseus ist ein kreativer Geist, dessen Finger nicht nur einen Pinsel halten können: Bei Bedarf ballt er sie auch zur Faust, denn schließlich trägt er den Namen eines Helden der griechischen Mythologie. Perseus ist es zudem, den Sanborn die Handlung erzählen lässt. Seine Sprache ist nüchtern aber anschaulich, und gern verwendet er Vergleiche, die seinem künstlerischen Umfeld entspringen – einer jener kleinen aber feinen Tricks, mit denen Sanborn die Distanz zwischen Hauptfigur und Leser verkürzt.
Charakterlich bietet Perseus eine heute seltsam anmutende Mischung aus ‚modernem“ Laissez-Faire und zeitgenössischer Political Correctness. Zwar lebt er im und liebt das Viertel Greenwich Village, aber er hält Abstand zum locker-lebenslustigen Künstlervolk und widmet sich seiner Malerei. Perseus ist erfolgsorientiert – ein ‚typischer‘ Mann seiner Ära. Zwar ist er verlobt mit einer reichen Frau, will aber unbedingt den Durchbruch schaffen, um vor seiner Hochzeit finanziell auf eigenen Füßen zu stehen.
Mit einem Trick drückt sich Sanborn um das moralische ‚Problem‘, Perseus und Vivian als Paar in ‚wilder Ehe‘ zu präsentieren: Ihr bigotter Vater hat sie per Testamentsklausel zum braven Tochterleben verurteilt. Erst wenn Vivian ihren 25. Geburtstag feiert und bis dahin in keinen Skandal verwickelt war, kann sie ihr Erbe antreten. Also bleiben sie und John (zumindest auf dem Papier) keusch und ehrenhaft. Dies klingt inzwischen witzig, hat hier aber einen ernsthaften Hintergrund: Schon ein gestelltes ’schmutziges‘ Foto und eine falsche Zeugenaussage reichen als Drohung aus, um Perseus und Vivian in die Schranken zu weisen, als sie zu neugierig werden und Gangstern auf die Füße treten.
|Ende gut, Leser zufrieden|
Vertrauensvoll bzw. voller Spannung erwartet der Leser, der sich vom Verfasser redlich behandelt weiß, die Auflösung. In der Tat gelingt es Sanborn, die zahlreichen losen Fäden nicht nur schlüssig, sondern auch rasch zum finalen Knoten zu schnüren. Ein wenig Lebensgefahr und Action gibt es auch, und selbstverständlich begeht Sanborn nicht den Fehler, Perseus plötzlich zur strafenden Kampfmaschine mutieren zu lassen.
Stattdessen fangen sich die Schurken in einem Netz schlampig verwischter oder übersehener, von John und Vivian sorgfältig gesammelter und aufgedröselter Indizien, die sich auch durch Waffengewalt nicht mehr aus der Welt schaffen lassen. Die Polizei muss nur noch kommen und aufräumen.
Am Ende ist vieles gut aber nicht alles happy – bis auf den Leser, der kaum glauben kann, dass es einst Kriminalautoren wie B. X. Sanborn gab, die ihre Geschichten so präzise und zügig auf den Punkt bringen konnten. Man muss deshalb kein Wahrsager sein, um voraussagen zu können, dass dieser Roman auch heute seine Leser begeistern wird – wenn sie ihn denn finden können!
_Autor_
B. X. Sanborn wurde als William Sanborn Ballinger 1912 in Oskaloosa im US-Staat Iowa geboren. Er studierte an der Universität von Wisconsin. Ab 1934 arbeitete er in der Werbung und schrieb dann für das Radio. In den 1950er Jahren zog Ballinger nach Südkalifornien, um Drehbücher für das Fernsehen zu verfassen. Bis in die 70er Jahre lieferte er die Vorlagen für ca. 150 TV-Shows, darunter bekannte Thriller-Serien wie „Cannon“, „Ironside“ („Der Chef“), „I Spy“ („Tennisschläger & Kanonen“), „Mickey Spillane’s Mike Hammer“ oder „M. Squad“ („Dezernat M“). 1960 zeichneten ihn die „Mystery Writers of America“ für seine Adaptation der Stanley Ellin-Story „The Day of the Bullet“ für „Alfred Hitchcock Presents“ mit einem „Edgar Allan Poe Award“ aus. Zwischen 1977 und 1979 unterrichtete Ballinger kreatives Schreiben an der California State University.
Bill S. Ballinger begann als Verfasser geradliniger Detektivgeschichten. Barr Breed, Held seines Debütromans „The Body in the Bed“ (1948) war der typische hartgesottene Schnüffler, die Geschichte eng an Dashiell Hammetts „Der Malteser Falke“ angelehnt. Aber Ballinger hatte Talent und entwickelte Ehrgeiz; seine Geschichten wurden innovativer und vielschichtiger, kratzten am Lack der scheinbar idealen US-Gesellschaft.
Schon 1950 gelang der Durchbruch mit „Portrait of a Smoke“, der sechs Jahre später als „Wicked as They Come“ (dt. „Keiner ging an ihr vorbei“) verfilmt wurde. Weitere Erfolge verzeichnete Ballinger mit „The Wife of the Red-Haired Man” (1957) oder „The Tooth and the Nail” (1955).
In den 1960er Jahren griff der Verfasser den aktuellen Trend zum Spionage-Thriller auf und schuf seinen eigenen James Bond: Joaquin Hawks vom CIA, den wir zuerst in „The Chinese Mask“ (1965) treffen. Lange Passagen dieses Romans spielen in China; Ballinger profitierte hier von seinen ausgedehnten Reisen durch den Fernen Osten. Das gilt auch für sein Drehbuch zum Actionfilm „Operation CIA“ (1965), in dem es einen noch sehr jugendlichen Burt Reynolds nach Saigon verschlägt.
In die Spätphase von Ballingers Karriere fallen der epische „The Corsican“ (1974), die mehrere Jahrzehnte umfassende Chronik einer Mafia-Familie, und die merkwürdige aber spannende Reinkarnationsfabel „49 Days of Death“ (1969), die auf dem tibetanischen „Buch der Toten“ basiert.
Bill S. Ballinger, der auch unter dem Namen Frederic Fryer schrieb, starb im Jahre 1980. Sein letztes Werk war eine Geschichte der kalifornischen „Federal Credit Union“, der er 1978/79 als Präsident vorstand.
|Taschenbuch: 171 Seiten
Originaltitel: The Doom-Maker (New York : E. P. Dutton & Co. 1959)/The Blonde on Borrowed Time (New York : Zenith Books 1960)
Übersetzung: Paul Baudisch|
Tripp, Ben – Infektion
_Das geschieht:_
Forest Peak ist eine kleine Stadt im US-Staat Kalifornien. Eine Autostunde von Los Angeles entfernt in einem waldreichen Landstrich gelegen, dient sie zivilisationsmüden Städtern als beliebtes Ausflugsziel. Die Bürger haben sich auf die Touristen eingestellt und leben nicht schlecht vom Fremdenverkehr. Um jene Besucher, die sich nicht benehmen können, kümmert sich Sheriff Danielle „Danny“ Adelman, eine im Irak-Krieg verwundete und dekorierte Ex-Soldatin, die wenig Federlesens mit Gesetzesbrechern und Unruhestiftern macht.
Privat leidet Danny unter Albträumen vom Krieg sowie den Eskapaden ihrer jüngeren Schwester Kelly, die sie nach dem Tod der Eltern eher schlecht als recht zu erziehen versucht. Gerade hat ihr Kelly den geliebten Ford Mustang geklaut und ist aus Forest Peak verschwunden. Um ihren Verbleib kann sich Danny nicht kümmern, weil gerade jetzt die Zivilisation zusammenbricht: Weltweit geraten 9 von 10 Menschen erst in Panik und laufen Amok, um anschließend tot umzufallen. Wenig später erwachen sie zu neuem Scheinleben und fallen über ihre lebenden, offensichtlich immunen Mitbürger her, um sie zu fressen und ebenfalls in Zombies zu verwandeln.
Forest Peak verwandelt sich in die Hölle, da es nicht lang dauert, bis aus Los Angeles ein Millionenheer von Zombies in alle Richtungen ausschwärmt. Danny und ihre kleine Polizeistation werden überrannt, denn die hungrigen Toten sind zwar nicht intelligent aber mächtig in der Überzahl. Mit einigen Leidensgefährten schart Danny die wenigen Überlebenden um sich. Man durchbricht die Reihen der Zombies und flüchtet aus Forest Peak. Eine ziellose Flucht durch die Mojave-Wüste beginnt. Man sucht nach einem Ort, an dem man sich verstecken oder besser: verbarrikadieren kann. Doch innerhalb der kleinen Gruppe herrscht Uneinigkeit. Das schwächt den Zusammenhalt und beeinträchtigt die Aufmerksamkeit, was zombieseits nicht unbemerkt bleibt …
|Das Leben steckt voller untoter Überraschungen|
Am Anfang stand – Frustration. Ben Tripp outet sich auf seiner Website als Mitglied einer ganz besonderen Zombie-Armee: Sie ist in Hollywood stationiert, wo ihre Soldaten Projekte für Film und Fernsehen entwickeln, die niemals verwirklicht werden. Mehr als zehn Jahre hat Tripp im Laufrad dieser Industrie verbracht. Zwar wurde er für seine Arbeit bezahlt, aber die Bestätigung in Gestalt seines im Vor- und Abspann lesbaren Namens eines tatsächlich gedrehten Films blieb aus.
Das Seitenvolumen des hier vorgestellten Buches sowie des Verfassers Aussage, dies sei nur der erste Teil der Gesamtgeschichte, weisen darauf hin, dass „Infektion“ ursprünglich die Drehbuch-Grundlage für eine Fernsehserie darstellte. Immer wieder bot Tripp sein weit gediehenes Werk an, doch sämtliche Produzenten winkten ab: Niemand wolle Zombies im Fernsehen sehen – schon gar nicht in der von Tripp favorisierten aber von der Zensur verabscheuten, sich an den Romero-Wüstlingen orientierenden, Blut und Eingeweide verspritzenden Variante.
Also beschloss der schließlich resignierende Tripp, die Ergebnisse einer jahrelangen Arbeit nicht ad acta zu legen, sondern in einen Roman einzubringen. Dieses Mal hatte er mehr Glück. Er verkaufte die Buchrechte für „Rise Again“ im Oktober 2010 – im gleichen Monat ging der US-Fernsehsender AMC mit der ersten Folge der Serie „The Walking Dead“ auf Sendung, was Tripp die Freude über seinen Erfolg arg vergällte, obwohl er sich inzwischen bemüht, die ironische Seite der Ereignisse zu würdigen.
|Kommt uns das nicht sehr bekannt vor?|
Das Wissen um die TV-Herkunft beantwortet eine Frage, die sich der Leser recht bald stellt: Warum dehnt Autor Tripp eine längst bekannte Geschichte quasi ins Unendliche aus? Sie sollte ursprünglich vermutlich 13 TV-Folgen abdecken, weshalb sich der Verfasser viel Zeit nimmt, in fernsehüblichen Details – und Klischees – zu schwelgen. Man kann als erfahrener (und viel geprüfter) Zuschauer mit ziemlicher Sicherheit nachvollziehen, wo welche Episode enden sollte.
Zahlreiche Figuren werden eingeführt und mit ausführlichen Biografien ausgestattet, die gleichzeitig Zündstoff für dramatische Zwischenmenscheleien bieten; mit solchem Seifenoper-Schaum können routiniert und kostengünstig viele Sendeminuten gefüllt und gestreckt werden, während die (teuer zu schminkenden) Zombies im Off ihr Unwesen treiben. Hinzu kommen in der zweiten Hälfte unserer Geschichte fiese Macho-Söldner, die sich auf dem hollywoodtypischen Usurpatoren-Trip – rauben statt helfen, flüchten statt Zombies killen sowie den attraktiven unter den überlebenden Frauen nachstellen – befinden.
Forest Peak bildet nur den Startpunkt für eine Geschichte, die in der Frühzeit des US-Fernsehens noch als Wagentreck in den Wilden Westen erzählt worden wäre. Statt der Zombies hätten Indianer brave Siedler-Pioniere belauert, doch ansonsten gäbe es wenige Unterschiede. Der Weg ist auch bei Tripp das Ziel: Sheriff Dannys annähernd die US-Bevölkerungsstatistik widerspiegelnde Gruppe kämpft sich durch eine karge und menschenfeindliche Landschaft.
Mit der TV-Dramaturgie für die Buch-Inkarnation zu brechen oder sie wenigstens zu verdichten, stand offensichtlich nicht auf Tripps Agenda. Zwar geht scheinbar hoch und heftig her – auf ein Budget muss der Verfasser nicht Rücksicht nehmen -, doch zumindest die Langmut derjenigen Leser, die das fünfte, elfte oder 112te Gefecht mit hungrigen Zombies nicht mehr unbedingt unterhaltsam finden, erschöpft sich allmählich. Bis sich in dieser Hinsicht endlich Neues ereignet, füllt Tripp viele Seiten mit jenen |Post-Doomsday|-Gemeinheiten, die sich die Menschen voraussichtlich antun werden.
|Das alte Problem: Zombies sind öde|
Anders als der Vampir oder der Werwolf ist der Zombie ein Monster aus der Unterschicht des Grauens. Er hat höchstens eine einzige verborgene Tiefe, die in der Frage mündet, ob er irgendwann seine Intelligenz wiederfindet. Ansonsten ist er ein tumber, hässlicher Zeitgenosse, der nur aufgrund seiner Überzahl gefährlich wird. Wohliges Grauen durch verwesende Hässlichkeit und blutspritzende Bissigkeit kann er vor allem im Film verbreiten. Im Buch sollen entsprechende zwar Beschreibungen und Attacken für saftigen Splatter sorgen, was aber ohne Bebilderung weniger nachdrücklich bleibt.
Emotionale Turbulenzen und daraus hervorgehende Konflikte bleiben den Lebenden vorbehalten. Sie basieren auf der Prämisse, dass der Mensch auch in der Not nur im Einzelfall dazulernt. Also beharren einst privilegierte Zeitgenossen auf vergangene Vorrechte, bringen geistig überforderte Einzelgänger mit unbedachten Aktionen die Gesamtgruppe in Gefahr, geraten Kinder & junge Hunde vor scharfe Zombie-Gebisse. (Klischee Nr. 3 wird hier nur humorvoll zitiert; so etwas traut sich in dieser zynisch gewordenen Gegenwart selbst ein TV-Minenarbeiter nicht mehr.)
|Menschen sind nur bedingt interessanter|
Auch in „The Walking Dead“ wird ausgiebig gestritten. Während man im Fernsehen die Kombattanten wiederum sehen kann, hört man im Buch vor allem Papier rascheln. Die Figurenzeichnung bleibt ausnahmslos bekannten Klischees verhaftet. Sheriff Danny ist die auf die Spitze getriebene Inkarnation sämtlicher (moderner) Trivial-Helden: weiblich, kampfstark, trotzdem hübsch, seelisch angeknackst (Irak-Krieg-Trauma!) und stets in vorderster Front aktiv, auch wenn sie zwischenzeitlich in eigentlich tödliche Explosionen gerät, beschossen wird und einige Finger verliert.
Um diese recht stereotype Figur aufzuwerten, dichtet Tripp Danny eine tragische Familiengeschichte an. Die kleine Schwester tritt zwar nur zu Beginn und im Schlusskapitel auf, spukt aber auf den dazwischenliegenden 600 Seiten durch Rückblenden allzeit präsent durch die Handlung; u. a. verleitet sie Danny zu diversen Eskapaden, die der einführenden Charakterisierung völlig widersprechen.
Zu allem Überfluss aber keineswegs unerwartet gestaltet Tripp mit Kelleys Hilfe den finalen Cliffhanger, mit dem er auf die Fortsetzung seines Zombie-Epos‘ neugierig machen möchte: Die keiner Logik gehorchende Übertriebenheit deutet nicht nur an, dass mit dieser Szene die erste Serienstaffel geendet hätte.
_Lesefutter kann eine Lektüre-Mahlzeit ersetzen_
Ist „Infektion“, dieser überlange, bar jedes originellen Einfalls Szene an Szene flanschende Trivial-Horror, also langweilige Zeitvergeudung? Auf keinen Fall, denn gerade diejenigen Genre-Werke, die in erster Linie unterhalten wollen, benötigen feste Handlungs- und Figurenkonstanten, die nur behutsam variiert werden dürfen. Sie decken damit den größten gemeinsamen Zuschauer- oder Lesergeschmack ab, was ein Hauptgrund dafür ist, dass unter zeitgemäß schicken äußeren Schalen immer wieder alte Muster deutlich werden.
Es trifft zu, dass Tripp mindestens die Geschichten der ersten vier Romero-Zombie-Filme in seinen Hirn-Mixer wirft und das Gebräu mit Anleihen aus der „Resident-Evil“-Mythologie würzt; er ist ganz gewiss kein Literat. Aber er versteht sein Handwerk und |kann| schreiben, d. h. hängt nicht einfach Worte hintereinander, sondern hat ein Gefühl für Sprache, vermag nicht nur Action darzustellen, sondern auch Stimmungen zu gestalten. (In diesem Zusammenhang sollte und muss der Übersetzer lobend erwähnt werden, der einen im Deutschen angenehmen Lesefluss gewährleistet.)
„Infektion“ ist kein Phantastik-Festmahl, sondern Fast-Food-Horror. Wenn die Zutaten stimmen und die Zubereitung klappt, schmeckt solches Lesefutter freilich vorzüglich. Vor allem einem jüngeren Publikum, dass die Tricks (noch) nicht kennt, mit denen Tripp arbeitet, wird sich zu Recht amüsieren, aber auch dieser alte Leser-Haudegen, der die Manipulationen und ‚Anleihen‘ sehr genau erkennt, kann und will seinen Spaß an diesem Spektakel nicht verhehlen: Mr. Tripp, Rise Again!
_Autor_
Ben Tripp schrieb Drehbücher für Hollywood, die allerdings niemals verfilmt wurden, woraufhin Tripp zumindest das Zombie-Epos „Rise Again“ zum Roman umarbeitete und veröffentlichte.
Sein beruflicher Werdegang begann bei einem anderen Giganten der US- Unterhaltungsindustrie. Für Disneys Themen- und Vergnügungsparks gestaltete Tripp mehr als zwei Jahrzehnte und weltweit aufwändige Attraktionen wie die Kilimanjaro Safari in Disney’s „Animal Kingdom“.
Mit seiner Familie lebt Ben Tripp in Los Angeles.
|Taschenbuch: 623 Seiten
Originaltitel: Rise Again (New York : Gallery Books 2010)
Übersetzung: Bernhard Kempen
ISBN-13: 978-3-453-52891-8
Als eBook: November 2011 (Wilhelm Heyne Verlag)
ISBN: 978-3-641-07077-9|
[Autorenhomepage]http://riseagainthenovel.com/about-author-ben-tripp.htm
[www.randomhouse.de/heyne]http://www.randomhouse.de/heyne
W. R. Burnett – Little Caesar

W. R. Burnett – Little Caesar weiterlesen