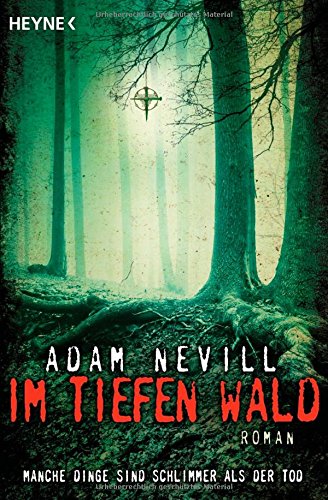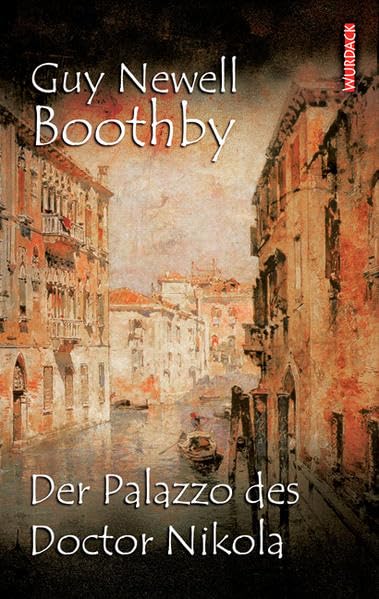Richard Dalby (Hg.) – Eiskalte Weihnachten. Kleine Morde zum Fest der Liebe weiterlesen
Alle Beiträge von Michael Drewniok
Alan Dean Foster – Das Ding aus einer anderen Welt
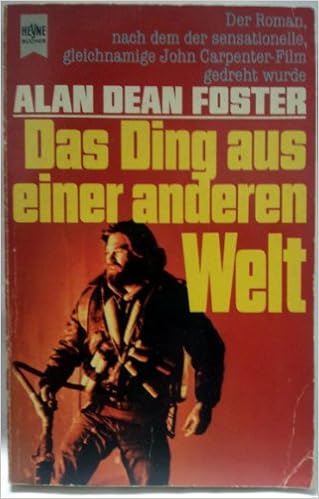
Alan Dean Foster – Das Ding aus einer anderen Welt weiterlesen
H. Russell Wakefield – Der Triumph des Todes und andere Gespenstergeschichten

H. Russell Wakefield – Der Triumph des Todes und andere Gespenstergeschichten weiterlesen
Nevill, Adam – Im tiefen Wald
_Das geschieht:_
Hutch, Phil, Dom und Luke, vier Engländer in den Dreißigern, wollen auf einer herbstlichen Waldwanderung in Schweden ihre Freundschaft aufleben lassen. Das Wiedersehen steht allerdings unter keinem guten Stern, denn Phil und Dom sind schlecht in Form und Dom verletzt sich schon am ersten Tag das Knie. Streit bricht aus, der durch private Sorgen geschürt wird. Um die Rückkehr in die Zivilisation zu beschleunigen, beschließt man eine Abkürzung zu nehmen, die jedoch durch einen unzugänglichen Urwald führt. Prompt verlaufen sich die Gefährten.
Selbstverständlich gibt es in dieser Wildnis kein Handynetz. Niemand wird das Quartett vermissen, bis es zu spät ist, zumal sich herausstellt, dass man an einen unheimlichen Ort geraten ist: In einer baufälligen Hütte stoßen die Freunde auf gruselige Relikte. Sie gehen auf einen Kult zurück, der eine böse Waldkreatur verehrt und gefürchtet hat. In einer wenig später entdeckten ‚Kirche‘ liegen die Gebeine tierischer und menschlicher Opfer.
Während die Anhänger des Kultes inzwischen ausgestorben sind, treibt die Kreatur weiterhin ihr Unwesen. In einer Nacht schnappt sie sich den ersten Wanderer, dessen verstümmelte Leiche die Freunde hoch in einen Baum gezerrt finden: Das Wesen erklärt die Menschenjagd für eröffnet. Es spielt mit der Gruppe, die ohne Orientierung und voller Panik durch den Urwald irrt, und greift nach Belieben an.
Als der letzte Überlebende am Ende seiner Kräfte aus dem Wald taumelt, ist seine Odyssee längst nicht vorüber. Wie es aussieht, ist der seltsame Kult noch nicht gänzlich untergegangen. Weiterhin werden der Kreatur Opfer dargeboten, und dazu greift man gern auf den unerwarteten ‚Gast‘ zurück …
|Ein Buch wie eine (Mörder-) Muschel|
Inhaltlich klassisch aber formal ganz auf der Höhe einer wirtschaftlich schwierigen Gegenwart präsentiert Adam Nevill gleich zwei Horror-Romane zum Preis eines einzigen Buches! Was ein (vermutlich etwas flauer) Scherz ist, hebt die Besonderheit dieses Werkes jedoch hervor: „Im tiefen Wald“ zerfällt in zwei voneinander getrennte Handlungsabschnitte, die thematisch eher schlecht als recht zusammenhalten. Allerdings leidet der Unterhaltungswert nur kurz, als Strang 1 endet und mit Strang 2 der Spannung erst neu errichtet werden muss. Wieso Nevill diese Entscheidung traf, bleibt ungeklärt. Das Geschehen hätte die Zweiteilung keineswegs erfordert, eine Verschmelzung wäre möglich gewesen.
So erzählt Nevill zunächst die Geschichte eines Wanderausflugs mit katastrophalen Folgen. Vier Freunde werden nicht nur verfolgt, in Todesangst versetzt und zum Großteil umgebracht, sondern auch psychisch durch die Mangel gedreht. Die wilde Hetzjagd endet nur scheinbar halbwegs glücklich mit dem Entrinnen eines Überlebenden, der nunmehr in die Hände durchgedrehter Mörder, Satanisten und Odin-Anhänger fällt.
Wer meint, dass Nevill bereits alle Tiefen menschlichen Leidens ausgelotet hatte, wird mit diesem zweiten Teil der Geschichte eines Besseren (oder Schlechteren?) belehrt. Der böse Geist des Waldes bleibt erst einmal außen vor und überlässt das Feld denen, die sehr viel nachdrücklicher als jeder Spuk Schmerz und Angst verbreiten können: den Menschen.
|Der Mensch und das Monster|
„Im tiefen Wald“ erinnert durch die Zweiteilung der Handlung an eine Muschel, deren Schalen den eigentlichen Inhalt schützen. In der Tat macht die schier unendliche Kette von Qualen, die Nevill sich mit eindrucksvoller Intensität ausdachte, keineswegs die selbstzweckhafte Bedeutung dieser Geschichte aus. Der berüchtigte „Gore-Bauer“ – falls er denn liest bzw. des Lesens mächtig ist – mag sich an den drastischen Effekten delektieren. Sie sind dennoch nur Ausdruck und Folge eines Prozesses, der Nevill wesentlich stärker interessiert: Was geschieht mit dem Durchschnittsmenschen in einer Krisensituation, die keinerlei Flucht gestattet, sondern die Konfrontation mit der Gefahr erzwingt?
Unter dieser Prämisse verwandeln sich die beiden Teilgeschichten in Planspiele. Abschnitt 1 beschäftigt sich mit der Gruppe, die in Not gerät. Nevill konzentriert sich auf die Dynamik zwischen vier Freunden, die begreifen müssen, dass sie einander nie wirklich gekannt haben. Folgerichtig erweisen sich die freundschaftlichen Bande als brüchig. Sie werden geprüft und brechen, werden andererseits aber im Angesicht des Grauens neu geschmiedet und erreichen jene Festigkeit, die zuvor nur Behauptung war.
|Der Mensch ist das Monster|
Mit Abschnitt 2 wechselt die Perspektive. Nevill gibt dem Schrecken Gesichter und Namen. Mit Loki, Fenris und Surtr, die ihn mit einer uralten Schamanin dem Waldgott opfern wollen, kann der letzte Wanderer reden und diskutieren. Die Ironie liegt darin, dass er sie ebenso wenig erreicht wie das Ding im Wald: Kommunikation ist nicht der Schlüssel zur Verständigung.
Der ‚Reifeprozess‘ setzt sich fort. Stück für Stück muss der Überlebende elementare oder anerzogene Gefühle wie Rücksicht und Mitleid ablegen. Was in der Horror-Literatur und mehr noch im Film gern als blitzartige Mutation zur Kampfmaschine dargestellt und durchaus zelebriert wird, zeichnet Nevill als langsame und schmerzhafte Abfolge von Erkenntnissen, an dessen Ende der buchstäblich nackte, auf seine Gegner nicht mehr einredende, sondern tötende Urmensch steht.
|Rückkehr zum bewährten Horror|
Die psychologischen Aspekte der Handlung werden von Nevill klug und wirkungsvoll mit Elementen des klassischen Horrors unterfüttert. „Im tiefen Wald“ kann auf Wunsch als reine Gruselgeschichte gelesen werden. Der Verfasser kennt seinen Job, er ist beispielsweise ungemein erfindungsreich in der Gestaltung unheimlicher Landschaften und Orte. Fäulnis und Feuchtigkeit, Verfall und Degeneration fasst Nevill variantenreich in scheinbar einfache Worte, die jedoch das Kino im Kopf des Lesers zuverlässig in Gang setzen und Bilder verursachen, die dem Schrecken einen Rahmen geben. Die einsame, halb verfallene Hütte im Wald wirkt dabei bedrückender als die optisch zweifellos großartige Kulisse der alten, entweihten Kirche und der mit Opferknochen gefüllten Krypta: Die Andeutung ist dem Effekt-Overkill wieder einmal vorzuziehen.
Dies bestätigt der zweite Romanteil, der zwar hochgradig gestörte und erschreckende Menschenfiguren präsentiert, die jedoch ihr Wirken wortreich erklären und sich damit selbst entmystifizieren. Was allerdings in Nevills Absicht liegt, der Loki, Fenris und Surtr als verblendete Fanatiker und letztlich Kriminelle bloßstellt, die sich auf eine Sache eingelassen haben, der sie nicht gewachsen sind und die sie keineswegs kontrollieren. Wirklich einschüchternd gerät ihm dagegen die Figur der namenlosen Schamanin, die kaum ein Wort sagt, alt und schwach ist aber tatsächlich die Fäden in der Hand hält.
|Notiz an das Leserhirn …|
Was letztlich im Wald umgeht, lässt Nevill ungeklärt. Die Kreatur offenbart sich nur körperlich, weshalb sie ihre Rätselhaftigkeit behält. Keineswegs steht fest, dass sie ein lebendiges Relikt der nordischen Mythologie ist; diese Bedeutung wird von Loki & Co. auf sie projiziert. Faktisch ist es sowieso gleichgültig. Der Überlebende ist die Hauptfigur dieser Geschichte; er bestreitet sie lückenlos über die gesamte Buchstrecke. Sein Leidens- und Überlebensweg sorgt für die notwendige Erdung, er ist die Identifikationsfigur des Lesers. Als solche führt er durch einen konzeptionell nicht durchweg überzeugenden aber wahrlich höllisch spannenden Horror-Roman!
Mit „Im tiefen Wald“ hat Adam Nevill dem (deutschen) Horror-Buchmarkt, der unter dem Ansturm windelweicher Als-ob-Vampire u. a. Jammergestalten ächzt, eine bitter nötige Frischblut-Zufuhr verpasst. Brachialer Grusel mit psychologischem Subtext aber ohne jene blutrünstigen Übertreibungen, die den Splatter leicht in Spott umschlagen lassen: ‚Literarisch‘ ist das nicht, aber es funktioniert vorzüglich und sorgt dafür, dass der Verfassername nicht auf jene schwarze Liste gerät, die der erfahrene Leser für die Meyers, MacAlisters, Davidsons u. a. Nulpen & Zeitverschwender des Genres reserviert, sondern in dessen Hirn mit einem „Neues-Buch-ebenfalls-lesen“-Link markiert wird.
_Autor_
Adam L. G. Nevill wurde 1969 im englischen Birmingham geboren. Er wuchs dort sowie auf der Insel Neuseeland auf, später studierte er an der schottischen Universität von St. Andrews. Nach seinem Abschluss schlug Nevill die Laufbahn eines Schriftstellers ein. Es schlossen sich 15 Jahre entsprechender Versuche und ein Leben am Rande des Existenzminimums an, in denen sich Nevill u. a. mehrere Jahre als Pförtner und Nachtwärter in West-London durchschlug; die hier gesammelten Erfahrungen flossen 2010 in den Roman „Apartment 16“ ein.
Seinen ersten Phantastik-Roman, eine Gespenstergeschichte in der Tradition des englischen Großmeisters M. R. James, veröffentlichte Nevill bereits 2004: „Banquet for the Damned“ wurde 2005 von der „British Fantasy Society“ als bester Roman des Jahres nominiert.
Hauptberuflich ist Adam Nevill Herausgeber für erotische Literatur. Nachdem er in dieser Position bis Juni 2009 für „Virgin Books“ tätig war (und selbst neun Romane für Imprints wie „Black Lace“ und „Nexus“ schrieb), wechselte er nach Einstellung dieser Reihen zu „Xcite Books“.
|Paperback: 480 Seiten
Originaltitel: The Ritual (London : Pan 2011)
Übersetzung: Ronald Gutberlet
ISBN-13: 978-3-453-52882-6|
[www.adamlgnevill.com]http://www.adamlgnevill.com
[www.randomhouse.de/heyne ]http://www.randomhouse.de/heyne
Carnac, Carol – Tote im Feuer, Der
_Das geschieht:_
Ein behaglicher Feierabend ist Jim Boyle, Dorfpolizist in Oakenhead, in dieser nebligen Spätherbstnacht nicht vergönnt. Ein Anruf führt ihn noch einmal aus dem Haus und in das Bergland der englischen Grafschaft Derbyshire: Am Langland-Berg habe er einen Mann gefunden, der überfahren wurde, meldet ein Fernfahrer, der lieber anonym bleiben möchte. Boyle, der Bob Mayfield, seinen Schwiegervater, als Begleiter rekrutiert, findet an angegebener Stelle tatsächlich eine übel zugerichtete Leiche. Weil es spät geworden ist, legen die beiden Männer sie in der nahen Dorfkirche ab.
Noch in dieser Nacht brennt das Gotteshaus ab, vom Toten bleiben nur verkohlte Knochen, die eine Identifizierung unmöglich machen. Inspektor Forth, Boyles Vorgesetzter, ist nicht begeistert, als er in Oakenhead eintrifft. Begleitet wird er von seinem Sohn Robert, der gerade aus dem Militärdienst entlassen wurde und sich für die Polizeiarbeit interessiert. Um Forth zu unterstützen, stellt man ihm den jungen Kriminalbeamten Christopher „Kit“ Riddle zur Seite. Robert erkennt in ihm erfreut einen Soldatenkameraden, während Riddle die Vorteile nutzt, die ihm aus der Freundschaft mit einem Einheimischen erwachsen, den die wortkargen und misstrauischen Dörfler kennen und schätzen.
Denn alle Verdächtigen stammen aus Oakenhead: Hat der alte Mayfield bei der Bergung der Leiche mögliche Mordspuren verwischt? Ist sein nichtsnutziger Sohn Dick in die Sache verwickelt? War Tierarzt Ken Musgrave wirklich auf dem Weg zum Bauern Welby, als sein Wagen in einen Graben rutschte? Hatte Welby ihn tatsächlich gerufen? Wieso interessiert sich Colonel Bourne so brennend für den Fall? Handelt es sich bei dem Toten um den Sträfling Fredstone, der nach einem Ausbruch seit Monaten flüchtig ist? Viele Fragen und zunächst keine Antworten, bis Riddle und die beiden Forth-Männer einen gänzlich neuen Ansitz finden und durch viel Fußarbeit sowie trotz einiger seltsamer ‚Unfälle‘ ein kompliziertes und altes Geheimnis lüften können …
|“Der Gegenwart entflieht, wer unter die Bauern geht.“|
So sprach der österreichische Schriftsteller Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) scheinbar weise aber falsch. Weit verbreitet war und ist das Bild vom Landmann auf seiner Scholle, der dort sitzt, sät und erntet, sein Leben dem jährlichen Wechsel der Jahreszeiten unterwirft und die ‚große Welt‘ ignoriert, weil sie ihn in seinem bäuerlichen Mikrokosmos weder angeht noch interessiert.
Auch Carol Carnac scheint zunächst in diese Kerbe zu hauen. Oakenhead ist ein Dorf, das wie für einen englischen Rätsel-Krimi eigens gegründet wirkt. Die Welt dreht sich hier Ende der 1950er Jahre so geruhsam wie in der guten, alten Zeit vor dem II. oder gar I. Weltkrieg. Die Erinnerung der älteren Bürger reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück, wichtige Kalendermarken sind Markttage und Dorffeste, die gleichzeitig der Anbahnung künftiger Ehen dienen. Gedacht wird langsam und gesprochen wenig, es sei denn, es gilt, über das Wetter oder zu niedrige Erzeugerpreise zu klagen.
Nach und nach mischen sich Misstöne in dieses trauliche Bild, denn Carnac schwelgt keineswegs in falscher Bauernstadl-Romantik. Hinter den dicken Mauern alter Höfe spielen sich Dramen ab. |“Im Kuhstall erzählen einem die Leute Dinge, die man niemals für möglich gehalten hätte“| (S. 90), weiß der alte Edmund Musgrave, Tierarzt im Ruhestand. Zudem ist die Zeit auch in Derbyshire keineswegs stehengeblieben. Traditionelle Strukturen lösen sich auf. Die Jugend ist unruhig geworden. Dick Mayfield hat keine Lust, seine Tage als unbezahlter Knecht auf dem Hof des Vaters und in vager Erwartung seines Erbes zu fristen. Ihn zieht es in die Ferne, er will etwas erleben.
|Geduld bis zur geeigneten Gelegenheit|
Dieser nur oberflächlich geruhsame und stattdessen gärende Alltag bietet die Basis für einen Mord der ländlichen Art. Der Tote im Feuer war zu Lebzeiten die Erinnerung an ein sorgfältig verdrängtes aber unbewältigtes Unrecht der Vergangenheit. Kein exotisches Gift oder andere raffinierte Mordmethoden mussten am Langland-Berg zum Einsatz kommen, sondern das Wissen um die Besonderheiten des örtlichen Klimas, was – zu diesem Schluss kommen unsere Ermittler früh – auf einen einheimischen Täter hinweist, der nicht nur weiß, wie dicht tarnender Nebel aufsteigen kann, sondern auch die Schleich- und Wirtschaftswege der Gegend kennt.
Ortskenntnis ist der Schlüssel zur Lösung, weshalb Farth Vater und Sohn sowie Kriminalpolizist Riddle viel Zeit damit verbringen, die Felder und Berge um Oakenhead mit dem Wagen, dem Rad und zu Fuß zu erkunden. Schnell haben sie ermittelt, dass erstaunliche viele Personen in der Mordnacht unterwegs waren und den Tatort passiert haben: Die Bauern des Ortes sind Nebel gewohnt und kommen dort durch, wo der Städter kapituliert.
Auch die Planmäßigkeit der Tat straft die sprichwörtliche bäuerliche Einfalt Lügen. Der Mord wurde begangen und nicht nur als Unfall getarnt, sondern die Leiche kaltblütig verbrannt, um endgültig ihre Identität auszulöschen. Ins Kalkül ziehen müssen die Ermittler zudem, dass der Täter sich ganz offen mit ihnen trifft, sie auf mögliche Verdachtsmomente aushorcht und zu manipulieren versucht.
|Ein Dreigespann ermittelt|
In „Der Tote im Feuer“ gelingt der Autorin mit der Wahl der Ermittler geschickt die Verknüpfung von Gestern und Heute. Inspektor Farth, der offenbar nicht einmal einen Vornamen hat, repräsentiert die korrekte, nicht nur der Dienstvorschrift, sondern auch ihrem mit der Zeit obsolet gewordenen Ehrenkodex verpflichtete Vergangenheit. Der deutlich wenig förmliche Christopher Riddle ist ein Kriminalist der neuen Zeit. Er hat den Polizeijob nicht von der Pike auf erlernt, sondern ist als Seiteneinsteiger dazu gestoßen, denn der moderne Ermittler profiliert sich nicht mehr ausschließlich durch Menschenkenntnis und Übung, sondern auch durch Bildung. Männer wie Farth Senior und Jim Boyle werden allmählich aussterben. Bis es soweit ist, bleibt dem einen die Rolle des Ratgebers, der aus seinem Erfahrungsschatz schöpft, und dem anderen die des einfachen Dorfpolizisten, der für Ruhe und Ordnung sorgt.
Robert Forth bildet die Verbindung. Mehrfach betont Carnac seine ländliche Herkunft, an die er sich jedoch nicht mehr gebunden fühlt. Anders als Dick Mayfield hat Robert Oakenhead hinter sich gelassen. Wenn er zurückkehrt, dann wird dies freiwillig geschehen. Auch mit der Charakterisierung ihrer Figuren verdeutlicht die Autorin, dass sie die Oakenheads der Gegenwart nicht als Museumsdörfer mit lebendem Inventar betrachtet.
|Idylle mit Wegmarken|
Das gar nicht so friedliche Landleben und den Einbruch der Moderne in eine festgefügte Gesellschaftsstruktur thematisierte Carol Carnac auch in anderen Kriminalromanen, die geografisch und zeitlich vor ähnlichem Hintergrund wie „Der Tote im Feuer“ spielen. Die Autorin kannte Land und Leute der englischen Midlands; sie bezog sich gern auf reale Orte, die sie mehr oder weniger verfremdet in ihren Geschichten verwendete. Auch hier lassen die präzisen Angaben von Wegstrecken und Wanderzeiten realitätsnahe Recherchen vermuten: Auf der Basis des Textes ließe sich eine Landkarte von Oakenhead und Umgebung zeichnen.
Womöglich haben diejenigen Leser, die ihren „Whodunit“ wirklich ernst nahmen, genau dies getan. Carnac hält sich an die klassische Vorgabe des „fair play“, das den Leser eng an der Seite der drei Ermittler hält. Was sie in Erfahrung bringen, wird uns mitgeteilt, bis sie im Finale einen kleinen Endspurt einlegen, der uns ein Stück zurückfallen lässt: Zu guter Letzt wollen wir entweder bestätigt oder – noch besser – überrascht werden, weil uns die Autorin doch an der Nase herumgeführt hat.
Da Carol Carnac eine professionelle Krimi-Autorin ist, gelingt ihr dies im Rahmen der genreüblichen und hochdramatischen Zusammenkunft aller Verdächtigen, aus deren Runde dem unwahrscheinlichsten Kandidaten die Maske vom Gesicht gerissen wird. So soll ein Rätselkrimi enden, wobei das Muster höchstens variiert werden darf. Mit „Der Tote im Feuer“ macht es Carnac wieder einmal richtig. Dem Leser bleibt zum Schluss nur die ratlose Frage, wieso ausgerechnet ihre Werke vom (deutschen) Buchmarkt verschwunden sind.
_Autorin_
Carol Carnac (1894-1958), geboren (bzw. verheiratet) als Edith Caroline Rivett-Carnac, muss man wohl zumindest hierzulande zu den vergessenen Autoren zählen. Dabei gehörte sie einst zwar nicht zu den immer wieder aufgelegten Königinnen (wie Agatha Christie oder Ngaio Marsh), aber doch zu den beliebten und gern gelesenen Prinzessinnen des Kriminalromans.
Spezialisiert hatte sich Lorac auf das damals wie heute beliebte Genre des (britischen) Landhaus-Thrillers, der Mord & Totschlag mit der traulichen Idylle einer versunkenen, scheinbar heilen Welt paart und daraus durchaus Funken schlägt, wenn Talent – nicht Ideen, denn beruhigende Eintönigkeit ist unabdingbar für einen gelungenen „Cozy“, wie diese Wattebausch-Krimis auch genannt werden – sich mit einem Sinn für verschrobene Charaktere paart.
|Taschenbuch: 175 Seiten
Originaltitel: The Burning Question (London : Collins/The Crime Club 1957)
Übersetzung: Karl Hellwig|
Festa, Frank (Hg.) – Omen 3 – Das Horror-Journal
_Geduld zahlt sich (manchmal) aus_
Was lange währt, wird endlich gut, und was RICHTIG lange währt, wird manchmal sogar besser: Fünf Jahre liegen zwischen der zweiten und dritten „Omen“-Ausgabe, was durchaus ein Rekord sein könnte. „Omen 3“ ist damit auch trotziger Ausdruck einer Hartnäckigkeit, die dem Herausgeber durch ökonomisch schwere Zeiten geholfen hat. In den vergangenen Jahren war das Festa-Schiff in stürmisches Wetter geraten, das im Verlagsprogramm manchen angekündigten Titel spurlos versinken ließ. Herausgeber Frank Festa fasst die Problematik in seinem Vorwort zu „Omen 3“ knapp aber schlüssig in diese Worte: |“Aber so ist das Leben, genau so. Der Horror.“|
Die dritte „Omen“-Ausgabe blieb stets im Programm. Dass sie schließlich veröffentlicht wurde, darf man wie gesagt als Geste berechtigten, auch persönlichen Triumphes sowie – hoffentlich – als Indiz für eine Konsolidierung des Festa-Verlags werten, ohne dessen Bücher der deutsche Grusel-Fan fast gänzlich in einem von zahnlosen Vampir-Lovern bevölkerten Trash-Sumpf gefangen säße: eine schreckliche Vorstellung!
Inhaltlich blieb es bei der bewährten „Omen“-Mischung aus Kurzgeschichten und Artikeln, wobei primär im Verlagshaus Festa beheimatete oder dort kurz vor dem Einzug stehende Schriftsteller zu Wort kommen; eine legitime Selektion, da diese Mieter einerseits ihr Handwerk verstehen, während der Leser andererseits gern Näheres über sie bzw. ihre Werke wissen möchte.
Zudem beschäftigt sich der mit Abstand beste Beitrag dieses Bandes mit einem Non-Festa-Autoren (ein Zustand, der sich hoffentlich irgendwann ändern wird): Der Künstler und lebenslange Freund John Mayer erinnert (sich) in „Die dunkle Muse von Karl Edward Wagner“ an das tragische Schicksal dieses Horror- und Fantasy-Autoren, der den ungewöhnlichen |Sword-&-Sorcery|-Barbaren Kane schuf. Sein Text ist ebenso informativ wie ergreifend, da Mayer, der selbst auf ein schwieriges Leben zurückblickt, immerhin ansatzweise begreiflich machen kann, wieso ein talentierter Mensch wie Wagner sich selbst zugrunderichtete.
|Diverse Oden an Mr. Lumley|
„Omen 3“ ist seitens des Herausgebers ansonsten dem britischen Schriftsteller Brian Lumley gewidmet. Es gibt ein (inzwischen tüchtig angejahrtes) Interview mit ihm, dessen „Necroscope“-Saga wohl den zentralen Stützpfeiler des Festa-Verlagsprogramms bildet. Lumley gibt Auskunft über die Genese dieser vielbändigen Erfolgsserie und seine zahlreichen weiteren Werke. Herausgeber Festa erinnert sich in „Something about Brian“ an seine persönliche Verbindung mit Lumley, der ihm längst ein Freund geworden ist.
Ein weiterer Freund, der aus der Schweiz stammende Komiker Helmi Sigg, legt die Fan-Story „Silberne Ketten – Aus dem Leben von Brian L.“ vor, die möglicherweise tatsächlich komisch ist – der Rezensent ist zwar anderer Ansicht, beansprucht in dieser Hinsicht aber keine Urteilshoheit -, aber immerhin kompetent geschrieben Lumleys reales Leben mit der „Necroscope“-Reihe verknüpft und ungeahnte Parallelen enthüllt.
Der so Geehrte trägt drei frühe und vor allem unbekannte Storys bei. Während „Die Vorlesung“ auf einen Schlussgag hinausläuft, dessen Bart mindestens ebenso lang wie die Geschichte der modernen Phantastik ist, stellen „Die Muschel aus Zypern“ und „Die Tiefseemuschel“ zwei spannende Gruselgeschichten dar, die sich aufeinander beziehen und in „Omen 3“ wie die Schalen einer echten Muschel als erster und letzter Beitrag die übrigen Interviews, Berichte und Storys umschließen: eine hübsche Idee, die gut funktioniert.
|Deutsche Phantastik einst|
Wenn man die übrigen Erzählungen Revue passieren lässt, wirkt „Omen 3“ wie ein Nachtrag zur (leider) eingestellten Festa-Reihe „Die bizarre Bibliothek“. Vor allem Karl Hans Strobls (1877-1946) recht ausführliche Erzählung „Der betrogene Tod“ aus dem Jahre 1924 erinnert an die große Tradition der deutschen Phantastik, die durch den auch kulturellen Nazi-Terror einen Schlag erhielt, von dem sie sich nie wirklich erholte bzw. zu der sie den Anschluss nach 1945 nicht mehr fand. „Der betrogene Tod“ bietet nicht nur eine gruselige Geschichte, sondern auch ein Feuerwerk selten gewordener oder ausgestorbener Wörter und Formulierungen. Was sich anfangs mühsam liest, entfaltet schnell einen eigenen Zauber: Diese Geschichte wirkt heute noch mehr als 1924 wie eine Überlieferung aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges!
Was diese deutsche Phantastik auszeichnet, erläutert Strobls‘ Zeitgenosse Anton Altrichter (1882-1954) in einem Nachwort, das Frank Festa dessen Erzählung anschließt. Dieser Beitrag ist doppelt interessant: als Information und als historisches Dokument, wobei heute diese beiden Ebenen nicht voneinander zu trennen sind bzw. getrennt werden dürfen. Leider fehlt ein moderner Blick auf Strobl und Altrichter, die beide ihr Leben und Wirken ab 1933 eng mit dem Nationalsozialismus verknüpften. Altrichters Beitrag lässt entsprechendes „völkisches“ Gedankengut durchscheinen, und auch Strobl mischt bereits „Blut-&-Boden“-Elemente in seine Version der Vergangenheit.
Thematisch breiter geht Jakob Elias Poritzky (1876-1935) – der eigentlich Isak Porycki hieß – in seinem Beitrag „Fantasten“ auf zeitgenössische deutsche und europäische Autoren ein. Er weiß die eigentümliche Mischung aus Verfremdung, Halluzination und schwüler – schnell schwülstiger – Erotik deutlich zu machen, die Autoren wie Hanns Heinz Ewers, Karl Heinz Strobl, Alfred Kubin und andere kennzeichnen. Zudem legt Poritzky die Wurzeln solcher „bizarren Phantastik“ offen und folgt ihnen bis ins Mittelalter. Leider fehlt auch hier eine aktuelle Bewertung dieses Beitrags. So bleibt Poritzkys „Fantasten“ vor allem eine – interessant zu lesende – literaturhistorische Kuriosität.
|Deutscher Horror heute|
Hatte uns Frank Festa in den früheren „Omen“-Ausgaben vor dem deutschen Grusel des 21. Jahrhunderts bewahrt, mogelt er dieses Mal (versuchsweise?) zwei (glücklicherweise) kurze Storys aus diesem unseren Lande ein. Uwe Vöhls „Nyctalus“ und Christian Endres‘ „Instinktiv“ spiegeln ein bekanntes Dilemma wider: Handwerklich durchaus kompetent geschrieben, präsentiert der eine Autor ein tausendfach erzähltes (und in zweitausend Horrorfilmen verwurstetes) „Post-Doomsday“-Garn ohne Überraschungen und mit einem tragisch gemeinten aber kalt lassenden Schlussakkord. Der andere richtet den Blick in die in die Vergangenheit und produziert eine weitere jener Lovecraft-&-Poe-Pastiches, die vor allem in sich selbst ruhen, einer deutschen Phantastik aber keine neuen Impulse bringen.
|Was haben wir noch? – Storys|
In seinen Story-Sammlungen lässt Frank Festa gern Versuchsballons steigen. Dieses Mal lernen wir mit zwei Kurzgeschichten den in Großbritannien bereits bekannten, ausschließlich unter Pseudonym arbeitenden „John B. Ford“ (*1963) kennen. Auch er stützt sich schwer auf surreale Großmeister des Genres; Thomas Owen (1910-2002), Walter de la Mare (1873-1956) oder Jean Ray (1887-1964) kommen einem in den Sinn. Herausgeber Festa vergleicht ihn mit Thomas Ligotti, doch auch diese Fußstapfen sind definitiv zu groß. Tatsächlich bieten „Die Illusion des Lebens“ und noch mehr „Der Feind in uns“ leidlich groteske Stimmungsbilder, die in eine Handlung eingebettet werden, die sich sehr oder allzu bekannter Horror-Motive bedient.
„Der Wurm von Vendren“ ist eine weitere Geschichte, die Brian McNaughton (1935-2004) in einer an Clark Ashton Smith angelehnten „Weird-Fantasy“-Welt ansiedelt, wobei McNaughton die exotische Dekadenz des Vorbilds zugunsten eines trockenen, rabenschwarzen Humors in den Hintergrund rückt. Während McNaughton mit „Ringard und Dendra“ – einer u. a. in Festas Anthologie „Necrophobia II – Die graue Madonna“ aufgenommenen Story – eher witzlos blieb, erfüllt „Der Wurm von Vendren“ die Intentionen seines Verfassers deutlich besser.
|Was haben wir noch? – Interviews|
Seit einiger Zeit orientiert sich Frank Festa teilweise neu. Zu den klassischen Verlags-Standbeinen wie Lovecraft, Lumley oder F. Paul Wilson kommen verstärkt Autoren, die den Horror entweder hemmungslos bizarr (Carlton Mellick III) oder gnadenlos blutig (Brett McBean) servieren; oft gelingt ihnen sogar beides.
In den Startlöchern steht bei Festa Edward Lee, der in den USA seit Jahren mit morbid sexuellen, exzessiv gewalttätigen Horror-Thrillern für Furore sorgt. Was den Leser erwartet, fasst Frank Festa in „Einige Gedanken zu Edward Lee“ zusammen; er dürfte recht heftig über uns kommen …
Wie man die junge US-Generation mit religiösem Gedankengut vertraut macht, erläutert uns der Theologe und Horror-Schriftsteller Kim Paffenroth. So lässt sich beispielsweise das Phänomen der Auferstehung durch den Ausbruch einer globalen Zombie-Epidemie begreiflich machen. Paffenroth scheint dies ernst zu meinen. Seine beiden im Festa-Verlag erschienenen Romane lassen sich glücklicherweise auch unter Vernachlässigung solchen Subtextes gut lesen.
Schließlich gibt noch Laurell K. Hamilton Auskunft über ihren Werdegang und ihre Erfolgsserie um die Totenlenkerin & Vampir-Henkerin Anita Blake, mit der die Autorin nachdrücklich beweist, dass sexuelle Drastik dem Genre immer noch besser bekommt als die genitalfreie Minne jener Edwards & Bellas, die den Horror immer schlimmer in Verruf bringen.
|Unterm Strich|
Abgeschlossen wird „Omen 3“ durch ein Verzeichnis der bis Oktober 2011 (tatsächlich) erschienenen Festa-Titel – eine beeindruckende Liste, die verdeutlicht, welche Akzente ein ‚Kleinverlag‘ zu setzen vermag, der nicht mit dem Mainstream schwimmt, sondern nach neuen Namen und neuen Entwicklungen sucht.
Der Leser wünscht sich ein „Horror-Journal“ wie das „Omen“ öfter, der Realist muss anerkennen, dass der Markt für solche Werke begrenzt ist. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt: Wenn das Festa-Programm schon keinen vierten Band der „Necrophobia“-Reihe mehr beinhaltet, wird es – und sei es wieder erst in Jahren – vielleicht ein „Omen 4“ geben.
Paperback: 255 Seiten
Übersetzung: Alexander Amberg, Andreas Diesel
Cover: F. Fiedler
ISBN-13: 978-3-935822-74-9
[www.festa-verlag.de]http://www.festa-verlag.de
_Das |Omen|-Journal bei |Buchwurm.info|:_
[„Omen 2“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=1525
Barnais, Georgius Jo – Tod im Theater, Der
_Das geschieht:_
Hart ist das angeblich so schöne Künstlerleben im Paris der 1950er Jahre, weil die Konkurrenz groß ist. Es gibt nur wenige Gewinner, die von den nicht vom Glück Begünstigten beneidet und gehasst werden. Der junge Bariton Jo Barnais ist so ein Pechvogel, der sich mehr schlecht als recht von Auftritt zu Auftritt durchschlägt, obwohl er die Szene genau kennt.
Der Tenor Camille Manola steht hingegen auf dem Zenit seiner Karriere, wird ständig gebucht, ist reich und ein Idol der Massen. Nach zwei Jahren Abstinenz kehrt er unter großem Medienrummel auf die Bühne zurück. Ob seine Sangeskunst gelitten hat, kann nicht festgestellt werden, denn noch vor dem ersten Ton trifft ihn eine Kugel in die Kehle.
Unter den entsetzten Zuschauern ist auch Jo Barnais. Er wird direkt in die Ermittlungen einbezogen, denn sein ‚Freund‘, der rücksichtslose Kommissar Lambert, bedient sich seiner als Laufbursche und Spitzel, der sich hinter den Kulissen der Pariser Bühnenwelt umschauen soll. Dass es dort gärt, wird definitiv klar, als es kurz darauf Manolas Nachfolger einem Sprengstoffanschlag zum Opfer fällt.
Verdächtige gibt es viele, denn niemand konnte die Verstorbenen leiden. Intrigen und verwickelte Liebschaften erschweren den Versuch, ein Motiv und damit den Täter zu finden. Mögliche Spuren erweisen sich als Sackgassen, obwohl sich der Mörder bald nicht mehr zurückhält und sogar anonyme Botschaften verschickt. Er weiß um die Ratlosigkeit der Polizei – und seine Mission ist noch nicht beendet, wie schon bald ein weiterer Tenor feststellen muss …
|Künstlerwelt im künstlichen Zwielicht|
Mord in der Pariser Theaterwelt: Dies bedeutet hier weniger das kriminalistische Spiel, die Suche nach Indizien, die Jagd nach dem Mörder, sondern die Reise in Spießers Wunderland – das Halbwelt- und Rotlicht-Milieu, welches der Boheme seit jeher gleichgestellt wird. O-la-la-Anzüglichkeiten, die aufgrund des Erscheinungsdatums erwartungsgemäß ziemlich verdruckst ausfallen, sollen für einen frivolen Grundton sorgen, der heute ranzig wirkt.
Unterstützung sucht der Verfasser in einer höchst blumigen Sprache, die ebenfalls irritiert, aber dem Szene-Jargon der Zeit entsprochen haben mag. Heute möchte man den Ich-Erzähler ob seiner im Übermaß eingesetzten, neckisch-kindischen Verniedlichungen und barocken Zuckergusses aber lieber ausgiebig beuteln.
Die Handlung selbst tritt besonders zwischen den Morden arg auf der Stelle. Nur locker scheint der Verfasser mit den Methoden der Polizeiarbeit vertraut. Stattdessen setzt er auf einen energischen Kommissar mit genialen Einfällen, die allerdings nur deshalb so wirken mögen, weil er sich die meiste Zeit mit Andeutungen begnügt oder gänzlich in geheimnisvolles Schweigen hüllt.
|Sie fallen wie die Fliegen|
Dem Leser fällt etwas Eigentümliches auf: Sämtliche Figuren dieses Romans wirken außerordentlich unsympathisch. Das kann vom Verfasser so nicht gewollt sein. Fragt sich also, was da geschehen ist. Einfach ist die Ablehnung an der Figur des Kommissars Lambert zu begründen. Den will Barnais als harten, vom Job geprägten Bullen charakterisieren, den längst nichts mehr überraschen kann. Tatsächlich erleben wir einen selbstherrlichen und herablassend jovialen, das Gesetz nach Belieben brechenden Miniatur-Diktator, der mit den Bürgern, die er schützen soll, wie mit Leibeigenen umspringt.
Auch der legendäre Maigret ist ein Patriarch, nach dessen Pfeife man zu tanzen hat, aber er ist keineswegs so ein Kotzbrocken wie Lambert. Man fragt sich, ob da nicht einschlägige und unerfreuliche Erfahrungen den Verfasser inspirierten. Belegt ist in der Tat, dass die Pariser Polizei nicht zimperlich war oder ist. Dennoch nervt die Servilität des Sängers Jo Barnais, der sich ohne Widerstand von Kommissar Lambert in eine gar nicht ungefährliche Rolle zwingen lässt. Auch sonst ist er ein flatterhafter Zeitgenosse, der hinter einer Fassade aus Selbstbetrug und vorgespieltem Zynismus nicht halb so schick und unkonventionell wirkt, wie das sein geistiger Vater wohl geplant hat.
|Spießer kriegt Stilaugen|
Frauen sind in der Pariser Künstlerwelt hübsch, aber entweder falsch, weil lotterhaft und stets auf ihren Vorteil bedacht, oder naiv bis dumm, aber auf jeden Fall für den raschen Verbrauch geschaffen. Das gilt auch für die |“hübschen Milchmädchen“|, die |“jungen Fleischwarenverkäuferinnen“|, die |“kleinen Modistinnen“| (S. 80), die – da nicht dem eigenen Milieu gehörend – Freiwild und Spottvieh sind. Deshalb muss Barnais auch kein schlechtes Gewissen plagen, wenn er sie nach Kräften belügt und ausnutzt. Ja, so ist er halt, der angeblich liebenswerte Pariser Künstler; die ganze Nacht auf den Beinen, mittags im Bett liegend (möglichst nicht allein), ansonsten im Cafè sitzend, um den neuesten Klatsch auszutauschen. So sahen ihn die zeitgenössischen Medien allzu gern, und der Verfasser sieht keinen Grund, solche Klischees nicht ausgiebig zu bedienen.
Hässlichkeiten verbreitet der Autor – natürlich, muss wohl sagen – gegen homosexuelle Kollegen. Mordopfer Manola ist schwul und wird so dargestellt, dass er sein Schicksal als ‚Strafe‘ mehr oder weniger verdient. Üble Nachrede und ironische Anmerkungen von Kommissar Lambert gibt’s gratis dazu.
|Der Film zum Buch|
Ein Erfolg ist „Der Tod im Theater“ zumindest in Deutschland offenbar nicht gewesen, wo uns die übrigen Werke des Jo Barnais erspart blieben. In Frankreich wurde „Mort aux ténores“ dagegen noch 1987 im Rahmen der TV-„Série noir“ verfilmt; die Titelrolle spielte ein Schauspieler mit dem Namen „Lucky Blondo“, was bereits kein Meisterwerk des Kriminalfilms vermuten lässt …
_Autor_
„(Georgius) Jo Barnais“ ist ein Pseudonym, hinter dem sich ein künstlerisches Multitalent verbirgt: Georges Guibourg, Sänger, Schauspieler, Drehbuch- und Theater-Autor, Komponist, Schlagertexter, Schriftsteller. Auch bekannt als Theodore Crapulet, war Guibourg einer der bekanntesten und beliebtesten Künstler von Paris. Seine Karriere umspannt mehr als ein halbes Jahrhundert.
Geboren wurde Guibourg 1891 in Mantes la Ville, Yveline, Ile de France. Mit 16 Jahren ging er nach Paris, wo seine Laufbahn der seines Helden Jo Barnais glich. Guibourg war allerdings ungleich erfolgreicher, trat auf der Bühne auf, sang Schlager, Operetten und arbeitete sich bis zum Star der Konzerthallen und Kabaretts hoch. In den 1920er und 30er Jahren stellte er seine eigene, ebenfalls sehr erfolgreiche Komikertruppe zusammen, ab 1932 trat er in Kinofilmen auf. Daneben arbeitete er weiter fürs Theater, schrieb Schlager – und Kriminalromane.
Georges Guibourg starb im Januar 1970. Er hinterließ ein reiches künstlerisches Werk; nichts „Unsterbliches“, aber u. a. mehr als 1500 Schlager, die überall in Frankreich zu hören waren.
|Taschenbuch: 205 Seiten
Originaltitel: Mort aux ténors (Paris : Librairie Gallimard 1956)
Übersetzung: Maria Lampus|
Vyleta, Dan – stumme Zwilling, Der
_Das geschieht:_
Im Oktober des Jahres 1939 ist Österreich an das Deutsche Reich angeschlossen. Mit den Nationalsozialisten kamen neue Gesetze, die vor allem den Ausschluss jüdischer Mitbürger aus Ämtern und Würden forcierten. Die alten Strukturen sind ins Rutschen gekommen. Wer jetzt wendig und skrupellos genug ist, dem bietet das Regime ungeahnte Aufstiegschancen.
Zu den Nutznießern der neuen Zeit gehört in Wien Professor Speckstein, der vor Jahren nach einem Skandal seinen Lehrstuhl aufgab und sich ins Privatleben zurückzog. Nun verdingt er sich als „Zellenwart“ bei den Nazis: Er führt Buch über die Mitbewohner in seinem Haus und meldet, wer sich nicht im Sinn der neuen Herren benimmt. Endlich ist Speckstein wieder jemand, den man achtet bzw. achten muss, doch beliebt ist er nicht: Gerade wurde sein alter Hund grausam abgeschlachtet.
Der Psychologe Anton Beer betreibt im Haus eine kleine Praxis für Allgemeinmedizin. Er lebt unauffällig und wurde kürzlich von der Gattin verlassen. Unter dem Vorwand, seine im Haushalt lebende Nichte Zuzka zu untersuchen, die unter nervösen Störungen leidet, sucht Speckstein den Rat des jungen Kollegen: Die Polizei hat ihn als Sachverständigen in einem offenen Serienmordfall hinzugezogen. Bereits vier Männer und Frauen wurden niedergestochen; ein Verbrechen, das die Nazis herrisch aufgeklärt wissen wollen, wobei ihnen auch ein geständiger Sündenbock recht ist.
Zusätzlich wird Beer vom opportunistischen Kriminalkommissar Teuben unter Druck gesetzt. Beer muss sorgfältig taktieren, denn er pflegt die gelähmte Zwillingsschwester des Varietékünstlers Otto Frei, die sonst den Euthanasie-Schergen der Nazis in die Hände fiele. Außerdem gibt es da noch ein Geheimnis, das Teuben unter keinen Umständen erfahren darf …
_Die Barbaren sind gekommen_
Wie würdest du dich verhalten, wenn das Böse nicht nur die Macht ergriffen hat, sondern sogar Gesetz geworden ist? In „Der stumme Zwilling“ spielt Dan Vyleta die möglichen Reaktionen am Beispiel der (bisher) ultimativen historischen Katastrophe durch. Der Nationalsozialismus machte die Unmenschlichkeit nicht nur salonfähig, sondern erhob sie sogar zum Programm. In dem dadurch entstandenen moralischen Vakuum wurden diejenigen, die den kriminellen und obskuren Standards der neuen Machthaber nicht entsprachen, zu grausam verfolgten Opfern.
Nicht um sie kreist diese Geschichte, sondern um diejenigen Zeitgenossen, die sich grundsätzlich nicht fürchten mussten, weil sie sich dem Nazi-Regime fügten sowie dessen rassistischen Vorgaben genügten. Sie blieben unbehelligt, wurden aber zu Zeugen alltäglichen Unrechts und mussten sich individuell entscheiden: Bleibe ich ’neutral‘, verschließe aber meine Augen und werde zum Mitläufer? Schließe ich mich den Nazi-System an, das mir gute Karrierechancen bietet, und werde ich Nutznießer? Bleibe ich moralischen Grundsätzen verpflichtet und leiste zumindest passiven Widerstand?
Das alte Haus in einem nur scheinbar stillen Winkel der Großstadt Wien wird zum Ort stiller aber existenzieller Entscheidungen, die buchstäblich lebensgefährlich werden können, „Der stumme Zwilling“ zu einem Thriller, in dem es nicht um Täter und Opfer geht, die im kriminologischen Spiel umeinander kreisen: Die Vertreter beider Seiten sind dem Leser stets bekannt.
|Verbrechen als Alltag|
Die dem ’normalen‘ Krimi-Freund zunächst wie die Mohrrübe dem Karrenesel dargebotene Gruselstory vom irren Serienkiller, der in den Straßen Wiens Tiere und Menschen aufschlitzt, erweist sich als Chimäre, die nahtlos in ein anderes Verbrechen übergeht: Aus realiter nicht miteinander in Verbindung stehenden Morde wird eine Gräueltat konstruiert, die den neuen Herren als ‚Begründung‘ und Vorwand für die Umsetzung bizarr missbrauchter ‚Gesetze‘ dienen kann.
Die Allgegenwärtigkeit des legalisierten Verbrechens provoziert eine Stimmung der Angst und Bedrückung, für die Vyleta entsprechende Bilder und Worte findet. Im sechsten Jahr der „Machtergreifung“ werden die Nazis nachlässig in der Vertuschung ihrer Bluttaten. Der gerade begonnene Krieg lenkt die Aufmerksamkeit auf die täglich weiter vorgeschobenen Fronten. Im nach diversen Grenzerweiterungen gewaltig angeschwollenen „Reich“ werden die Zügel fester angezogen. Auch in Wien ‚verschwinden‘ die jüdischen Mitbürger. Dass geistig und körperlich behinderte Menschen von Staatswegen umgebracht werden, ist kein Gemunkel mehr; für Anton Beer wird dieses Wissen zur Quelle seines persönlichen Widerstandes.
Kriminalkommissar Teuben ist das repräsentative Beispiel für den Nazi-Emporkömmling: nicht intelligent aber schlau den persönlichen Vorteil erkennend, ihn dreist nutzend sowie seine Stellung missbrauchend, um sich zu bereichern und sich an denen zu rächen, die ihn vor der Nazi-Zeit übersehen oder herablassend behandelt haben. Sein Ende ist verdient, aber dessen Vertuschung demonstriert gleichzeitig die Korrumpierung seiner Mörder, die nur unter dem Nazi-Druck zu perfekten Mördern mutieren konnten.
|Das Perpetuum mobile der Unterdrückung|
Zur Steigerung des Schreckens trägt das Wissen um ein ebenso perfides wie perfektes Überwachungssystem bei. Die Nazis instrumentalisieren ganz normale Zeitgenossen, die ihre Mitmenschen überwachen. Professor Speckstein stellt das bestmögliche Beispiel dar. Indem er sich als „Zellenwart“ (in Deutschland hätte man ihn „Blockwart“ genannt) an die Nazis verkaufte, bekam er wieder Rang, Namen sowie eine Uniform. Doch er hat einen Handel mit dem Teufel geschlossen, wie er inzwischen weiß. Seinen Diensteifer kann der daraus entwickelte Selbsthass allerdings nicht dämpfen: Vyleta kennt keine simpel gestrickten Figur-Charaktere oder daraus resultierende ‚einfache‘ Handlungsauflösungen. Die Realität war (und ist) komplex, gerade in der Krise wird die Grenzschicht zwischen ‚Gut‘ und ‚Böse‘ dünn, oder sie löst sich gänzlich auf.
Anton Beer ist deshalb nur vorgeblich der ‚Held‘ dieser Geschichte. Er würde gern in seinem unauffälligen Leben verharren, das ihm als Deckung dient. Das persönliche Geheimnis – hier sei es dem potenziellen Leser verschwiegen – würde ihn selbst in den Strudel der Nazi-Willkür ziehen. Unwillig und Stück für Stück wird er in die kriminellen Umtriebe verwickelt. Vyleta verwandelt das alte Haus dabei in einen Dampfkessel, dessen Bewohner buchstäblich im eigenen Saft weichgekocht werden. Einige überstehen diese Prozedur nicht, andere entdecken bisher unbekannte – aber durchaus nicht immer positive – Qualitäten in sich.
|Wien und seine hässlichen Seiten|
Schon bevor die Nazis kamen, dürfte das Haus kein glücklicher Ort gewesen sein. Vyleta schildert es als Spiegelbild der Wiener Großstadt-Gesellschaft. Während in den oberen Geschossen die etablierten Herrschaften ein großbürgerliches Leben führen, das noch immer von der 1918 geendeten Kaiserzeit geprägt ist, geht es in den unteren Stockwerken weniger vornehm zu. Armut, Vorurteile, Familiengewalt, Alkoholismus und ein als Alltäglichkeit hingenommener Hygienemangel werden von Vyleta abermals in eindringlichen Worten und mit bizarren aber deshalb umso einprägsameren Bildern thematisiert.
Folgerichtig endet die Geschichte keineswegs ‚happy‘, sondern konsequent und vor allem überraschend. Der Verfasser wirbelt seine Protagonisten zum Abschluss kräftig durcheinander und beschert ihnen Schicksale, mit denen der Leser nicht gerechnet hätte. Wunder bleiben aus, aber die lähmende Decke aus Verbrechen und Verrat, die von den Nazis über Wien geworfen wurde, ist nicht völlig dicht. Auch der passive Widerstand hat seine Konsequenzen, und ‚Belohnungen‘ für moralisch korrektes Verhalten bleiben in der Regel aus. Dass einige Figuren dem Terror zeitweise oder womöglich gänzlich entkommen, ist vor allem dem Zufall geschuldet. Wie Vyleta dies umsetzt, setzt seinem ungewöhnlichen, bedrückenden, dichten, spannenden und bewegenden Roman würdig die Krone auf. Als ‚Krimi‘ mag „Der stumme Zwilling“ in der Grenzzone des Genres liegen, aber sollte man diese ohnehin nie allgemeingültig definierte Grenze nicht aufbrechen, um den Leser mit Spielarten des Verbrechens zu konfrontieren, die nicht wie auf Schienen endlos ausgefahrenen Kill-Thrill- und Wer-wars?-Spurrillen folgen? Nach der Lektüre dieses Buches ist dies eine rhetorische Frage.
_Autor_
Dan Vyleta wurde 1974 in Gelsenkirchen geboren. In den 1960er Jahren waren seine regimefeindlichen Eltern durch den „Eisernen Vorhang“ in die Bundesrepublik Deutschland geflohen. Hier wuchs Vyleta auf, verließ aber das Land, um in England Geschichte zu studieren. Seinen Doktorgrad erwarb er am King’s College in Cambridge. Anschließend lektorierte er wissenschaftliche Veröffentlichungen. Er kehrte nach Deutschland zurück, wo er in Berlin lebte.
2008 veröffentlichte Vyleta, der nun im kanadischen Edmonton lebt und arbeitet, seinen ersten Roman. „Pavel & ich“ wurde von der Kritik freundlich aufgenommen. Vyleta blieb dem Historien-Roman – den er mit Elementen des Krimis erzählt – auch in seinem zweiten Werk treu, das im Wien des Jahres 1939 spielt; ein Umfeld, in dem der Verfasser sich durch seine historische Forschungsarbeit – seine Doktorarbeit trägt den Titel „Crimes, News, and Jews, Vienna 1895-1914“ – ausgezeichnet auskennt.
|Gebunden: 414 Seiten
Originalausgabe: The Quiet Twin (London : Bloomsbury Publishing Plc. 2011)
Übersetzung: Werner Löcher-Lawrence
ISBN-13: 978-3-8270-0971-5|
[danvyleta.com]http://danvyleta.com
[www.berlinverlage.com]http://www.berlinverlage.com
_Dan Vyleta bei |Buchwurm.info|:_
[„Pavel & ich“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=6694
Freeman Wills Crofts – Das Verbrechen von Guildford

Freeman Wills Crofts – Das Verbrechen von Guildford weiterlesen
Robert Martin – Die zweite Flasche Whisky

Robert Martin – Die zweite Flasche Whisky weiterlesen
Rex Gordon – Der Mars-Robinson (TERRA 79)
„Projekt M 76“ bezeichnet den Versuch Großbritanniens, den Nachbarplaneten Mars zu erreichen. Weder die US-amerikanischen Verbündeten noch die bösen Sowjets ahnen etwas von dem Raumschiff, das mit sieben Astronauten an Bord sein Ziel ansteuert. So wird es auch bleiben, denn ein Unfall im All kostet fast die gesamte Besatzung das Leben. Es überlebt nur Ingenieur Gordon Holder, der ohne Pilotenausbildung eine Bruchlandung auf dem Mars hinlegt.
Dort ist er nun gestrandet und gilt als tot. (Funk gab es seltsamerweise nicht an Bord.) Auf dem öden Mars ist die Luft dünn, das Wasser knapp und die Luft schneidend kalt. Es existieren nur seltsame, halbwegs essbare Pflanzen und phlegmatische Insekten. Aber Holder entdeckt den Robinson Crusoe in sich und beginnt, sich mit seinen beschränkten Hilfsmitteln aber viel Hirnschmalz ein Refugium zu schaffen. Er errichtet eine Wasser-Destille, stellt Sauerstoff her und baut sich einen Raupenbuggy, mit dem er die nähere und weitere Entfernung erkundet.
John Scalzi – Der wilde Planet
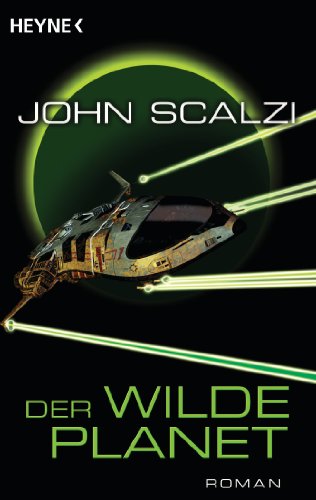
John Scalzi – Der wilde Planet weiterlesen
Ronald A. Knox – Der Mord am Viadukt
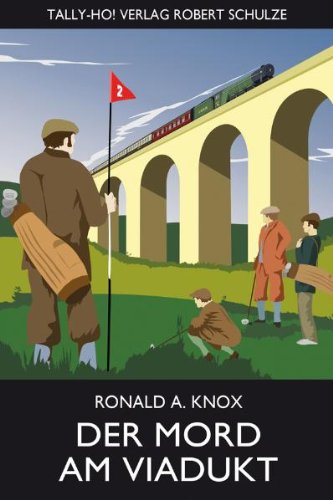
Ronald A. Knox – Der Mord am Viadukt weiterlesen
Johnson, Ronald – Glutroter Horizont
_Das geschieht:_
Journalist Joe Lennard ist nur selten im heimatlichen London anzutreffen. Lieber hält er sich dort auf, wo just etwas los ist auf dieser Welt. Augenblicklich macht er jedoch Urlaub auf den Bahamas. Er hat die „Shark“, das Boot des alten Moses Mackay gechartert. Die beiden Männer kreuzen die karibische See.
Lennard möchte dem einsamen Atoll Bravo Key einen Besuch abstatten. Hier werden Moses und er von einem Hurrikan überrascht und müssen Unterschlupf in den Höhlen der kleinen Insel suchen. Während das Unwetter tobt, wird die „Firestreak“ auf die Klippen geworfen. Lennard und Moses können sechs Männer und eine Frau retten.
Damit ist es vorbei mit der Ruhe im Tropenparadies. Kapitän Carlos Camenidas und seine Leute entpuppen sich als bis an die Zähne bewaffnete Exilkubaner, die sich auf ihre Heimatinsel einschleichen wollen, um dort eine Konterrevolution gegen den verhassten Fidel Castro anzuzetteln.
Ein irrwitziger Plan, der Lennard misstrauisch stimmt, zumal er in Camenidas einen Castro-Anhänger wiederzuerkennen glaubt, dem er vor Jahren auf Kuba begegnet war. Ist der Kapitän ein Doppelagent? Lennard ist abgelenkt, denn da ist noch die junge Belle Brannigan, die mit den Männern reist. Sie ist von Camenidas und seinem Plan überzeugt, aber trotzdem nicht abgeneigt, sich in Lennard zu verlieben. Das sieht Caminidas gar nicht gern.
Die Motoren der „Firestreak“ sind defekt, also lässt Camenidas kurzerhand die „Shark“ besetzen. Lennard und Moses können flüchten. Sie planen den Kampf gegen die Piraten. Dabei müssen sie nicht nur wegen der feindlichen Überzahl vorsichtig sein, denn Camenidas hat inzwischen Belle von der Geliebten zur Geisel degradiert …
|Große Gewehre auf kleiner Insel|
Terror und Tod auf einer einsamen Tropeninsel: Wahrlich kein neuer Einfall, der hier freilich gut umgesetzt wurde. Der Kontrast zwischen dem paradiesischen Eiland und dem Kampf auf Leben und Tod ist freilich reizvoll und wird effektvoll genutzt. Ein Wirbelsturm, tiefe Höhlen, hohe Klippen, ein uraltes Fort aus bunter Piratenzeit: Johnston gelingt es, die Kulisse voll in den Dienst der Handlung zu stellen. Zu Lande und zu Wasser wird gerauft und geschossen (sogar ein Düsenjäger greift an), wobei das Meer zusätzlich von unfreundlichen Kreaturen bewohnt wird, die spannungsfördernd ins Geschehen eingreifen.
Anspruchsvoll ist unsere Geschichte nicht, aber es macht Spaß sie zu lesen. Man wird durchaus an die karibischen Episoden diverser James-Bond-Klassiker oder anderer Action-Streifen der 1960er Jahre erinnert, was sicherlich vom Verfasser gewollt ist. Die geradlinige Handlung und die wohldosierten Landschaftsbeschreibungen lassen vor dem geistigen Auge des Lesers sowieso einen Film ablaufen.
|Nicht denken, sondern handeln|
Unzweifelhaft ein (unvermuteter) Pluspunkt: die Figurenzeichnung. Sie fällt wesentlich vielschichtiger aus, als man es in einem simplen Abenteuerroman vermuten würde. Zwar ist Joe Lennard der rasende Reporter schlechthin; ein einsamer Wolf, der die Welt durchstreift und sich fürchtet, von einer Frau ‚angebunden‘ zu werden. Praktisch (aber logisch begründet) ist natürlich die Nahkampfausbildung aus Kriegszeiten, die auf Bravo Key eindrucksvoll zum Einsatz kommt.
Gleichzeitig sind Lennard Selbstzweifel und Schwächen nicht fremd. Gewalt erfüllt ihn mit Skrupeln, die nur der Selbsterhaltungstrieb überwinden kann. Außerdem hegt er trotz erheblicher Kritik mehr Sympathie für Fidel Castro und seine Sache, als es für einen braven angelsächsischen Kommunistenfresser dieser Ära üblich ist.
Lennard und der alte Moses Mackay sind Freunde und Kampfgefährten ohne peinliche Verbrüderungsobsessionen. Heutzutage fallen Passagen auf, die einzig dem Zweck dienen, zu verdeutlichen, dass „Neger“ (das durfte man damals noch sagen) und „Weiße“ einfach nur Menschen sind. In den 1960er Jahren war das noch längst keine Selbstverständlichkeit.
|Schöne Frau und nicht gar zu hässlicher Schurke|
Pech hat Belle Brannigan, denn die weibliche Gleichberechtigung war noch nicht ganz so weit. Abenteuerlustig ist sie, aber in die Karibik reist sie wahlweise als Geliebte oder Gefangene diverser starker Männer. Hier und da darf sie ihren Unmut über diverse Ungerechtigkeit äußern, aber dabei ist sie meist gefesselt sowie leicht beleidigt und läuft über den Sand davon, wobei der Verfasser ihre körperlichen Vorzüge zur Geltung kommen lässt.
Carlos Camenidas ist als Figur eine echte Überraschung. Er tritt entschlossen und rücksichtslos auf, aber ein menschenverachtender Fanatiker ist er nicht. In einem langen Rückblick schildert Johnston seinen traurigen Werdegang im korrupten, von mörderischer Geheimpolizei tyrannisierten Vor-Castro-Kuba. Camenidas ist der Repräsentant derer, die sich von der Revolution tatsächlich Gerechtigkeit erhofften. Dass sie den einen Diktator (Battista) gegen einen anderen (Castro) eintauschten, blieb ihnen unklar – sie wollten es eigentlich auch gar nicht wissen.
Nichtsdestotrotz endet für Camenidas dieses Abenteuer mit einer Niederlage, aber immerhin nicht mit jenem möglichst scheußlichen Tod, den ihm Hollywood als ‚gerechte Strafe‘ zweifellos reserviert hätte. Solche Ausgewogenheit vollendet den günstigen Eindruck, den dieser von der Zeit bzw. seinen Lesern längst vergessene aber unterhaltsame Roman hinterlässt.
_Autor_
Ronald Johnston (geb. 1926) ist viele Jahre für die britische Handelsmarine zur See gefahren. Diese Erfahrungen fließen in seine Abenteuerromane ein, die stets mit dem Wasser zu tun haben. Bekannt geworden ist er mit einer Serie über die Erlebnisse der fiktiven „Inoco-Oil-Company“-Tankerflotte, was in diesen politisch bzw. ökologisch korrekten Zeiten wohl kaum noch möglich wäre.
Dieser Johnston ist übrigens der Vater von Paul Johnston, der ebenfalls Schriftsteller geworden ist und dem sein Durchbruch mit der orwellschen Krimi/Science-Fiction-Serie um den schottischen Ermittler Quintilian Dalrymple gelang.
|Taschenbuch: 151 Seiten
Originaltitel: Red Sky in the Morning (London : Collins 1965)
Übersetzung: Hans-Ulrich Nichau|
[www.randomhouse.de/goldmann]http://www.randomhouse.de/goldmann
Knox, Ronald A. – Tote im Silo, Der
_Das geschieht:_
Walter und Myrtle Halliford laden gern und oft Gäste auf ihr Landgut Lastbury Hall in der westenglischen Grafschaft Herefordshire ein. Auch Miles Bredon, Detektiv einer prominenten Versicherungsgesellschaft, steht dieses Mal auf ihrer Liste, obwohl er das Paar weder gut kennt noch schätzt. Doch Gattin Angela freut sich auf einige Ferientage außer Haus, sodass Bredon sich in sein Schicksal fügt.
Die Gesellschaft auf Lastburg Hall ist so fad, wie er befürchtet hatte. Walter Halliford schwärmt allzu ausgiebig von seinen Erfolgen als Landwirt, Gattin Myrtle ist neurotisch. Adrian Tollard, ein halbwegs erfolgreicher Schriftsteller mit skandalumwitterter Vergangenheit, mimt den Salon-Sozialisten, Phyllis Morel lebt nur für schnelle Autos, John Carberry, ein gescheiterter Minenbesitzer, ist ein grober Klotz, die Arnolds sind langweilig. Interessant ist nur Cecil Worsley, der in prominenter aber nicht näher definierter Stellung für den britischen Geheimdienst arbeitet. Ausgerechnet ihn finden Landarbeiter im Inneren des mächtigen Silos, der hoch über Lastbury Hall aufragt: Worsley ist an den von den gärenden Futterpflanzen aufsteigenden Gasen erstickt.
Wieso stieg er ausgerechnet in den Silo? Oder wurde nachgeholfen? Die Leiche weist keine Spuren von Gewaltanwendung auf. Wurde Worsley in eine Falle gelockt? Ist dies ein Anschlag regierungsfeindlicher Kräfte? Der beunruhigte Geheimdienst bittet Bredon, der bereits vor Ort ist, um Hilfe. Gattin Angela wird ihn wie üblich dabei unterstützen. Scotland Yard schickt Inspektor Leyland, einen alten Freund der Bredons, der im Hintergrund ebenfalls Nachforschungen anstellen soll.
Die drei Ermittler stehen vor einem Rätsel. Alibis sind falsch, Indizien verschwinden und tauchen subtil manipuliert wieder auf. Die Situation klärt sich erst, als Bredon erkennt, dass sich hinter dem einen ein gänzlich anderes Verbrechen verbirgt …
|“Die Landarbeiter lungerten untätig herum und erzählten sich in lautem Gälisch gruslige Geschichten von ähnlichen Unglücksfällen“|
Das von der Außenwelt isolierte Landhaus, dessen Bewohner gleichzeitig die Schar potenzieller Opfer und Täter ausmachen, war – um es gutmütig auszudrücken – schon 1933 kein außergewöhnlicher Schauplatz mehr. Ronald A. Knox verdeutlicht im dritten „Miles Bredon“-Kriminalroman, dass es einerseits nur eines interessanten Details bedarf, um ein neues Element in die Handlung zu bringen, die andererseits ganz klassisch durch einen scheinbar unlösbaren Fall mit verwirrenden, einander widersprechenden Indizien die übliche Spannung erfährt.
In diesem Fall ist der Tatort ausgerechnet ein Silo, also ein Behälter aus Stahl, in dem Grünfutter eingelagert wird, das sich durch langsame Eigengärung konserviert und einen Geschmack entwickelt, der dem Vieh, das im Winter damit versorgt wird, offenbar zusagt. Was prosaisch wirkt, ragt immerhin raketengleich und mehr als haushoch in die englische Landschaft, und sein Inneres ist – falls schlecht gelüftet – von tödlichem Gas erfüllt, was einen Futtertank zur ungewöhnlichen, schwer zu handhabenden aber zuverlässigen Mordwaffe aufwertet.
Da wir es hier mit einem Roman von Ronald Knox zu tun haben, sollte sich der Leser jedoch noch weniger auf den Schein der Dinge verlassen als sonst im Krimi-Genre. Zudem gibt sich der Verfasser keineswegs mit der Lösung des Rätsels zufrieden, wie ein ausgewachsener Mann in besagten Silo gelockt oder gehievt werden konnte. Auf dem Gelände des Gutes Lastbury Hall verteilt der Verfasser seltsame Indizien – einen Papierhut, einen Zigarrenstummel -, die wenig später nicht einfach verschwinden, sondern sich verwandeln. Ein Thermometer wird manipuliert, eine Mistgabel wechselt geisterhaft ihren Platz.
|“Selbstmord ist ein schwieriger Fall. Man hat keine persönlichen Erfahrungen“|
Der Tod ist im klassischen Kriminalroman keine Tragödie, sondern notwendiger Auslöser für ein Geschehen, das der Auflösung eines Rätsels gewidmet ist. Der arme Worsley bietet auf seinem Totenlager daher einen tragischen aber keinen schrecklichen Anblick. Wichtiger sind der geöffnete Kragenknopf seines Hemdes und die Pfeife des Gastgebers, die neben der Leiche entdeckt wird. Sie veranschaulichen die grundsätzlich limitierten Erklärungen für Worsleys Ende: Unfall – Selbstmord – Mord.
Der Leser geht natürlich von Mord aus, was Knox verpflichtet, die beiden Alternativen umso deutlicher als Möglichkeiten herauszustellen. Bevor der Verfasser sich im letzten Drittel entscheidet, hat er Klärungsgleichstand geschaffen. Der Leser ist wie geplant unsicher geworden und umso gespannter, wie Knox das Dunkel lichten wird.
Wer die beiden ersten Fälle von Miles Bredon kennt, wird nicht nur damit rechnen, sondern auch erwarten, mit einer gänzlich unerwarteten Auflösung konfrontiert zu werden. Wer hätte indes gedacht, dass sich Knox dieses Mal selbst übertreffen wird? Ein genialer Mord muss nicht perfekt sein: Was zum Treibriemen des Rätselkrimis geworden ist, wird hier völlig logisch auf die Spitze getrieben.
|“Und es war klar, dass in einem Haus, wo man Cocktails trank und das Frühstück im Bett einnahm, schmutzige Intrigen gespielt wurden.“|
Eine weitere Binsenweisheit, die den Erfolg eines „Whodunit“ ausmacht, ist die erfolgreiche Verschleierung des Täters. Er (oder sie) wird in der Regel in einer ganzen Gruppe Tatverdächtiger versteckt. Dies ist nicht nur effizient, sondern ergibt sich auch aus der Handlung.
Knox hält sich an das bewährte Schema. Allerdings charakterisiert er die Gesellschaft in Lastbury Hall ungleich schärfer als früher. Zwischen „Fußspuren an der Schleuse“ und „Der Tote im Silo“ liegen fünf reale Jahre, in denen ein rauer Wind durch Europa zu wehen begonnen hatte. In Deutschland standen die Nazis noch in den Startlöchern. Knox richtete seinen besorgten Blick deshalb weiter nach Osten. In der Sowjetunion hatte der stalinistische Terror begonnen, der den ohnehin konservativen Knox in seiner Meinung bestärkte, dass sozialistische Umtriebe, wie es sie auch in England gab, scharf beobachtet, verurteilt und beendet gehörten. Entsprechende Passagen bilden wenige aber schrille Misstöne in einem ansonsten vergnüglich realitätsfernen Kriminalroman.
Auffällig ist zweitens eine Dualität der Gesellschaft, die sich laut Knox in sachlich-konzentrierte, werteorientierte ‚vernünftige‘ Vertreter der älteren Generationen und eine schnell abgelenkte, richtungslose, auf simple Außenreize dressierte Jugend differenziert. Diese Wertung ging den ersten beiden „Bredon“-Krimis ab – und genau dies gewährleistet ihnen eine Zeitlosigkeit, die „Der Tote im Silo“ in dieser Ausschließlichkeit nicht für sich beanspruchen kann.
|“Eine vernünftige Frau fährt ihren Mann in einem Sack verpackt durchs Land“|
Glücklicherweise lässt Knox den Ernst nicht die Oberhand gewinnen. Schließlich ist sein Roman „Ironica gewidmet“, einer Muse, die zumindest in der antiken Mythologie nicht existiert. Besonders in der Beschreibung des einfachen Landvolks schwingt sich Knox in unerhörte Höhen knochentrockenen, nie verletzenden Humors auf (die der Übersetzer mit gebührender Sorgfalt und lobenswertem Geschick ins Deutsche rettet).
Erneut ordnet Knox – in diesem Punkt alles andere als konservativ – die weiblichen Figuren nicht einem ’schwachen Geschlecht‘ zu. Wie üblich ermittelt Angela Bredon im Team mit ihrem Gatten und Inspektor Leyland. Phyllis Morel betreibt eine Werkstatt und ist eine versierte Rennfahrerin, die auf den väterlichen Rat eines Richters, es auf der Straße doch etwas langsamer angehen zu lassen, mit offener Verachtung reagiert.
Miles Bredon selbst ist in seinem dritten Abenteuer als Figur ausgereift. Er hadert mit einem Schicksal, das ihn zu einer Arbeit als „Spion“ verurteilt, ist penibel bis zum Exzess, wenn er einen Tatort untersucht, und seine Auflösung erfolgt zuverlässig, kurz nachdem er zur Klärung seines Hirns eine Patience gelegt hat. Knox zeigt Bredon primär bei der Detektivarbeit – eine kluge Entscheidung bzw. eine von vielen klugen Entscheidungen, die eine Jagd nach diesem hierzulande längst vergriffenen aber antiquarisch recht gut greifbaren, großartigen Werk zum lohnenden Projekt machen.
Anmerkung: Die Kapitelüberschriften wurden dem Buchtext entnommen.
_Autor_
Ronald Arbuthnott Knox wurde als vierter Sohn des späteren Bischofs von Manchester und seiner Gattin Ellen Penelope French 1888 in Knibworth, Leicestershire, geboren. Schon im Jahre 1900 sehen wir den jungen Ronald in Eton. Er wurde Mitherausgeber des College-Magazins „The Outsider“ und schrieb noch als Schüler sein erstes Buch: „Signa Severa“ (1906), eine Sammlung englischer, griechischer und lateinischer Verse. Mit dem akademischen Grad eines Baccalaureus Artium in klassischer Literatur und Philosophie verließ er 1910 Balliol College, Oxford, und wurde Lehrer am Trinity College. 1911 wurde Knox zum Diakon der Anglikanischen Kirche geweiht, ein Jahr später zum Priester. Während des I. Weltkriegs lehrte Knox an der Shrewsbury School und arbeitete für den militärischen Geheimdienst.
Zum Schrecken seines Vaters konvertierte Knox 1917 zum Katholizismus. Er wurde 1918 katholischer Priester und ging 1919 ans St. Edmund’s College, Hertfordshire. Von 1926 bis 1939 war er Kaplan an der Oxford University. Dann zog er nach Shropshire, um mit dem Werk seines Lebens zu beginnen: Knox übersetzte im Auftrag der Bischöfe von England und Wales die lateinische Bibel neu ins Englische. Diese gewaltige Aufgabe beschäftigte ihn bis 1955.
Der Krimi-Freund Ronald Knox tat sich erstmals 1912 durch einen quasi-seriösen, satirischen Artikel mit dem Titel „Studies in the Literature of Sherlock Holmes“ hervor, der von der Prämisse ausgeht, der Meisterdetektiv sei eine reale Figur der Zeitgeschichte. Knox‘ Artikel wurde positiv aufgenommen; einer der amüsierten Leser war Arthur Conan Doyle selbst. Später trat Knox dem „Detection Club“ bei.
Seit 1925 schrieb er selbst Romane. Sein Erstling war „The Viaduct Murder“ (1925, dt. „Der Tote am Viadukt“). 1927 gab Versicherungsermittler Miles Bredon in „The Three Taps“ (dt. „Die drei Gashähne“) sein Debüt .Nur sechs Romane umfasst Knox‘ kriminalistisches Werk. (Es heißt, Knox habe seine Krimis zwischen der Acht-Uhr-Messe und dem Lunch verfasst.) Angeblich habe sein Bischof ihm ans Herz gelegt, sich auf theologische Themen zu beschränken. Wahrscheinlicher ist, dass Knox spätestens seit den 1930er Jahren keine Zeit mehr für seine Kriminalschriftstellerei aufbringen konnte.
Neben der Ausübung seiner Ämter beschäftigte Knox sich mit grundsätzlichen theoretischen Fragen des Glaubens. Er galt als eine der wichtigsten katholischen Stimmen in England und verfasste viele theologische Bücher und Schriften zu diversen Themen, die von einer eher konservativen Haltung zeugen. Im Alter zog Knox nach Mells, Somerset, wo er am 24. August 1957 starb.
|Taschenbuch: 176 Seiten
Originaltitel: The Body in the Silo (London : Hodder & Stoughton 1933)
Übersetzung: Lorenz Häflinger
[keine ISBN]|
[www.kirjasto.sci.fi/knox.htm]http://www.kirjasto.sci.fi/knox.htm
[www.ronaldknoxsociety.com]http://www.ronaldknoxsociety.com
[www.herder.de]http://www.herder.de
_Ronald A. Knox bei |Buchwurm.info|:_
[„Die drei Gashähne“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=7309
[„Fußspuren an der Schleuse“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=7407
(H. P. Lovecraft)/August Derleth – Das Tor des Verderbens

Boothby, Guy Newell – Der Palazzo des Doctor Nikola
_Die |Doctor Nikola|-Reihe:_
(1895) [„Die Rache des Doctor Nikola“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=6319 (|“A Bid for Fortune, or: Dr. Nikola’s Vendetta“| / |“Enter Dr. Nikola!“|)
(1896) [„Die Expedition des Doctor Nikola“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=6746 (|“Dr. Nikola“|)
(1898) |“The Lust of Hate“|
(1899) [„Das Experiment des Doctor Nikola“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=7041 (|“Dr. Nikola’s Experiment“|)
(1901) „Der Palazzo des Doctor Nikola“ (|“Farewell, Nikola“|)
_Das geschieht:_
Da Gattin Phyllis derzeit ein wenig kränkelt, ist Sir Richard Hatteras mit ihr auf Europareise gegangen. Begleitet werden sie von der jungen Gertrude Trevor, die auf diese Weise als noch unverheiratete Frau endlich einmal aus ihrem Elternhaus herauskommt. Seit einiger Zeit hält man sich in Venedig auf; Phyllis geht es deutlich besser. Ausgerechnet auf dem Markusplatz läuft der Gruppe Dr. Nikola über den Weg. Er hatte vor fünf Jahren Phyllis entführt und Richard bedroht, weil er sie unbedingt um den Besitz eines antiken chinesischen Holzstäbchens bringen wollte, das er für seine mysteriösen Forschungen benötigte.
Man schließt Frieden. Richard, Phyllis und Gertrude lassen sich in den düsteren Palazzo Revecce einladen. Dort residiert Nikola und ist wie üblich in unzähligen Ränken verstrickt. Mit dabei ist der Herzog von Glenbarth, ein inzwischen eingetroffener Freund der Hatteras. Nikola zeigt seinen Gästen unbekannte und bizarre Winkel von Venedig, man unterhält sich großartig. Richard wird sogar ins Vertrauen gezogen; Nikola erzählt ihm von seiner Kindheit und Jugend und von seinem grausamen Stiefbruder.
Inzwischen hat sich der Herzog heftig in Miss Trevor verliebt, die ihn jedoch zappeln lässt. Ein Freund von Richard Hatteras meldet brieflich die Ankunft eines Bekannten, um den man sich in Venedig bitte kümmern solle. Don José de Martines ist leider ein Widerling, in dem der eifersüchtige Glenbarth außerdem einen Nebenbuhler sieht. Als sogar ein Duell droht, greift Nikola rettend ein – und Hatteras erkennt, dass er abermals manipuliert wurde: Er sollte Nikola ‚zufällig‘ mit dem misstrauischen Don José in Kontakt bringen, damit eine diabolische Rache ihren Lauf nehmen kann …
_Alte Spinne im neuen Netz_
1901 läutet der Glockenturm der San-Marco-Kirche von Venedig das Requiem für Doctor Nikola ein; auch in dieser düsteren Phase seines Lebens hätte ihn eine unwürdigere Untermalung sicherlich beleidigt. In Venedig ist er nach einer Kette aufregender Abenteuer, von denen wir Leser ansatzweise in drei Büchern erfahren haben, würdig und stimmungsvoll untergekommen: Er hat einen Palazzo gemietet, der nicht nur romantisch verfallen ist, sondern angeblich von der Geistern zweier Liebender heimgesucht wird, die hier vor Jahrhunderten ein grausiges Ende fanden; eine Geschichte, die uns Boothby selbstverständlich nicht vorenthält.
„Verfall“ und „Degeneration“ sind zwei Begriffe, die Venedigs Besuchern schon um 1900 keineswegs fremd waren. Die ganz große Zeit war seit 1797 mit dem Ende der Republik vorüber, und mit dem Schwinden von Macht und vor allem Reichtum begannen die Schwierigkeiten einer Stadt, die man einst stolz aber unklug in einem Gewirr aus kleinen Inseln direkt im Wasser errichtete. Der Zahn der Zeit nagt besonders kräftig dort, wo es feucht ist. Venedigs Prunk der Vergangenheit begann sich bald sichtlich aufzulösen; der Anblick erzeugte eine Atmosphäre der Melancholie und der Vergänglichkeit, für die Künstler und Literaten besonders empfänglich waren.
Über viele Jahre war außerdem ein Labyrinth von Kanälen, Brücken, Stegen, Durchgängen und Gässchen entstanden, die sich – um 1900 des Nachts unbeleuchtet – als Kulisse für wilde Verfolgungsjagden förmlich anboten. Flucht ist schwierig, wenn die ‚Straßen‘ aus Wasser bestehen, und erfordert deshalb Erfindungsreichtum, der auch in der Beschreibung spannend ist.
|Traurigkeit und Täuschung|
Insofern ist Nikola ist Venedig sehr gut aufgehoben. Geschickt nutzt Boothby jene Mischung aus Weltschmerz und Lethargie, die Venedig ausstrahlt, um seine Leser über die wahren Absichten seines Erzschurken zu täuschen. Auch Richard Hattaras, dem wir nach „Die Rache des Doctor Nikola“ abermals begegnen, lässt sich abermals hereinlegen und für Nikolas manipulativen Meisterstreich rekrutieren.
Wobei dessen Niedergeschlagenheit nicht einmal gespielt ist, weshalb seine unfreiwilligen Helfer erst recht keine Chance haben, ihm auf die Schliche zu kommen. Nikola hat einen Scheideweg seines Lebens erreicht. Die Jagd nach dem ewigen Leben, auf der wir ihn drei Romanlängen begleiteten, nahm in „Das Experiment des Doctor Nikola“ ein schlimmes Ende. Zudem konnte Nikola, der unabhängig davon viel geheimes Wissen aufgetan hatte, der Versuchung nicht widerstehen, in die eigene Zukunft zu blicken. Was er dort sah, drückt er seinen Zuhörern (und uns Lesern) gegenüber gewohnt kryptisch aus, aber die Zeit läuft auf jeden Fall ab für ihn.
Nur eine – persönliche – Angelegenheit gilt es noch zu regeln. In „Der Palazzo …“ zeigt sich Nikola so ‚menschlich‘ wie nie zuvor. Er müsste Hattaras die Geschichte seiner bejammernswerten Jugend nicht erzählen; sein Plan würde trotzdem oder sogar besser aufgehen, da Nikola in seiner Schilderung so deutlich mit dem Zaunpfahl winkt, dass sogar der nicht als Blitzmerker eingeführte Hatteras die Verbindung zwischen dem bösen Halbbruder und dem bösen Don José begreift. (Nein, dies ist kein Spoiler; falls Boothby daraus ein Geheimnis machen wollte, hätte er sich die Mühe machen sollen, entsprechende Hinweise wenigstens ansatzweise zu verwischen.)
|Genug ist genug|
1901 hatte Boothby erkannt, dass er in vier Büchern aus seiner Figur alles herausgeholt hatte. Nikola begann sich in seinen Schachzügen zu wiederholen. Noch schlimmer: Er drohte seine geheimnisvolle Aura zu verlieren. Schon dass Nikola das Geheimnis seiner Herkunft lüftet, ist kontraproduktiv, da diese Geschichte zwar tragisch aber auch abgedroschen ist. Immerhin begreift man angesichts dieser Biografie Nikolas pathologischen Rachedrang besser. Wer sich ihm in den Weg stellt, wird unbarmherzig zur Verantwortung gezogen, was in dieser blinden Wut gar nicht zum Bild des beherrschten Wissenschaftlers und kriminellen Meisterhirns passen will.
Bei nüchterner Betrachtung bietet „Der Palazzo …“ grundsätzlich keine originelle Unterhaltung. Nachdem er in den Bänden 2 und 3 deutlich agiler war, bleibt Nikola wieder nur eine größere Nebenrolle. Hin und wieder bringt er durch einen Zaubertrick seinen Status als Magier der Wissenschaft in Erinnerung. Viel zu viele Seiten vergehen dagegen über retardierenden Liebesgeplänkeln, die zum eigentlichen Geschehen nichts betragen. Boothby brachte seine mit flinker Feder geschriebenen Werke gern mit allerlei Füllseln auf Länge. Schon in den ersten drei „Nikola“-Bänden drehte sich die Handlung mehr als einmal im Kreis, bis dem Verfasser einfiel, wie es weitergehen könnte.
Wenn man Boothby abermals als Leser gern folgt, liegt es daran, dass er zwar kein guter Schriftsteller aber ein Erzähltalent ist, was durch eine vorzügliche, zwischen angemessen altertümlicher und moderner Sprache souverän das Gleichgewicht haltende Übersetzung abermals bewahrt wird. Boothbys Ton ist leicht, und er verfügt über einen Sinn für Humor, der ihm deutlich besser steht als sein Hang zu einer (zeitgenössischen) Theatralik, die sich überlebt hat. Das Finale ertrinkt förmlich in Edelmut. (Es belegt aber auch die Umsicht eines Verfassers, der seine Figur nicht umbringt, sondern quasi auf Eis legt: Wäre Boothby nicht so früh gestorben, hätte er womöglich Nikola aus seinem tibetischen Exil zurückgeholt.)
|Leb wohl, Doctor Nikola – auf baldige Rückkehr!|
Guy Newell Boothby findet auch mehr als einem Jahrhundert nach seinem Tod ein Publikum; eine erstaunliche Tatsache, die dadurch belegt wird, dass sämtliche vier Nikola-Bände nunmehr in Deutschland erschienen sind – die beiden Letzten sogar zum ersten Mal. Dafür ist nicht nur Boothbys schlichtes aber schwer zu widerstehendem Erzählhandwerk verantwortlich, sondern auch eine sorgfältige (und durchhaltefreudige) Redaktion.
Die alten Geschichten werden dem Publikum des 21. Jahrhunderts lesbar übersetzt und schön gestaltet als (trotzdem kostengünstige) Paperbacks mit Klappenbroschur präsentiert. Dazu gibt es ‚Bonustrack‘, zusätzliche Storys und Hintergrundinformationen. Dieses Mal wird der Roman durch einen Nachruf auf Boothby aus dem Jahre 1905 eingeleitet. Dem Finale folgt eine lupenreine Geistergeschichte („Das verwunschene Goldfeld“), die so nostalgisch-spannend geraten ist, dass man gern mehr Boothby-Storys lesen würde.
Doch erst einmal geht es – ein weiterer Hinweis auf das Potenzial der Figur – mit brandneuen „Nikola“-Abenteuern weiter. Übersetzer Michael Böhnhardt schreibt den ersten Band einer Fortsetzungsreihe, die exklusiv in Deutschland entsteht. 111 Jahre liegen zwischen Nikolas Abgang und seiner Wiederkehr; dies dürfte ein Rekord sein. Die „Nikola“-Fans dürfen gespannt sein – und wir sind es auch!
_Autor_
Am 13. Oktober 1867 wurde Guy Newell Boothby im australischen Glen Osmond, einer Vorstadt von Adelaide, geboren. Die Boothbys gehörten zur Oberschicht, Guys Vater saß im Parlament von Südaustralien. Der Sohn besuchte von 1874 bis 1883 die Schule im englischen Salisbury, dem Geburtsort seiner Mutter.
Nach Australien zurückgekehrt, versuchte sich Boothby als Theaterautor. Sein Geld verdiente er allerdings als Sekretär des Bürgermeisters von Adelaide. Beide Tätigkeiten wurden nicht von Erfolg gekrönt. Boothbys Lehr- und Wanderjahre führten ihn 1891/92 kreuz und quer durch Australien sowie den südasiatischen Inselraum. Sein 1894 veröffentlichter Reisebericht wurde zum Start einer außergewöhnlichen Schriftstellerkarriere.
1895 siedelte Boothby nach England um, heiratete und gründete eine Familie. Er schrieb nun Romane, wobei er sämtliche Genres der Unterhaltungsliteratur bediente und lieferte, was ein möglichst breites Publikum wünschte. Boothby war ein findiger und fleißiger Autor, der überaus ökonomisch arbeitete, indem er seine Worte nicht niederschrieb, sondern in einen Phonographen diktierte und die so besprochenen Wachswalzen von einer Sekretärin in Reinschrift bringen ließ. Jährlich konnten auf diese Weise durchschnittlich fünf Titel erscheinen. Boothbys Einkünfte ermöglichten ihm den Kauf eines Herrenhauses an der Südküste Englands, in dem er mit seiner Familie lebte, bis er am 26. Februar 1905 im Alter von nur 37 Jahren an einer Lungenentzündung starb.
|Paperback mit Klappenbroschur: 192 Seiten
Originaltitel: Farewell, Nikola (London : Ward, Lock & Co. 1901)
Übersetzung: Michael Böhnhardt
Cover: Ernst Wurdack
ISBN-13: 978-3-938065-74-7|
[doctornikola.blogspot.com]http://doctornikola.blogspot.com
[www.wurdackverlag.de]http://www.wurdackverlag.de
_Guy N. Boothby bei |Buchwurm.info|:_
[„Pharos der Ägypter“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=297
Knox, Ronald A. – Fußspuren an der Schleuse
_Das geschieht:_
Die Vettern Charles und Nigel Burtell sind Vettern, Nichtsnutze und Verschwender. Außerdem hassen sie einander bis aufs Blut. Trotzdem unternehmen ausgerechnet sie eine gemeinsame Paddelboot-Tour auf dem Oberlauf der Themse: Eine herrische aber reiche Erbtante liegt im Sterben und will die Vettern unbedingt versöhnt sehen, da sie ansonsten eine Testamentsänderung erwägt.
Das Geld käme Derek, der nicht nur hoch verschuldet, sondern auch ein Säufer und rauschgiftsüchtig ist, sehr recht. Dabei winkt ihm sogar eine zweite Erbschaft: In einem Monat wird er 25, und ihm werden aus dem Erbe seines Großvaters 50.000 Pfund ausbezahlt. Freilich hat er mit seiner Gesundheit so übel Schindluder getrieben, dass er seinen Geburtstag womöglich nicht mehr erleben wird. Das Geld fiele dann an Nigel.
Der Ausflug endet tragisch. Nigel, der angeblich kurz aber dringend in Oxford zu tun hatte, findet nach seiner Rückkehr an die Themse das Boot leer im Wasser treibend. Derek ist verschwunden, seine Leiche wird trotz eifriger Suche nicht gefunden. Dies ruft die „Unbeschreibliche“ auf den Plan – jene Firma, bei der Derek hoch versichert war und die bei Selbstmord oder einem Verbrechen nicht auszahlen müsste. Firmendetektiv Miles Bredon reist mit Gattin und Assistentin Angela an den Ort der möglichen Übeltat. Dort trifft das Paar auf ihren Freund Inspektor Leyland, der im Auftrag von Scotland Yard ebenfalls Ermittlungen anstellt. Weil sich dies schon früher bewährt hat, beschließt man eine Zusammenarbeit.
Die Untersuchung ist vertrackt. Zwar fördern Leyland und die Bredons interessante Indizien zu Tage. Statt sich zu einem Fallbild fügen zu lassen, widersprechen sie jedoch einander. Ist Nigel ein Mörder? Ist Derek überhaupt tot? Gibt es einen bisher unbekannten Dritten in diesem Spiel? Kann man den Indizien überhaupt trauen? Die Wahrheit kommt ans Licht, und sie stellt in der Tat eine Überraschung dar …
_Flussfahrt mit möglicher Mordtat_
Die Gegenüberstellung von Idylle und Mord ist eine Spezialität des klassischen englischen Kriminalromans. Oft bildet ausgerechnet das Mordopfer den einzigen Flecken in dem bunten, unbeschwerten Bild, das der Verfasser von Land und Leuten zeichnet. Wie man genau dies höchst unterhaltsam auf die Spitze treibt, demonstriert Ronald A. Knox im zweiten Band seiner Serie um den Versicherungsdetektiv Miles Bredon.
Knox wählt als Schauplatz seines literarischen Verbrechens mutig |die| englische Idylle: „Fußspuren an der Schleuse“ spielt im Sommermonat Juli am Oberlauf der Themse unweit der Universitätsstadt Oxford. Der Fluss ist hier kein mächtiger Strom, sondern fließt und schlängelt sich langsam durch eine zauberhafte – von Knox geradezu hymnisch beschriebene – Parklandschaft, die damals wie heute von Boot und Rad fahrenden, schwimmenden, wandernden und sonnenbadenden Ausflüglern und Touristen bevölkert wird.
Wer sich ein Bild vom bunten Themse-Treiben in vergangenen Zeiten machen möchte, lese „Drei Männer im Boot“, den ewigen Klassiker von Jerome K. Jerome (1858-1927), der 1889 humorvoll eine ereignis- bwz. zwischenfallreiche Flussfahrt schilderte. Jerome setzte Maßstäbe, Knox bezieht sich ausdrücklich auf ihn. Er muss sich vor dem großen Vorbild nicht verstecken.
|Einladung an den grübelfreudigen Leser|
Als eigenes Element bringt Knox ein Mordrätsel in die Handlung ein. Wie schon in „Die drei Gashähne“, dem ersten Roman mit und um Miles Bredon, verwandelt er die Landschaft in eine Bühne, auf der jedes Einrichtungsstück sorgfältig platziert wird. Eigentlich müsste Knox dem Roman eine Karte einfügen, denn sein Szenario ist sehr verzwickt. Sollte der Leser den Ehrgeiz aufbringen, gemeinsam mit Bredon und Leyland zu ermitteln, muss er sich mächtig konzentrieren, um sich in der komplexen Tatort-Geografie zurechtzufinden.
Herausgefordert ist er, denn Knox ist ein entschlossener Verfechter des „fair play“ im Kriminalroman: Faule Tricks sind nicht gestattet. Auch die verschlungensten Indizien-Fährten laufen schließlich in einem logischen Ablauf zusammen. Allerdings steht Knox ebenfalls auf dem Standpunkt, es seinem Publikum nicht allzu einfach machen zu dürfen, was er in einem bemerkenswerten Einschub so erklärt:
|“Die Muse des Kriminalromans – die es heute zweifellos geben muss – befindet sich ihren Schwestern gegenüber im Nachteil. Sie darf nicht ungeschminkt drauflos erzählen. Wenn sie es täte, gäbe es kein Geheimnis, keine Situation, keine Lösung. Die Allwissenheit des Verfassers und die Allgegenwart des Lesers, die Hand in Hand gehen, würden die Spur verwischen. Kein Knäuel würde unentwirrt bleiben, kein Indiz verlorengehen. Wir müssen deshalb von Zeit zu Zeit den Faden der langweiligen zeitlichen Erzählung unterbrechen und die Dinge nicht so sehen, wie sie an sich sind, sondern wie sie den unmittelbar Beteiligten erscheinen.“| (S. 28)
|Wieder einmal das ‚unmögliche‘ Verbrechen|
Was wie schon erwähnt für Verwirrung sorgen kann. Zwar bietet „Fußspuren an der Schleuse“ ein Feuerwerk humorvoller bis ironischer Anmerkungen. Als Kriminalroman stellt die Handlung dennoch Ansprüche. Knox beginnt mit verwirrenden Indizien, die er im Laufe des Geschehens zwar bereits einpasst, während er sie unbekümmert um weitere Rätsel vermehrt. Der weniger hartnäckige Leser wird vermutlich bald die Waffen strecken bzw. sich fragen, wie oder ob es Knox gelingen wird, sich aus der Sackgasse zu befreien, in die er sich augenscheinlich manövriert hat.
Aber der Autor hält die Fäden jederzeit fest in der Hand. Er kann es sich deshalb erlauben, seine Ermittler immer neue und schlüssige Theorien entwickeln zu lassen, um sie anschließend umgehend zu verwerfen. Knox behält immer ein As in der Hinterhand. Lässt man nachträglich das kriminelle Geschehen vor dem geistigen Auge ablaufen, bewundert man die Geschmeidigkeit, mit der sich ihr komplizierter Mechanismus abspult.
Der „looked room“ des klassischen Rätselkrimis wird dabei effektvoll durch den Fluss Themse ersetzt. Wasser hat keine Balken; eine physikalische Eigenschaft, die Knox bestimmte Kniffe ermöglicht, die das von ihm geplante Verbrechen ermöglichen, während er gleichzeitig hoffen kann, dass der Leser diese Tatsache erst einmal vergisst und sich hinters Licht führen lässt.
|Kriminalistik ist Teamwork|
Mit Erfolg greift Knox auf das zentrale Figurenpersonal des Vorgänger-Romans zurück. Elegant führt er Bredon in die Handlung ein, dem er ganz selbstverständlich Ehefrau Angela folgen lässt. Erneut ist diese nicht Anhängsel, das in Vertretung des Lesers die dummen Fragen stellt und mit offenem Mund die Genialität des Gatten bestaunt, sondern gleichberechtigte Mitarbeiterin, die problemfrei unabhängig ermittelt, um sich anschließend mit dem Ehemann auszutauschen.
Erneut stößt Inspektor Leyland zu dem Paar. Er repräsentiert die ‚offizielle‘ Seite des Gesetzes. Verstößt ihn dies im klassischen Krimi oft in die Rolle des tumben Befehlsempfängers und ulkigen Trottels, der dem Detektiv hinterher trottelt, bleibt Leyland bei Knox ebenfalls Partner.
Damit endet der Realitätsbezug, denn der Autor bevölkert seine Sommeridylle ansonsten mit pittoresken Gestalten, wie sie in dieser Archetypisierung wohl nur im „Whodunit“ der „Goldenen Ära“ vor dem II. Weltkrieg vorkommen (und erträglich sind). Figuren wie der geistig schlichte Schleusenwärter Burgess sind witzig, während Bredons „unmöglicher“ Onkel Robert und seine verkalkten akademischen Genossen ironisch überzeichnete Oxford-Dons sind, wie Knox – der als Studentenpfarrer ebendort amtierte – sie sehr genau kannte.
|Finaler Twist mit kolossalem Sprung|
Schon in „Die drei Gashähne“ gelang es Knox, seine Leser nicht nur mit einer originellen Auflösung zufriedenzustellen, sondern regelrecht zu überraschen. Auch dieses Mal kommt alles anders als gedacht. Die übliche finale Runde aller Verdächtigen kommt nicht zusammen. Unverhofft bricht die Handlung ab. Ein Brief fügt die letzten Steinchen in das Puzzle ein. Was wie eine schlechte Idee klingt, funktioniert erstaunlich gut.
Dies gilt abermals für die deutsche Fassung, auch wenn sie sich nicht ganz mit der Eleganz der „Gashahn“-Übersetzung messen kann. Knox‘ geschliffener Stil regt offensichtlich auch den Übersetzer an. Fünf Jahrzehnte später fallen diverse längst in Vergessenheit geratene Wendungen – wer nennt heute noch einen Zug durch die Kneipen eines Ortes „Pintenkehr“? – zwar auf, gehen aber in dem altmodischen, dem Inhalt besonders gerecht werdenden Text unter.
So ist es eine besondere Schande, dass „Fußspuren an der Schleuse“ hierzulande erst einmal und bereits 1962 erschienen ist. Eine Neuauflage ist seit Jahren überfällig, ein schnelles Anzapfen antiquarischer Quellen deshalb der Rat dieses Rezensenten.
_Autor_
Ronald Arbuthnott Knox wurde als vierter Sohn des späteren Bischofs von Manchester und seiner Gattin Ellen Penelope French 1888 in Knibworth, Leicestershire, geboren. Schon im Jahre 1900 sehen wir den jungen Ronald in Eton. Er wurde Mitherausgeber des College-Magazins „The Outsider“ und schrieb noch als Schüler sein erstes Buch: „Signa Severa“ (1906), eine Sammlung englischer, griechischer und lateinischer Verse. Mit dem akademischen Grad eines Baccalaureus Artium in klassischer Literatur und Philosophie verließ er 1910 Balliol College, Oxford, und wurde Lehrer am Trinity College. 1911 wurde Knox zum Diakon der Anglikanischen Kirche geweiht, ein Jahr später zum Priester. Während des Ersten Weltkriegs lehrte Knox an der Shrewsbury School und arbeitete für den militärischen Geheimdienst.
Zum Schrecken seines Vaters konvertierte Knox 1917 zum Katholizismus. Er wurde 1918 katholischer Priester und ging 1919 ans St. Edmund’s College, Hertfordshire. Von 1926 bis 1939 war er Kaplan an der Oxford University. Dann zog er nach Shropshire, um mit dem Werk seines Lebens zu beginnen: Knox übersetzte im Auftrag der Bischöfe von England und Wales die lateinische Bibel neu ins Englische. Diese gewaltige Aufgabe beschäftigte ihn bis 1955.
Der Krimi-Freund Ronald Knox tat sich erstmals 1912 durch einen quasi-seriösen, satirischen Artikel mit dem Titel „Studies in the Literature of Sherlock Holmes“ hervor, der von der Prämisse ausgeht, der Meisterdetektiv sei eine reale Figur der Zeitgeschichte. Knox‘ Artikel wurde positiv aufgenommen; einer der amüsierten Leser war Arthur Conan Doyle selbst. Später trat Knox dem „Detection Club“ bei.
Seit 1925 schrieb er selbst Romane. Sein Erstling war „The Viaduct Murder“ (1925, dt. „Der Tote am Viadukt“). 1927 gab Versicherungsermittler Miles Bredon in „The Three Taps“ (dt. „Die drei Gashähne“) sein Debüt .Nur sechs Romane umfasst Knox‘ kriminalistisches Werk. (Es heißt, Knox habe seine Krimis zwischen der Acht-Uhr-Messe und dem Lunch verfasst.) Angeblich habe sein Bischof ihm ans Herz gelegt, sich auf theologische Themen zu beschränken. Wahrscheinlicher ist, dass Knox spätestens seit den 1930er Jahren keine Zeit mehr für seine Kriminalschriftstellerei aufbringen konnte.
Neben der Ausübung seiner Ämter beschäftigte Knox sich mit grundsätzlichen theoretischen Fragen des Glaubens. Er galt als eine der wichtigsten katholischen Stimmen in England und verfasste viele theologische Bücher und Schriften zu diversen Themen, die von einer eher konservativen Haltung zeugen. Im Alter zog Knox nach Mells, Somerset, wo er am 24. August 1957 starb.
|Taschenbuch: 190 Seiten
Originaltitel: The Footsteps at the Lock (London : Methuen & Co. Ltd. 1928)
Übersetzung: Lorenz Häflinger|
[www.kirjasto.sci.fi/knox.htm]http://www.kirjasto.sci.fi/knox.htm
[www.ronaldknoxsociety.com]http://www.ronaldknoxsociety.com
_Ronald A. Knox bei |Buchwurm.info|:_
[„Die drei Gashähne“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=7309
Philip Kerr – Die Adlon-Verschwörung [Bernhard Gunther 6]
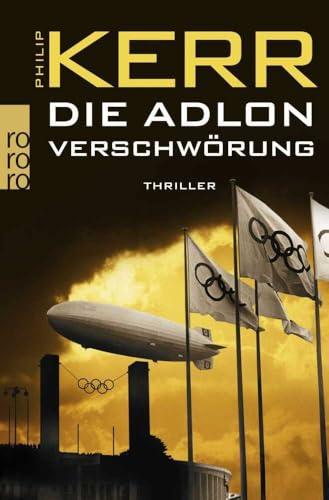
Philip Kerr – Die Adlon-Verschwörung [Bernhard Gunther 6] weiterlesen
Edmund Crispin – Heiliger Bimbam

Edmund Crispin – Heiliger Bimbam weiterlesen