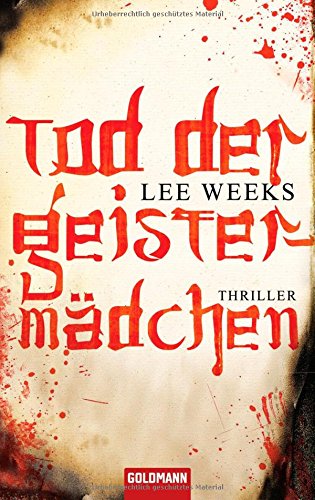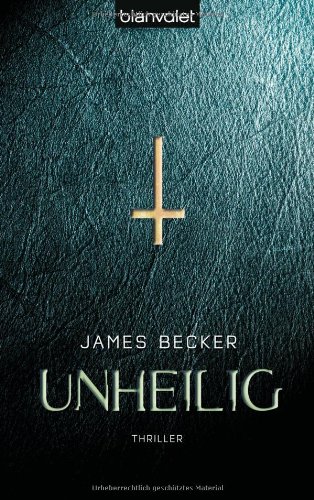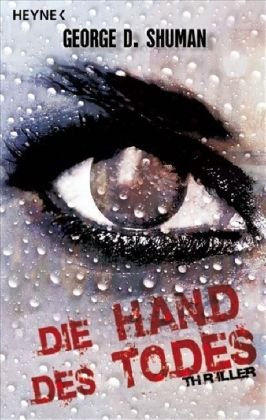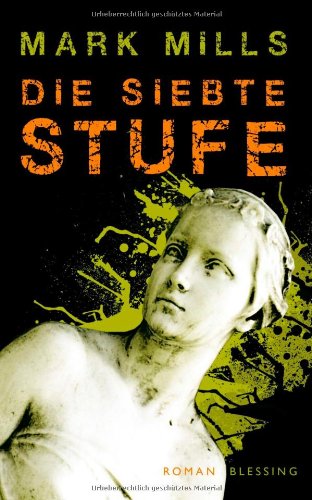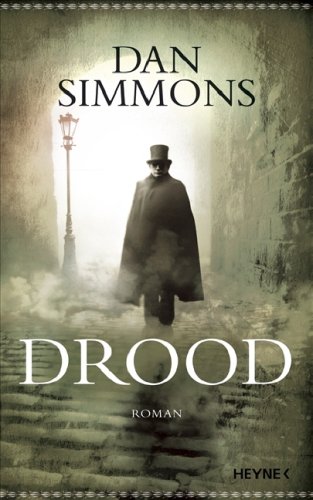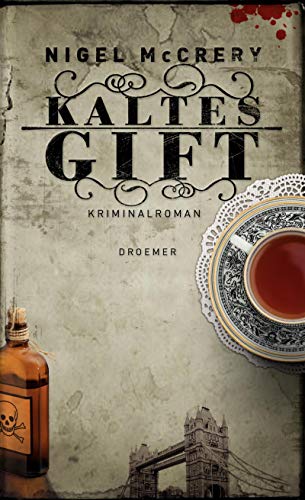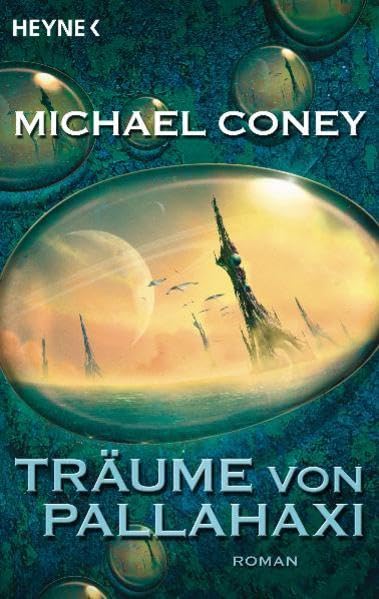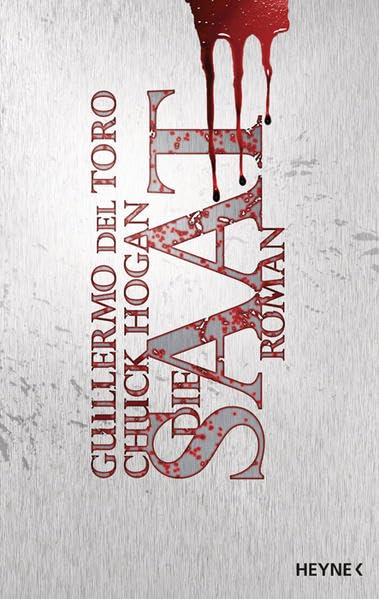Jeffrey Konvitz – Allisons Haus weiterlesen
Alle Beiträge von Michael Drewniok
King, Stephen – Arena, Die
_Das geschieht:_
Chester’s Mill im US-Staat Maine ist ein 2000-Einwohner-Städtchen, das es bisher nie in die überörtlichen Nachrichten schaffte. Die meisten Bürger kennen einander, man weiß, was man von seinem Nachbarn zu halten hat. Für die größten Probleme sorgen „Big Jim“ Rennie, der Zweite Stadtverordnete, ein bigotter, verlogener, aalglatter Gebrauchtwarenhändler, der sein Amt weidlich ausnutzt, um in Chester’s Mill das Sagen zu haben, und „Junior“ Rennie, sein nichtsnutziger, psychopathischer Sohn.
An einem schönen Herbsttag geht unvermittelt der „Dome“ über Chester’s Mill nieder: eine unsichtbare, nur für Schall und etwas Luft durchlässige, ansonsten undurchdringliche Kuppel, deren Gestalt sich sehr genau an der Ortsgrenze orientiert. Niemand kann Chester’s Mill verlassen, niemand kann hinein. Ratlos riegelt das Militär die Region ab, während sich der „Dome“ rasch in einen Kessel verwandelt, dessen Innendruck stetig steigt. Die Verteilung von Nahrung, Wasser, Heizöl und Treibstoff ist schlecht organisiert. Statt sich darum zu kümmern, schwingt sich „Big Jim“ mit Hilfe des ihm hörigen stellvertretenden Polizeichefs Randolph zum Diktator auf. Endlich kann er seine Träume von einem Gottesstaat der Tüchtigen verwirklichen! Vor Gewalt und Mord schrecken seine Schergen, die Rennie mit Privilegien und Sonderzuteilungen an sich zu binden weiß, nicht zurück.
Nur eine kleine Schar unter Leitung des ehemaligen Elite-Soldaten und heutigen Aushilfskochs Dale Barbara stemmt sich dem ausbrechenden Irrsinn entgegen. Irgendwo in Chester’s Mill muss die Maschine stehen, die der Kuppel ihre Energie zuführt. Während wenige suchen, unterwerfen sich viele dem Willen des zunehmend dem Cäsarenwahn verfallenden Rennies, was dafür sorgt, dass die Stadt sich in eine Arena verwandelt, in der Feinde wie Freunde auf Leben und Tod kämpfen …
_Dick, aber nicht behäbig; schwer, aber leicht lesbar_
Man hatte Stephen King bereits ein wenig abgeschrieben. Obwohl er seine Alkohol- und Drogensucht überwinden konnte und die endlos in die Breite getretene Saga vom „Dunklen Turm“ abschloss, schien Sohn Joe Hill („Blind“, „Black Box“) mit eigenen, frischeren Werken dem Vater den Rang abzulaufen. „Cell“ (dt. „Puls“) und „Lisey’s Story“ (dt. „Love“) waren eher zähe Werke. 2008 zeigte King mit „Duma Key“ (dt. „Wahn“), dass mit ihm noch zu rechnen war. Damals arbeitete er bereits an seinem aktuellen (erstmals 1976 begonnenen und damals abgebrochenen) Opus, das mit knapp 1300 Seiten Großwerken wie „The Stand“ (dt. „Das letzte Gefecht“) und „It“ (dt. „Es“) an die Seite zu stellen ist.
Das gilt nicht nur für den Umfang, sondern erfreulicherweise auch für die Qualität. Mit „Die Arena“ blieb der Verfasser nach eigener Auskunft als Erzähler ständig auf dem Gaspedal. Dass ihm in der Tat eine rasante und trotz gewisser, wohl unvermeidbarer Längen im Mittelteil fesselnde Geschichte gelang, sorgt für eine Lektüre, die den Leser nicht irgendwo im Mittelteil seufzen und die Zahl der noch zu bewältigenden Seiten prüfen lässt.
King füttert sein handlungshungriges Buch-Monstrum mit allem, das er im Verlauf seiner langen Karriere in Sachen Spannung und Dramatik als funktionstüchtig kennengelernt hat. Das gelingt ihm mit erstaunlicher Virtuosität, und darüber hinaus prunkt „Die Arena“ mit einem Figurenpersonal, das nach Dutzenden zählt, ohne dass Autor und Leser deshalb den Überblick verlieren. Diese Geschichte ist sicher länger, als sie sein müsste, doch sie bleibt auf Kurs bis zum kuriosen Finale, das so wohl nur King umsetzen kann, ohne vom Absurden ins Gefühlsduselige abzudriften.
_Chester’s Mill als Spiegelbild_
Während der ’normale‘ Leser sich der rasanten Handlung erfreut, stürzt sich der eher dem Kopf als dem Bauch verpflichtete Literaturkritiker auf die allegorische Seiten des monumentalen Buches, denn auch der kluge Mensch, der Weltflucht-Lektüre politisch korrekt zu verabscheuen hat, darf sich dieses Mal ohne schlechtes Gewissen in die Lese-Schlacht stürzen.
King hat eine Rechnung offen. Glücklicherweise begleicht er sie zwar auf Dollar und Cent, ohne darüber ins Dozieren oder Predigen zu verfallen, sondern bleibt unterhaltsam, wenn er seinem Land einen Spiegel vorhält. King gefällt nicht, was spätestens seit dem 11. September 2001 aus den USA geworden ist: ein von hohlem Patriotismus, bigotter Gottesfurcht, nackter Gier und Rücksichtslosigkeit geschüttelter Staat, dessen hehre Ansprüche als moralisches Gewissen und selbst ernannter Ordnungshüter der Welt sich realiter längst in heiße Luft aufgelöst haben.
Mill’s Creek wird zum Mikrokosmos: vordergründig zum Spielfeld für Außerirdische, aber auch zur experimentellen Bühne für King, der ausführlich durchspielt, was geschehen kann, wenn sich die USA weiter selbst ins globale Aus drängen. Die Kuppel sorgt dafür, dass eine Flucht und damit die übliche Verlagerung interner Probleme ins Ausland unmöglich werden. Dieses Mal schmoren die Führer und Seelenretter mit denen, die sie machen und sich dabei für dumm verkaufen lassen, buchstäblich im eigenen Saft. Die Rettung erfolgt in letzter Sekunde, aber ein Happyend ist das nicht: Chester’s Mill hat sich längst selbst zerrieben.
_Abrechnung mit selbst ernannten Führern_
Die Parallelen zwischen der Stadtverwaltung von Chester’s Mill und der US-Regierung Bush sind unübersehbar. King vermeidet direkte und plumpe Schuldzuweisungen, sondern bricht sie allgemeinverständlich so weit hinab, bis sie Volkes Stimme entspricht, die King so unnachahmlich zu imitieren weiß. Wie üblich ist Zurückhaltung nicht seine Sache. Dabei bringt King es immer wieder mit plakativen und zielsicheren Formulierungen wie dieser auf den Punkt: „Amerikas große Spezialitäten sind Demagogen und Rock ’n‘ Roll, und wir haben zu unserer Zeit reichlich genug von beidem gehört.“ (S. 960)
„Big Jim“ Rennie ist nicht George W. Bush. Diese Figur vereint mehrere politische, wirtschaftliche und religiöse Führergestalten der Gegenwart und verschmilzt sie – gleichzeitig scharf umrissen und um der Verdeutlichung willen überspitzt – zu einem kleingeistigen, aber cleveren Mann, der die Krise als Chance sieht, ganz nach oben zu kommen, und alles tun wird, um sich dort zu halten. Rennie geht es nicht um Geld, das er zwar in Millionenbeträgen ergaunert, ohne sich selbst damit zu bereichern. Die Macht ist das Rauschmittel, nach dem er giert.
Allzu problemlos kann er sie an sich reißen. In „Die Arena“ präsentiert King die breite Palette menschlichen Versagens. Dazu gehört für ihn das Mitläufertum. Wer laut genug schreit, dem folgen jene, die sich vor Widerstand und den daraus resultierenden Folgen fürchten. Zu ihnen gesellen sich Dummen und von der Situation Überforderten, die sich nach einem ’starken Mann‘ sehnen, der für sie in Ordnung bringt, was sie in Angst versetzt, ohne selbst aktiv werden zu müssen – Verhaltensmuster, in denen King nicht grundlos deutliche Parallelen zum deutschen Nationalsozialismus sieht. Freilich vereinfacht er die Mechanismen der Volksverführung und stark. Natürlich ist „Die Arena“ ein Unterhaltungsroman. King vergröbert, um für Deutlichkeit zu sorgen.
_Kleine Lichter in einem düsteren Tunnel_
Helden sind rar unter der Kuppel. Selbst der beinahe übertrieben gewaltlos agierende Dale Barbara hütet ein dunkles Geheimnis: Als ‚Verhörspezialist‘ des US-Militärs hat er im Irak die Demütigung und Folter von Gefangenen geduldet. Er bereut und hat aus seinen Fehlern gelernt. Wie so oft bei King, gesellen sich Kinder, Hausfrauen und Senioren an seine Seite, denn nur sie haben sich eine Offenheit bewahrt bzw. im Alter wiedergefunden, die sie über sich selbst hinauswachsen lässt und ihnen Zugang zu unkonventionellen Lösungswegen ermöglicht. Realistisch ist das ganz sicher nicht, doch King lässt man das durchgehen, weil er über die Fähigkeit verfügt, solche Figuren ohne schlammige Gefühlsduseligkeiten zu gestalten.
Vermutlich gäbe es ohne Computerkids, abgeklärte Greise und kluge Hunde keine logische oder wenigstens logisch wirkende Auflösung des Kuppel-Spektakels. Lange sieht es so aus, als würden sämtliche Protagonisten einen elenden Tod erleiden. Von 2000 Bürgern überlebt in der Tat nur eine Handvoll. Völlig wollte King nicht auf ein versöhnliches Ende verzichten. Wer sich durch 1300 Buchseiten gekämpft hat, würde das absolute Desaster vermutlich ungnädig aufnehmen; in diesem Punkt sollte man dem Profi King vertrauen. Faktisch wirkt sein Finale dennoch naiv bzw. der wuchtigen Vorgeschichte nicht gewachsen. Die Demokratie unter Druck beschäftigte den Verfasser offensichtlich stärker als die Klärung des Kuppel-Mysteriums. Dass der Berg kreißt und doch nur ein Mäuslein gebiert, ist der King-Leser allerdings gewohnt.
Es hätte schlimmer kommen können: So unterbleiben schwurbelige Mystizismen à la „Das letzte Gefecht“ dieses Mal vollständig. Wir vermissen sie nicht und sind froh über eine zwar überdimensionierte aber unterhaltsame Gruselmär über die Abgründe in der Seele des (US-amerikanischen) Durchschnittsmenschen, in denen sich Stephen King immer noch bestens auskennt.
_Der Autor_
Normalerweise lasse ich an dieser Stelle ein Autorenporträt folgen. Wenn ich ein Werk von Stephen King vorstelle, pflege ich dies zu unterlassen – aus gutem Grund, denn der überaus beliebte Schriftsteller ist im Internet umfassend vertreten. Nur zwei Websites – die eine aus den USA, die andere aus Deutschland – seien stellvertretend genannt: www.stephenking.com und [www.stephen-king.de]http://www.stephen-king.de bieten aktuelle Informationen, viel Background und zahlreiche Links.
_Impressum_
Originaltitel: Under the Dome (New York : Scribner 2009)
Deutsche Erstausgabe (geb.): November 2009 (Wilhelm Heyne Verlag)
Übersetzung: Wulf Bergner
1280 Seiten
EUR 26,95
ISBN-13: 978-3-453-26628-5
http://www.heyne.de
Stephen King auf |Buchwurm.info|:
[„Wahn“ 4952
[„Qual“ 4056
[„Sunset“ 5631
[„Brennen muss Salem – Illustrierte Fassung“ 3027
[„Brennen muss Salem“ 3831 (Hörbuch)
[„Briefe aus Jerusalem“ 3714 (Hörbuch)
[„Friedhof der Kuscheltiere“ 3007 (Hörbuch)
[„Puls“ 2383
[„Trucks“ 2327 (Hörbuch)
[„Colorado Kid“ 2090
[„The Green Mile“ 1857 (Hörbuch)
[„Das Leben und das Schreiben“ 1655
[„Atemtechnik“ 1618 (Hörbuch)
[„Todesmarsch“ 908
[„Der Sturm des Jahrhunderts“ 535
[„Tommyknockers – Das Monstrum“ 461
[„Achterbahn“ 460
[„Danse Macabre – Die Welt des Horrors“ 454
[„Christine“ 453
[„Der Buick“ 438
[„Atlantis“ 322
[„Das Mädchen“ 115
[„Im Kabinett des Todes“ 85
[„Duddits – Dreamcatcher“ 45
[„Kinder des Zorns / Der Werwolf von Tarker Mills“ 5440 (Hörbuch)
[„Nachtschicht 2“ 5651 (Hörbuch)
|Der dunkle Turm|
Band 1: [Schwarz 5661
Band 2: [Drei 5839
Band 3: [tot. 5864
Band 4: [Glas 6034
Band 5: [Wolfsmond 153
Band 6: [Susannah 387
Band 7: [Der Turm 822
Richard Stark – Das Geld war schmutzig [Parker 24]

Bailey, Jack – Copkiller
_Das geschieht:_
Reed Tucker, Phineas „Finney“ Durant und Nick Laymon, drei Freunde, die in Ransom, einer Kleinstadt im US-Staat North Carolina, das College besuchen, gönnen sich einen feuchtfröhlichen Abend im Nachbarort. Angetrunken überfahren sie in der Nacht einen Mann und töten ihn. Um Strafe und Ärger zu vermeiden, kommt das Trio überein, den Unfall, der ohne Zeugen blieb, nicht zu melden. Stattdessen verstecken sie die Leiche im Wald, und Nick, der nicht wie Finney und Reed aus reichem Hause stammt, steckt zudem ein Geldbündel mit 10.000 Dollar ein, das der Fremde bei sich trug. Außerdem nimmt er einen Schlüssel an sich, der ein Schließfach im Busbahnhof der Stadt Knoxville im Nachbarstaat Tennessee öffnet.
Nick weiht seine Freundin Sue ein; sein Gewissen macht ihm zu schaffen. Doch der Pakt ist geschlossen, Nick kann nicht mehr zurück. Die Leiche im Wald wird schon am nächsten Tag gefunden. Ein zwielichtig wirkender Staatspolizist namens Evans stellt Fragen, deren Antworten er schon zu kennen scheint. In dem Schließfach finden die Freunde eine Videokassette, auf der eine junge Frau grausam zu Tode gefoltert wird. Sie erkennen in dem Opfer Casey Barrett, eine Kommilitonin, die vor einigen Monaten spurlos vom Campus verschwunden ist. In der Gewissheit, dass Reed und Finn ihn in der Krise umgehend ans Messer liefern werden, beginnt Nick ein gefährliches Spiel. Er beschließt, Caseys Vater über das Schicksal seiner Tochter zu informieren. Alfred Barrett, reich und mächtig, hat eine Belohnung von 100.000 Dollar ausgesetzt, die Nick locken.
Aber alle haben sie die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Die Hintermänner des unbekannten Toten wollen weder das Geld noch die Kassette abschreiben. Sie kennen keinerlei Skrupel und dulden keine Zeugen. Unermüdlich und unerbittlich fahnden sie nach den Dieben – und bald werden sie fündig …
_Die eine entscheidende Sekunde_
Ein einziges Mal triffst du die falsche Entscheidung, und dein Leben verwandelt sich in ein Inferno! Das mag abgedroschen klingen, aber dass mehr als ein Körnchen Wahrheit in dieser Aussage stecken kann, verdeutlicht uns Jack Bailey ebenso überzeugend wie brachial. Dazu passt ein Sprichwort: Kleine Ursache – große Wirkung. Das mag hier vermessen klingen, bildet doch ein tödlicher Unfall die kleine Ursache. Angesichts der Ereignisse, die diesem Unglück folgen, wirkt das Unglück aber rasch wie eine Bagatelle. Mit erschreckender (und damit unterhaltsamer) Meisterschaft entfesselt Bailey eine wahre Höllenfahrt. Mit dem Unfall und der sich anschließenden Fahrerflucht bringen vier junge Leute einen Dominostein aus dem Gleichgewicht, der eine Kettenreaktion in Gang setzt. Bei dem einen Fehler bleibt es nicht; weitere Kurzschlussreaktionen sorgen dafür, dass der Katastrophe der Brennstoff nie ausgeht.
Die entwickelt sich trügerisch langsam. Im ersten Drittel ist „Copkiller“ ein Psycho-Thriller. Im Mittelpunkt stehen vier Menschen in der Krise. Ungelöste Konflikte ließen sie schon zuvor unterschwellig im eigenen Saft schmoren. Die Not bringt endgültig hässliche, bisher verborgen gehaltene Charakterzüge zum Vorschein. Bailey versteht es, den daraus resultierenden Konflikt zu schildern und zu schüren. Gleichzeitig legt er eine falsche Fährte, denn die Geschichte nimmt plötzlich eine unerwartete Wendung.
_Aus Seelenpein wird Folter-Terror_
Als Ernie Pomeroy die Szene betritt, kippt die Handlung. Der ohnehin fragile Pakt zwischen Tucker, Nick, Finney und Sue löst sich auf, nachdem geschieht, was die vier ‚Freunde‘ unbedingt vermeiden wollte: Die Außenwelt bricht über sie hinein. Damit endet ihre ohnehin fragwürdige Kontrolle der Ereignisse.
Aus dem dramatischen Kammerspiel wird ein brutales und bizarres Spektakel. Das Geschehen wird zunehmend düsterer. Die Freunde lernen wahre Meister des Verbrechens und des Bösen kennen. Der schmierige Pomeroy liefert ihnen nur einen Vorgeschmack. Er wird abgelöst von Lawrence Evans, einem Psychopathen in Polizeiuniform. Sämtliche Handlungsinitiative geht auf ihn über, denn Evans ist nur körperlich über- bzw. unmenschlich. Die Freunde haben ihm zunächst nichts entgegenzusetzen und sind ihm hilflos ausgeliefert.
Es endet buchstäblich im Horror: In seiner Folterhöhle sitzt Vergil Gutman, der moderne Elefantenmensch. Im Gegensatz zu seinem historischen und überaus gutmütigen Vorgänger ist Gutman psychisch eine Spiegelung seines verunstalteten Körpers. Was das bedeutet, schildert Bailey gleichermaßen zurückhaltend wie deutlich. Er schwelgt nicht selbstzweckhaft in blutrünstigen Details, die er seinen Lesern freilich nicht erspart, wo sie zur Geschichte gehören.
_Untergang und Wiedergeburt_
Mehr als einhundert Seiten führt Bailey seine vier Hauptpersonen nicht nur immer tiefer in die Falle, sondern lässt diese sogar hinter ihnen zuschnappen. Das geschieht so nachdrücklich, dass man sich fragt, wie er, der sich bisher streng an die selbst gesteckten Vorgaben gehalten hat, sie von dort entkommen lassen kann. Werden sich Nick und Sue plötzlich in Kampfmaschinen verwandeln? Kehrt Finney aus dem Totenreich zurück, um in diese Richtung zu mutieren? Oder gibt es gar kein Happyend? Wird dieses Mal das Böse siegen?
In solche Niederungen begibt sich Bailey nicht, obwohl er einschlägige Klischees keineswegs scheut. Was er sich stattdessen einfallen lässt, sei dem neugierig gewordenen Leser dieser Zeilen verschwiegen, denn seine Auflösung ist vielleicht nicht originell aber interessant und einmal mehr plausibel. Bailey lässt seine durch grausame Erfahrung klug gewordenen Figuren nur gezeichnet für ihr Leben entkommen.
Die Reise durch die Nacht bildet das letzte Drittel von „Copkiller“. Der Schrecken wird so groß, dass er sich zu verselbstständigen scheint. Evans und Gutman verwandeln sich in archaische Ungeheuer, die den dichten, uralten Wäldern entsprungen sein könnten, welche Ransom von allen Seiten förmlich einkreisen.
Generell spielt die Landschaft eine wichtige Rolle in dieser Geschichte. Immer wieder finden sich Nick und seine Freunde in einer fremden, feindseligen, rechtsfreien Umgebung wieder, wenn sie die Stadt verlassen. Wie Haie in ihrem Lebensraum ziehen Kreaturen wie Evans und Pomeroy dort ihre Bahnen. Bailey unterstreicht dieses Bild, indem er sie alte, riesige Straßenkreuzer, Relikte einer anderen Zeit, fahren lässt.
_Das Spiel mit dem Genre_
Während Baileys Stil schlicht strukturiert bleibt, arbeitet er stark mit Stimmungen und Bildern. Bereits die Namen einiger Figuren geben Hinweise: Nick Laymon erinnert an den Schriftsteller Richard Laymon (1947-2001), der ebenfalls gern das Grauen in der Provinz ansiedelte. Wo er jedoch grobschlächtig plottete und schrieb, arbeitet Bailey mit wesentlich feinerer, aber schärferer Feder. Wenn man ihn unbedingt in eine Schublade stecken möchte, könnte man ihn mit Joe Lansdale vergleichen, der die Kunst des „Auf-die-Spitze-Treibens“ („Mojo-Storytelling“) sogar noch besser beherrscht. Die Mischung aus realem Terror und phantastischem Horror – zitiert im Bild der Unheil ankündigenden, schwarzen Automobile – ist eine weitere Lansdale-Spezialität. Eine dritte Parallele bietet ein über die Spitze hinaus getriebenes Grauen, das in pechschwarze Komik umschlägt. Der Transport von Pomeroys Leiche in sein feuchtes Tümpelgrab wird zu einer absurden Komödie der Wirrungen und verstörenden Körperfunktionen.
Vergil Gutman erinnert körperlich an den historischen Elefantenmenschen John Merrick (1862-1890). Auch eine Prise Harvey „Two-Face“ Dent aus den „Batman“-Comics lässt sich feststellen. Der Name geht indes wohl auf den Film-Noir-Klassiker „The Maltese Falcon“ (1941; dt. „Die Spur des Falken“) zurück, in dem Sydney Greenstreet als monströs fettleibiger, besessener Kunsträuber Casper Gutman dem Privatdetektiv Sam Spade alias Humphrey Bogart zu schaffen macht.
Ein schönes, offensichtlich nicht ins Deutsche übertragbare Bild stellt schließlich der Originaltitel dar: „Schlafender Polizist“ nennt man in den USA jene Straßenschwellen, die den Bleifuß allzu schneller Autofahrer auf die Bremse zwingen – oder in den Graben, wenn er nicht rasch genug reagiert. In unserer Geschichte wird der tote Mann auf der Waldstraße zum Stolperstein, der vier bisher unbescholtene Menschen aus der Bahn wirft. (Ein „Copkiller“ glänzt dagegen durch völlige Abwesenheit; sehen lässt sich höchstens ein Killercop.) Das geschieht wie gesagt mit einer inhaltlichen und formalen Vehemenz, die den Leser bis zum genüsslich und künstlich übersteigerten Finale in Atem hält.
_Die Autoren_
„Jack Bailey“ ist ein Pseudonym des Autorengespanns Dale Bailey und Jack Slay, Jr.
Dale Bailey lehrt Englisch am Lenoir-Rhyne College in Hickory, US-Staat North Carolina. Schriftsteller ist er in seiner Freizeit, was sein noch relativ schmales Gesamtwerk erklärt. Bailey schreibt vor allem Kurzgeschichten, die den Genres Sciencefiction und Horror zuzuordnen sind. Elemente beider Genres finden sich auch in dem Roman „Sleeping Policeman“ (dt. „Copkiller“) wieder, den Bailey 2006 gemeinsam mit Jack Slay, Jr. unter dem Pseudonym „Jack Bailey“ verfasste. Über Themen der Weird Fiction schreibt er sekundärliterarische Artikel für diverse Magazine. Auskunft über seine Aktivitäten gibt Bailey auf seiner Website: http://www.dalebailey.com.
Jack Slay, Jr. hat bisher ausschließlich Kurzgeschichten sowie ein Sachbuch veröffentlicht. Auch er schreibt Essays über diverse Themen der modernen Unterhaltungsliteratur.
_Impressum_
Originaltitel: Sleeping Policeman (Urbana/Illinois : Golden Gryphon Press 2006)
Übersetzung: Helmut Gerstberger
Deutsche Erstausgabe: Mai 2009 (Wilhelm Heyne Verlag/Heyne Hardcore 67564)
352 Seiten
EUR 8,95
ISBN-13: 978-3-453-67564-3
Als eBook: Oktober 2009 (Wilhelm Heyne Verlag)
EUR 8,95
ISBN-13: 9-783-641-03258-6
http://www.heyne-hardcore.de
http://www.heyne.de
Henry Wade – Tod auf der Treppe
Sir Garth Fratton gehört zu den großen Finanzmagnaten der Stadt London. Obwohl ihn das Alter und manche Zipperlein plagen, schlägt er die Ratschläge seines Arztes in den Wind und wird Vorstandsmitglied der noch jungen „Victory Finance Company“. Dort geht freilich nicht alles mit rechten Dingen zu, wie Fratton seinem besten Freund Leopold Hessel anvertraut. Bevor er jedoch in Details gehen kann, wird er während eines Spaziergangs von einem unbekannten Rüpel angerempelt. Nur Sekunden später bricht Sir Garth tot zusammen; die Autopsie ergibt, dass er durch das Platzen eines Aneurysmas – der krankhaften Ausweitung einer großen Ader – verblutet ist.
Frattons Tochter Inez lässt der tragische Tod des Vaters keine Ruhe. Sie lässt ein Inserat in die Zeitung setzen, dass den Rüpel auffordert, sich zu melden. Als Scotland Yard davon hört, wird der junge Inspektor Poole geschickt, um den ‚Unfall‘ vorsichtshalber noch einmal zu überprüfen. Pooles Nachforschungen sorgen für Unruhe und schließlich für die Exhumierung von Frattons Leiche, die in der Tat Spuren einer Mordattacke aufweist. Henry Wade – Tod auf der Treppe weiterlesen
Weeks, Lee – Tod der Geistermädchen
_Das geschieht:_
In Hongkong werden Teile der zerstückelten Leichen dreier „Geistermädchen“ gefunden: So nennt man junge Frauen aus Europa und Nordamerika, die sich ihren Lebensunterhalt in Nachtclubs und ähnlichen Etablissements verdienen. Den toten Mädchen fehlen jeweils Körperteile, sodass davon auszugehen ist, dass der Täter eine makabere Trophäensammlung unterhält.
Der Fall geht an Detective Inspector Johnny Mann und ist seine Chance zur Rehabilitierung, denn der fähige Beamte wurde aus dem „Organised Crime and Triad Bureau“ geworfen und in die Provinz strafversetzt, weil seine Privatfehde mit den Triaden – der asiatischen Mafia – in einen offenen Krieg auszuarten drohte. Auch dieses Mal ist Chan, Manns Todfeind von der Wo-Shing-Shing-Triade, in den Fall verwickelt: Die „Geistermädchen“ waren im „Club Mercedes“ beschäftigt, der fest in Triadenhand ist.
Ahnungslos gerät die Halbchinesin Georgina Johnson ins Visier des „Metzgers“, wie der Mörder bald genannt wird. Sie kam aus England nach Hongkong, um ein neues Leben zu beginnen. Herzlich wird sie von ihren Cousinen Ka Lei und Lucy empfangen. Letztere arbeitet als Hostess im „Club Mercedes“. Gerade hat sie sich nach einer Pechsträhne im Glücksspiel hoch bei Chan verschuldet, der damit nach Triaden-‚Recht‘ über sie und ihre Familie bestimmen kann, was Georgina einschließt. Die sticht auch Inspector Mann ins Auge, der sich um die junge Frau bemüht. Als Georgina spurlos verschwindet, argwöhnt Mann richtig, als er Chan beschuldigt. Obwohl ihn die von der Triade infiltrierten und geschmierten Behörden bei seinen Nachforschungen behindern, lässt Mann sich nicht stoppen. Weil die Justiz ihn nicht unterstützt, muss er das Recht in die eigene Hand nehmen …
_Asien – exotisch, seltsam & gefährlich_
Andere Länder, andere Sitten; das gilt aus westlicher Sicht offenbar vor allem für den asiatischen Raum, wenn man der Autorin von „Tod der Geistermädchen“ Glauben schenken möchte. Dies fällt einerseits leicht, während Lee Weeks es ihren Lesern andererseits unnötig schwer macht. Das klingt kryptisch? Ist es aber nicht – leider, wie angemerkt werden muss.
Hongkong als Wundertüte und Höllenpfuhl stellt auch in der Kriminalliteratur kein Neuland dar. Sofort fallen dem diesbezüglich interessierten Leser die Romane der wunderbar bizarren Yellowthread-Street-Serie von William Marshall ein, was vermutlich ungerecht ist, weil der die Latte so hoch hängt, dass Neulinge wie Weeks sie erst recht reißen müssen.
Trotzdem ist Hongkong ein brodelnder Hotspot nicht nur der asiatischen Urbankultur und damit eine wunderbare Kulisse. Weeks hat dort einige Jahre außerhalb der Touristen-Reservate und keineswegs nur auf der Sonnenseite verbracht, was ihr intime Kenntnisse über gar nicht erfreuliche, aber reale Aspekte eines Alltags beschert hat, der gänzlich eigenen Gesetzen und Regeln gehorcht.
_Vom eigenen Anspruch überrollt_
Das in Worte zu fassen, die sich nicht in Klischees erschöpfen, stellt sich als Herausforderung dar, der Weeks in ihrem Debütroman eindeutig nicht gewachsen ist. Ihr Wissen um Land und Leute wird deutlich, aber sie kann es nicht kanalisieren und in den Dienst ihrer Geschichte stellen. Zu viel will und versucht Weeks; sie bemerkt dabei nicht, dass sie die Handlung heillos überfrachtet.
Da haben wir den vom gerechten Rachekampf gegen die chinesische Mafia beseelten Helden, dessen Primärfeind einst sein bester Freund war. Johnny Mann ist darüber hinaus halb Hongkong-Chinese und halb Engländer, was eigene Probleme (hier: Problemchen) aufwirft. Natürlich prallt dieser Gutmensch immer wieder hart gegen die Gummiwände seiner von den Triaden auf allen Ebenen verseuchten Welt, was endlose und moralinschwere Tiraden in Gang setzt. Ohnehin ersetzt Gefühlsdusel echte Tragik.
Eine Lovestory muss sein, was Weeks als Anlass nimmt, eine naive und – dieser Gedanke lässt sich einfach schwer verkneifen – reichlich dämliche Maid ins Geschehen zu bringen. Das geschieht in epischer Breite und zehrt vermutlich von Weeks eigenen Erfahrungen, wirkt aber überzogen, zumal Georgina Johnson im weiteren Verlauf der Handlung zum nur mehr passiven Rettungsobjekt mutiert. Wieso sich der ansonsten eher zur taffen Weiblichkeit neigende Johnny Mann ausgerechnet in die blasse Georgina verguckt, bleibt ebenso rätselhaft.
_Grusel mit der groben Kelle_
Der Plot selbst steht eher auf Nudelteig-Füßen. Zunächst scheint sich „Tod der Geistermädchen“ zum typischen Killer-Thriller unter Beteiligung eines genialischen Serienmörders zu entwickeln. Das bewahrheitet sich glücklicherweise nicht, doch die Alternative kann auch nicht entzücken. Sie soll hier dem potenziellen Leser natürlich nicht aufgedeckt werden. Auf jeden Fall ist viel Gewalt im Spiel, die sich nach und nach zum regelrechten Overkill steigert. Die Autorin orientiert sich hier anscheinend am Vorbild von Landsfrau Mo Hayder, die diesbezüglich neue Maßstäbe setzen konnte, wo Weeks sich auf oberflächliche Slasher-Effekte à la „Hostel“ beschränkt. Was erschrecken soll, ist deshalb nur schrecklich.
Die Handlung kommt langsam in Gang, schweift immer wieder ab, wenn Weeks in pseudo-tragischen Privatschicksalen schwelgen möchte, oder tritt auf der Stelle, um sich dann plötzlich zu förmlich zu überschlagen, wobei die Logik den Anschluss verliert; Manns Hubschrauber-Attacke auf Chans Foltercamp wirkt einem James-Bond-Thriller der 1960er Jahre entliehen. Action ist Weeks Sache eindeutig nicht. Hastig ernennt sie Mann vor dem Inselfinale zum Fachmann für asiatische Kriegskunst und lässt ihn seine prall mit einschlägigen Gimmicks wie Wurfsternen und Killer-Darts gefüllte Waffentruhe öffnen.
So viele Subplots hat Weeks begonnen, dass sie nach dem eigentlichen Finale mit losen Fäden dasteht. Der Hauptschurke ist längst tot, als sie darangeht, hier notdürftig Ordnung zu schaffen. Manche Seite gilt es noch zu füllen, bis alle bisher ungestraft gebliebenen Finsterlinge ihr Fett weg bekommen haben. Wie man eine Krimi-Handlung energisch gliedert, statt nur Ereignis an Ereignis zu reihen, ist Weeks (noch?) fremd.
_So böse, dass das Zwerchfell kracht_
Das Böse ist als Phänomen der Lächerlichkeit erstaunlich nahe. Diese Erkenntnis verdanken wir u. a. Schriftstellern wie Lee Weeks, die sie vermutlich unfreiwillig verbreitet. Weeks scheitert mit dem Versuch, die Allgegenwart der Triaden-Kriminalität darzustellen. Sie versucht es, indem sie ihr Gesichter gibt. Chan, CK Leung oder gar Man Po sind jedoch höchstens Schurken-Stereotypen des Hongkong-B-Kinos. Sie spielen nur Rollen, und in denen wirken sie wenig überzeugend.
Ungeschickt wirken Weeks Bemühungen, das Geschehen mit Drama und Tragik aufzuladen. Der Handlungsstrang um Ka Mei/Lucy könnte im Grunde entfallen. Streichungen und Straffungen könnte die gesamte Geschichte, die keinesfalls über 450 Seiten trägt, generell gut vertragen. Stattdessen wird Lee Weeks sie fortsetzen. Ein zweiter Teil der Johnny-Mann-Reihe erschien noch 2008. Er wird im Zuge der sachten, aber spürbaren Begeisterung für den (nicht gar zu) exotischen Krimi sicherlich ebenfalls seinen Weg nach Deutschland finden, wo sich zumindest der etwas wählerischere Leser ob dieser Tatsache mühelos in Geduld üben wird …
_Die Autorin_
Lee Weeks (geb. 1958) stammt aus der englischen Grafschaft Devon, wo sie heute wieder und inzwischen mit Familie lebt. Sie macht ein ereignisreiches Leben für sich geltend, das eine ruhelose Jugend mit einer ausgeprägten Reiselust kombinierte. Schon mit 17 Jahren begann zu reisen, was sie als Au-Pair-Mädchen, Kellnerin, Model u. a. Jobs finanzierte.
Ende der 1970er Jahre ging Weeks nach Hongkong und wurde ein „Geistermädchen“, das in den Nachtclubs der noch britischen Kolonie arbeitete und die Schattenseiten dieses Metiers aus erster Hand kennenlernte. Nach einigen Jahren kehrte Weeks nach England zurück. Ihre Erfahrungen in Asien flossen in ihr Romandebüt „Tod der Geistermädchen“ ein, das gleichzeitig Auftakt einer Krimi-Serie um den englisch-chinesischen Polizisten Johnny Mann ist.
Über ihr Leben (wenig) und Werk (ausführlich, aber inhaltsarm) informiert Lee Weeks im Internet: http://www.leeweeks.co.uk.
Die Johnny-Mann-Reihe von Lee Weeks:
(2008) The Trophy Taker (dt. „Tod der Geistermädchen“)
(2008) The Trafficked
_Impressum_
Originaltitel: The Trophy Taker (London : Avon, a division of Harper Collins Publishers 2008)
Übersetzung: Johannes Finkbeiner
Deutsche Erstausgabe: Mai 2009 (Wilhelm Goldmann Verlag/TB Nr. 46883)
445 Seiten
EUR 8,95
ISBN-13: 978-3-442-46883-6
Als eBook: Mai 2009 (Wilhelm Goldmann Verlag)
EUR 8,95
ISBN-13: 978-3-641-02747-6
http://www.goldmann-verlag.de
Becker, James – Unheilig
_Das geschieht:_
Käme die Wahrheit über den Ursprung des Christentums ans Tageslicht, wäre die Macht der katholischen Kirche gebrochen; kein Wunder, dass die Päpste schon früh dafür sorgten, dass dieses Wissen geheim bleibt. Sollte doch etwas durchsickern, wird die Apostolische Penitenziara des Vatikans – früher bekannt als „Inquisition“ – aktiv, der heuer Kardinal Vertutti vorsteht.
Ebenfalls im Boot: die Cosa Nostra, vulgo „Mafia“ genannt, die seit dem 19. Jahrhundert für den Vatikan die Drecksarbeit erledigt. „Capo“ Gregori Mandino teilt dem erschrockenen Vertutti mit, dass die Engländerin Jackie Hampton in dem uralten Haus, das sie mit ihrem Ehemann Mark in der Region Latium bewohnt, eine bisher unbekannte Spur zum besagten Geheimnis aufgedeckt hat. Als Mandino seine Schergen in Gang setzt, um dies zu überprüfen, kommt Jackie dabei um.
Der gebrochene Mark fliegt in Begleitung seines besten Freundes nach Italien. Detektive Sergeant Christopher Bronson untersucht den Tatort, an dem Mandinos Männer einen Unfall inszenierten, was der Polizist aus Kent bald durchschaut. Bronson stößt dabei nicht nur auf jene Spur, die Jackie den Tod brachte, sondern auch auf weitere Informationen. Mit Hampton reist Bronson nach London, wo Angela Lewis, Bronsons Ex-Frau, als Historikerin im Britischen Museum arbeitet. Pechvogel Mark wird von Mandino, der den Freunden gefolgt ist, gefoltert, verhört und umgebracht. Die Indizien werden so manipuliert, dass sie auf Bronson als Mörder hindeuten.
Dieser reagiert mit einer Flucht nach vorn bzw. nach Europa. In Begleitung von Angela will er das Geheimnis lüften und die Verfolger demaskieren. Während die beiden mysteriösen Hinweisen und uralten Rätseln folgen, ist ihnen ein zunehmend zorniger Mandino härter auf den Fersen, als das Paar vermutet …
_Düstere Spielchen nur teilweise Erleuchteter_
Dan Brown … zwei Worte und ein Name, der inzwischen für eine moderne Erfolgsstory sowie Auslöser einer literarischen Katastrophe steht. Brown hat den ‚Vatikan-Thriller‘ zwar nicht erfunden, ihn aber definitiv zu seinem Genre gemacht. Das Prinzip ist simpel: Die katholische Kirche, eine 2000 Jahre alte Institution mit einer an Schrecken und Geheimnissen reichen Vergangenheit, einer für Verschwörungstheorien idealen Verwaltungsstruktur sowie einem von zahllosen Legenden umwobenen Hauptquartier (dem Vatikan), investiert einen Gutteil ihrer (in diesen Thrillern stets beträchtlichen) Macht in die Verschleierung historischer Tatsachen, die ihrem Ruf unbekömmlich wären und, was wichtiger ist, an ihren angemaßten Privilegien rühren würden. Beliebt sind auch seit Jahrhunderten geführte Geheimkriege mit finsteren Organisationen, die tückische und höchst komplizierte Pläne verfolgen, welche in Richtung Weltherrschaft gehen. Wer als Autor gänzlich auf Nummer Sicher gehen möchte, kombiniert beide Konzepte.
„James Becker“ – der sich nicht grundlos hinter einem Pseudonym verbirgt – ist kein Freund komplexer Plots oder allzu detailreich ausgemalter Hintergründe. Das große ‚Geheimnis‘ drängt sich dem einigermaßen historisch beschlagene Leser schon nach dem Epilog auf, der im ersten nachchristlichen Jahrhundert in der römischen Provinz Palästina spielt. Allen Ernstes scheint Becker der Meinung zu sein, er könne den Korken auf der Rätsel-Flasche halten, indem er die Namen der beiden Männer unterschlägt, die angeblich im Auftrag des römischen Kaisers Nero den Startschuss für den Siegeszug des Christentums gaben.
Generell setzt Becker ein niedriges Erkenntnis-Niveau voraus. Auch seine Helden tappen endlos dort im Dunkeln, wo sie beim besten Willen wenigstens theoretisch der Lösung nahekommen müssten. Doch es reicht gerade dazu, den auch nicht mit Intelligenz und Findigkeit geschlagenen Bösewichten einen Schritt voraus zu bleiben. Es ist sowieso egal, was diese einfädeln, denn Chris Bronson rekonstruiert stets haargenau, was seine Gegner wieso getan haben. Anschließend fällt eine Weile Finsternis über sein Hirn, denn die Schurken müssen aufholen, damit sie ‚überraschend‘ auftauchen, auf unsere Helden schießen oder sie anderweitig bedrohen können: So funktioniert Spannung à la James Becker: als Kopf-an-Kopf-Rätsel-Rallye!
_Schema F – mit freundlicher Unterstützung von König Klischee_
Was ist von einem Rätsel zu halten, das von einem Polizisten, einem Vermögensberater und einer Expertin für antike Keramik ohne größere Probleme gelöst werden kann? Becker postuliert zwar diverse Sackgassen und Missverständnisse, wobei er jedoch nicht verbergen kann, wie simpel er sein Mysterium konstruiert ist. Größe zählt manchmal doch: Dan Brown ist auch deshalb so erfolgreich, weil er historische Fakten im ganz großen Stil mit Theorien und Legenden verquirlt. Becker fällt vergleichsweise wenig ein. Nero als verrückter Wüstling, die bockigen Katharer, das Labyrinth der vatikanischen Geheimarchive: Es passt zusammen, macht aber nicht viel her.
Wie so oft im Thriller-Genre soll wilder Aktionismus Spannung vortäuschen. Gut und Böse sausen durch Europa und haken dabei hektisch touristische und historische Highlights ab. Mit dem Laptop auf den Knien werden während der Fahrt kapitale Mysterien entschlüsselt, während am Horizont pistolenfuchtelnd die mit der Kirche verbandelte Mafia naht. Becker zieht den Leser nicht in seinen Bann, er speist ihn mit hölzern abgewickelten Spannungsroutinen ab.
_Munkelmänner & Schlaufrauen_
Dem entsprechen die saft- und kraftlosen Figuren. Zwar bemüht sich Becker, seinem (als Serienhelden geplanten) Chris Bronson ein Profil zu verleihen. Faktisch setzt er nur Klischee auf Klischee. Also ist unser Held ein nonkonformistischer Idealist mit Universitäts- und Militärausbildung, was ihm ermöglicht, seinen Gegnern nicht nur intellektuell, sondern auch im Kampf das Fell zu gerben. Privat dichtet Becker Bronson gleich zwei unglückliche Liebesgeschichten an, was ihn auch nicht interessanter wirken lässt; von der erwarteten, weil eigentlich obligatorischen Liebesszene nimmt Becker glücklicherweise Abstand, obwohl dem Leser dadurch womöglich ein Höhepunkt der unfreiwilligen Komik entgeht.
Während es die Liebe seines Lebens nur bis auf Seite 19 schafft, darf die Ersatzfrau glänzen. Erstaunlich rasch versöhnt sich die beleidigte Angela mit ihrem Chris, nachdem die Konkurrentin ins Gras gebissen hat, und wirft sich zum Ex-Gatten in den Wagen, um sich auf eine europaweite Schnitzeljagd zu begeben, während Polizei, Kirche und Mafia sich auf ihre Fährte setzen – fürwahr eine logische Entscheidung!
Oder kannte Angela ihre Gegner bereits? Obwohl sie in der Übermacht sind und ihnen alle möglichen (und auch unmöglichen) Überwachungstechniken zur Verfügung stehen, versauen diese Schurken noch jede Teufelei irgendwie. Gregori Mandino soll einen Mafiosi des 21. Jahrhunderts darstellen – gebildet, gut gekleidet, äußerlich ins legale Gefüge seines Landes integriert, innerlich jedoch ein skrupelloser Killer sowie Botschafter eines kriminellen Imperiums, das Becker als staatsähnliches „Reich des Bösen“ charakterisiert.
Zwischen der Mafia und der Kirche sieht Becker jene Parallelen, die auch Volkes Stimme gern voraussetzt. Wie dieses Bündnis gestaltet ist, legt Mandino Kardinal Vertutti und den Lesern in einer Art Referat dar. Nur eines sei verraten: Raffiniert oder überzeugend klingt anders! Folgerichtig bietet auch besagter Kardinal eine flache Figur. Er ist ein machtlüsterner, scheinheiliger Kirchenfürst, der für die Konservierung des Status quo mit einem frommen Spruch auf den Lippen über Leichen zu gehen bereit ist.
Der Auflösung wird selbstverständlich eine finale Überraschung als Coda angeklebt. Die ist wahrlich nicht von dieser Welt und impliziert Sensationen, die Becker in der Fortsetzung seiner Reihe weder umsetzen kann noch wird, weil er sich selbst den Ast absägen würde, auf dem er sitzt und schreibt. Andererseits merkt er das vielleicht gar nicht, und man sollte ihn machen lassen, womit sich das Problem weiterer Munkel-Thriller, die unsere Welt nicht braucht, allein erledigt …
_Der Autor_
„James Becker“ ist ein Pseudonym des Schriftstellers Peter Stuart Smith. Er flog zwei Jahrzehnte Hubschrauber für die Royal Navy und half später bei der Entwicklung von Planspielen, die mögliche Szenarien zukünftiger Kriege erfassten. Hier erwarb der zukünftige Autor jenes Wissen, das es ihm ermöglichte, seine im militärischen Umfeld spielenden Thriller mit einschlägigen Fachtermini zu würzen. Außerdem war Smith dienstlich viel in der Welt unterwegs, was sich ebenfalls in seinen Romanen widerspiegelt.
„Overkill“ (dt. „Operation Overkill“), Smith‘ Romanerstling, erschien 2004 unter dem Pseudonym „Commander James Barrington“. Das Buch ist gleichzeitig Start einer Serie, die den britischen Geheimagenten Paul Richter im weltweiten Kampf gegen kriegslüsterne Terroristen, Verräter und anderes Schurkengezücht präsentiert, wobei der akkuraten Beschreibung der einsetzten Waffen und Gefechtsmethoden mindestens ebenso viel Platz eingeräumt wird. Um die Komplexität der technischen Schilderungen in etwa auszugleichen, meidet Smith in seinen Handlungsplots jegliche Hintergründigkeit.
2008 legte er sich ein zweites Pseudonym zu: „James Becker“ wird (mindestens) drei Bände einer Serie um den Polizisten und Ex-Soldaten Chris Bronson schreiben, der im Kampf mit dem Vatikan, der Mafia und anderen zwielichtigen Organisationen verborgene und vertuschte Geheimnisse der katholischen Kirche aufdeckt, von denen nicht einmal Robert Langdon zu träumen wagt.
Peter Stuart Smith lebt heute im Kleinstaat Andorra in den östlichen Pyrenäen. Über seine Aktivitäten informiert er militärisch präzise und ohne Schnickschnack auf seiner Website („It’s small, simple, fast to load, and without frills.“): http://www.jamesbarrington.com.
Die Chris-Bronson-Serie:
(2008) The First Apostle (dt. „Unheilig“)
(2009) The Moses Stone (noch keine dt. Ausgabe)
(2010) The Messiah Secret (noch keine dt. Ausgabe)
_Impressum_
Originaltitel: The First Apostle (New York : Bantam Books 2008)
Dt. Erstausgabe: Februar 2009 (Blanvalet Verlag/TB Nr. 37175)
Übersetzung: Ralph Sander
416 Seiten
EUR 7,95
ISBN-13: 978-3-442-37175-4
Als eBook: Oktober 2009 (PeP Verlag)
EUR 7,95
ISBN-13: 9-783-641-03028-5
http://www.blanvalet.de
Shuman, George D. – Hand des Todes, Die
_Das geschieht:_
Sherry Moore aus Philadelphia ist zwar blind, sie wird aber trotzdem oft und landesweit von der Polizei als Sonderermittlerin angefordert, denn die junge Frau verfügt über eine einzigartige Gabe: Berührt sie eine Leiche, durchlebt sie deren letzten 18 Lebens-Sekunden. Hat dieser Mensch dabei seinen oder ihren Mörder gesehen, ist dies für die Fahndung überaus hilfreich.
Aktuell wird Moore in Cumberland, einer kleinen Stadt im US-Staat Maryland, eingesetzt. Im Kühlraum einer stillgelegten Schlachterei fand man drei tote Frauen. Sie wurden hier gefangen gehalten, gefoltert und schließlich umgebracht. Dieser Fall bekommt zusätzliche Brisanz durch die Tatsache, dass diese Morde bereits vor drei Jahren geschahen und als aufgeklärt galten. Nun stürzen sich die Medien auf die Tatsache, dass damals die falschen Täter beschuldigt wurden. Außerdem könnte der Täter weiterhin sein Unwesen treiben.
Dem ist tatsächlich so, obwohl Kenneth Dentin sein Tötungsritual inzwischen variiert. Er ist seit vielen Jahren fasziniert vom Töten durch Ersticken. Sein Trieb droht ihn inzwischen zu übermannen; zwischen den Morden werden die Abstände immer kürzer.
Konnte Sherry Moore, über deren Besuch am Tatort die Medien ausführlich berichteten, den Gedanken der toten Frauen Hinweise auf seine Person entnehmen? Dem ist zwar nicht so, aber die skrupelarme FBI-Agentin Alice Springer behauptet genau das, um den Mörder aus der Reserve zu locken. Das macht Moore zum Köder, denn Dentin wird auf die blinde Ermittlerin aufmerksam, und weil die Polizei thrillertypisch bei der Überwachung schlampt, gerät Moore prompt in Lebensgefahr …
_Kein frischer Wind im Killer-Thriller_
Es weht ein Hauch der Verzweiflung durch das Subgenre. Längst wurde mit allem gemeuchelt & gemetzelt, was Werkzeugkästen, Arzttaschen oder Küchenschubladen hergeben. Geniale Mörder würgten & wirkten immer abgedrehter, bis sie die Grenze zur Lächerlichkeit durchbrachen. Inzwischen schnetzelten sie allein, zu zweit oder im Rudel, und sie begründen und verschlüsseln ihre Übeltaten so gründlich, dass ihnen für das eigentliche Morden kaum noch Zeit bleiben dürfte.
Ein Relaunch im Sinne eines echten Neustarts unter Tilgung des inzwischen geronnenen Kill-Klimbims ist überfällig, aber weiterhin hängen viele Autoren, die erst spät auf den Butcher-Bus aufgesprungen sind, an den alten Klischees, die sich durchaus noch toppen lassen. George Shuman ist keineswegs der erste Verfasser, dem der Einfall kam, den Thriller mit Elementen der Phantastik zu verschneiden. Er gehört zu denen, die damit ziemlich Schiffbruch erleiden.
Als ehemaliger Polizist kennt er den Arbeitsalltag der fahndenden und verurteilenden Gerechtigkeit offensichtlich gut. „Die Hand des Todes“ profitiert von diesem Insider-Wissen, über das längst nicht alle Krimi-Autoren verfügen. Das Buch unterhält vor allem dort, wo der Verfasser einschlägige Abläufe schildert. Shuman hätte gut daran getan, mit diesem Pfund stärker zu wuchern.
_Phantastisch, aber nicht fantasievoll_
Das Übernatürliche hat im ‚realistischen‘ Kriminalroman wenig zu suchen. Das wird in „Die Hand des Todes“ sogar überdeutlich, weil Shuman mit der mysteriösen Gabe seiner Hauptfigur erstaunlich wenig anzustellen weiß. Sherry Moore kann 18 Sekunden der Erinnerung aus toten Hirnen sichten. Das postuliert der Verfasser, um diese Gabe sogleich durch diverse Hindernisse einzuschränken, die einen praktischen Nutzen beinahe ausschließen – kein Wunder, denn die Geschichte wäre zu Ende, könnte Sherry Moore den Täter zuverlässig erkennen.
Der Plot ist schon ohne übersinnliches Element simpel genug, wobei Shuman hier womöglich den Realitätsfaktor nicht einmal überstrapaziert. Allzu viele Serienkiller können ihre ‚Erfolge‘ auf zwischenbehördliche Missverständnisse und misslungene Fahndungsarbeit zurückführen. Hinzu kommen politische Intrigenspiele und ein Mediendruck, der zumindest im Thriller vor allem die negativen Charakterzüge des Menschen weckt, bedient und fördert.
Auf jeden Fall kann es seine Zeit dauern, bis ein Strolch hinter Gitter kommt. „Die Hand des Todes“ ist kein „Whodunit“, die Identität des Täters steht schon früh fest. Shuman erlegt seinem Killer Dentin nicht das Joch übermenschlicher Schläue auf (dazu unten mehr), aber er kennt die Nischen, die ihm ein anonymes und unverdächtiges Leben bieten, gut genug, um zwischen sich und der Polizei einen soliden Sicherheitsabstand zu wahren. Während er seinen mörderischen Weg weitergeht, blendet der Autor immer wieder auf seine Jäger um, bis sich die Wege von Gut und Böse schließlich schneiden. Der Weg dorthin ist konventionell, und das trifft ebenfalls auf das Finale zu.
_Wie unterhaltsam ist die Dauerkrise?_
Shumans Figurenzeichnung sorgt abermals für einige Verblüffung. Während es ihm beim besten Willen nicht gelingt, Sherry Moore als Identifikations- oder gar Sympathiefigur aufzubauen, ist er wesentlich erfolgreicher in der Gestaltung eines Killers, der glaubhaft psychisch krank wirkt.
Moore ist Klischee pur – selbstverständlich bildschön, aber blind und somit verletzlich, was für zusätzliches Interesse sorgen soll, obwohl unsere Heldin diese Behinderung so fabelhaft ausgleicht, dass sie zum Beispiel eine erstklassige Kampfsportlerin abgibt. Darüber hinaus nervt Shuman seine Leser mit endlosen Flashbacks auf Moores chronisch unglückliches Privatleben, wobei er sich reichlich aus dem ersten Teil der Serie („18 Sekunden“, Heyne-TB Nr. 43278) bedient. Mit der überzeugenden (oder wenigstens erträglichen) Darstellung von Gefühlen hapert es bei Shuman generell. Er kann außerdem nicht verschleiern, dass Moore keine Tiefe und wenig Potenzial aufweist; irgendwie hat sie die Tendenz, aus dem Zentrum der Story zu verschwinden: kein idealer Zug für eine Hauptfigur.
Kenneth Dentin ist wie schon erwähnt kein Serienkiller, der sich über monströse Gruseltaten definiert. Wiederum zahlt sich Shumans Fachwissen aus. Dentin ist ein kranker Mann und ein Mörder, der unter seinem Trieb durchaus leidet, ohne daraus jedoch Konsequenzen zu ziehen: Stärker als die Sorge, langsam endgültig in den Wahnsinn abzugleiten, ist Dentins Furcht, lebenslänglich im Gefängnis sitzen zu müssen. Shuman gelingt das Kunststück einer Figur, deren Motive man versteht, ohne ihnen zustimmen zu müssen. Dentin ist kein Monster, sondern ein Mensch – ein Mensch freilich, vor dem man sich hüten muss!
Doppelt schade ist deshalb, dass „Die Hand des Todes“ – blöder und nichtssagender deutscher Titel übrigens – nur Thriller-Mittelmaß bietet. Dem Erfolg der Sherry-Moore-Serie tut das offenbar keinen Abbruch; Shuman setzt sie mit einem Band pro Jahr fort und kann dabei auf jenen Teil der Leserschaft setzen, die ihren Lesestoff ohne allzu viele Novitäten schätzt, sondern die sanfte Variation des Bekannten favorisiert …
Die Sherry-Moore-Serie erscheint im |Wilhelm Heyne|-Verlag:
(2006) 18 Sekunden („18 Seconds“)
(2007) Die Hand des Todes („Last Breath“)
(2008) Blinde Angst („Lost Girls“)
(2009) „Second Sight“ (noch kein dt. Titel)
_Impressum_
Originaltitel: Last Breath (New York : Simon & Schuster, Inc. 2007)
Übersetzung: Norbert Jacober
Deutsche Erstausgabe: Dezember 2008 (Wilhelm Heyne Verlag/TB Nr. 43347)
352 Seiten
EUR 8,95
ISBN-13: 978-3-453-43347-2
http://www.heyne-verlag.de
Mills, Mark – siebte Stufe, Die
_Das geschieht:_
Auf der Suche nach einem Thema für seine Doktorarbeit reist Adam Strickland, Student der Kunstgeschichte, im Sommer des Jahres 1958 nach Italien. Dort besitzt eine alte Freundin seines Professors, Signora Francesca Docci, in den Bergen der Toskana bei Florenz ein Landhaus, zu dem ein Garten gehört, den der Erbauer der Villa im 16. Jahrhundert im Gedenken an seine früh verstorbene Ehefrau errichten ließ.
Abweichungen in der ihm wohlbekannten Formensprache der Renaissance verraten Strickland, dass die mit dem Garten verbundene Geschichte einer unsterblichen Liebe ein bisher unbekanntes und wohl auch hässliches Element besitzt. Das gilt offenbar ebenso für die gegenwärtige Docci-Generation, die Strickland im Verlauf seiner Forschungen so gut kennenlernt, dass ihn Francesca, die trotz Krankheit ihre Familie fest im Griff hat, in der Villa wohnen lässt.
Dort erfährt Strickland von einer düsteren Begebenheit der unmittelbaren Vergangenheit. 1944 wurde Emilio, Francescas ältester Sohn, angeblich von deutschen Besatzern im Obergeschoss der Villa erschossen. Strickland, der in der Familienbibliothek eigentlich nach Hinweisen auf den Gedenkgarten sucht, entdeckt jedoch Hinweise auf ein gut vertuschtes Familiendrama. Gemeinsam mit Antonella, der schönen Enkelin Francescas, und seinem inzwischen angereisten Bruder Harry verschafft sich Adam Zugang in das seit der Tragödie unberührten weil verriegelten Obergeschoss. Während er das Rätsel des Gartens lüftet, findet er heraus, was 1944 tatsächlich geschah.
Während Strickland für seine Leistung als Historiker großes Lob erfährt, beobachtet der noch sehr lebendige Mörder Emilios, wie der junge Mann der Wahrheit immer näher kommt. Da Strickland es im Umgang mit den lebenden Schurken an gebotener Zurückhaltung fehlen lässt, bringt er sich in Gefahr, als er seinem naiven Drang nach Gerechtigkeit nachgibt …
_Erkenntnissuche birgt Risiken_
Mark Mills ist offenkundig ein Autor mit Ehrgeiz. „Die siebte Stufe“ präsentiert nicht nur zwei Plots, die kunstvoll miteinander verwoben werden, sondern spielt auch noch in einer unaufdringlich und überzeugend heraufbeschworenen Vergangenheit. Darüber hinaus erzählt Mills von einem jungen, recht unbedarften Mannes, den das Erlebte merklich reifen lässt: „Die siebte Stufe“ wird zum „coming-of-age“-Roman – inklusive Liebesgeschichte.
Erfreulicherweise zeigt sich der Verfasser seinem Projekt durchweg gewachsen. „Die siebte Stufe“ liest sich spannend, die Figuren wirken lebendig, und auch stilistisch legt Mills die Latte hoch auf: Dies ist kein Buch, das sich zur Lektüre im Halbschlaf eignet. Die Geschichte fordert Aufmerksamkeit, aber die verdient sie auch. Mills sitzt außerdem nie auf einem hohen Ross; wenn er beispielsweise die vorder- und hintergründigen Motive der im Gedenkgarten aufgestellten Skulpturen erläutert und in Beziehung zu Dantes „Inferno“ setzt, versteht man ihn auch ohne eigenes Studium der Kunst- und Literaturgeschichte. Mills doziert nicht, er lässt keine Nebenfiguren in Vertretung des Lesers Fragen stellen, sondern die notwendigen Informationen in die Handlung einfließen.
Die ist trotz eines ‚gedoppelten‘ Plots zwar komplex, aber nie kompliziert. Das Rätsel des Gartens und das Geheimnis der Doccis besitzen keine unmittelbaren Berührungspunkte, da vier Jahrhunderte sie trennen. Die Parallelen gehen allein auf Mills zurück. Sie dienen ihm als Aufhänger für die Illustrationen eines nur scheinbar banalen Sprichworts: Schlafende Hunde sollte man nicht wecken!
_Auch sehender Eifer schadet nur_
Diese Erkenntnis fehlt noch im Erfahrungsschatz von Adam Strickland, der außerdem als Beobachter und Katalysator für eine in ihrem Fortgang erstarrte Tragödie auftritt. Mit seinen 22 Jahren wirkt Strickland zunächst harmlos. Von diesem Eindruck lassen sich auch die Doccis täuschen, die ihn sogar in ihr Haus einladen – eine Nähe, die sie seit den Ereignissen von 1944 selbst ihren Nachbarn nicht mehr gestatteten.
Zunächst beschränkt sich Strickland auch brav auf den Garten. Aber bereits hier bricht sich seine in der Unscheinbarkeit getarnte Intelligenz Bahn. Strickland ist der geborene Historiker. Er vermag Indizien zu finden und zu deuten, indem er sie in Relation mit bereits fixiertem Wissen zu setzen vermag. In diesem Punkt gleicht der Historiker dem Kriminologen: Dies ist eine Korrespondenz, derer sich Mills einfallsreich bedient. Unmerklich geraten Strickland Hinweise auf ein zweites Rätsel unter die Augen.
Dieses Rätsel ist nicht Jahrhunderte alt, sondern ‚frisch‘. Was das bedeutet, vermag Strickland erst zu spät zu erkennen. Ein uralter Mord ergibt eine interessante Geschichte, doch ein ungesühnter Mord bringt den noch lebenden Täter in Gefahr. Diesen Aspekt des Ent-Rätseln unterschätzt Strickland sträflich. Nicht nur er zahlt seinen Preis dafür. Er bringt Ereignisse zur Fortsetzung, die 1944 in einen Dornröschenschlaf versanken. In anderthalb Jahrzehnten haben sie ihre Sprengkraft nicht verloren.
_Idylle mit Fußangeln_
Die Toskana ist als Schauplatz fast zum Klischee geronnen. Viel zu viele Autoren beschränken sich darauf, die traumhafte Schönheit der Landschaft zum Inhalt ihrer Geschichten zu machen. Auch Mills hebt die Vorzüge von Land und Leuten hervor. Er sieht freilich hinter die Kulissen. Seine Geschichte siedelt er in einer seit jeher unruhigen Region an: Schon Dante Alighieri (1265-1321), sondern auch Niccolò Machiavelli (1469-1527) – deren Werke für „Die siebte Stufe“ von Bedeutung sind – mussten sich in die toskanische Verbannung begeben. 1958 ist die verschlafene Toskana längst nicht zur Ruhe gekommen. Im II. Weltkrieg bereiteten sich die nazideutschen Truppen hier auf die Entscheidungsschlacht mit den vorrückenden Alliierten vor. In den Bergen lauerten patriotische Partisanen. Ebenso patriotisch waren italienische Faschisten, die mit den Deutschen gemeinsame Sache machten. Der weltanschauliche Riss zog sich oft durch ein und dieselbe Familie. Nach dem Krieg rechneten die ‚Sieger‘ mit den ‚Kollaborateuren‘ ab und legten das Fundament für neue Bitterkeit, während eine echte politische Aufarbeitung der Mussolini-Ära ausblieb.
Immer wieder trifft Strickland Männer und Frauen, die noch eine Rechnung offen zu haben glauben. Unfreiwillig zündet der junge Fremde die schwelende Lunte wieder an. Die Macht der Tradition bleibt ihm fremd, obwohl er es aus dem Studium des Gedenkgartens besser wissen müsste: In der Toskana lässt man sich für die Rache Zeit. Bis er das begriffen hat, vergeht glücklicherweise einige Zeit und ist ein hindernisreicher Prozess, dem wir dieses unterhaltsame Buch verdanken.
_Der Autor_
Mark Mills (geb. 1963) studierte Kunstgeschichte in Cambridge. Nach seinem Abschluss 1986 arbeitete er als Drehbuchautor; auf seinen Vorlagen basieren u. a. die Filme „The Lost Son“ (1999, dt. „Der Zorn des Jägers“) und „The Reckoning“ (2003, dt. „Das dunkle Geheimnis“).
Als Romanautor debütierte Mills 2004 mit „Amangasett“ (auch „The Whaleboat House“, dt. „Netz der Lüge“). Im Gewand der Historienkrimis verband er meisterhaft eine spannende Handlung mit einem Gesellschafts-Panorama; die britische „Crime Writers Association“ kürte „Netz der Lüge“ zum besten Roman des Jahres 2004. Ähnlich begeistert nahmen Kritik und Publikum Mills nächste Romane auf.
Mit seiner Familie lebt und arbeitet Mark Mills in Oxford.
_Impressum_
Originaltitel: The Savage Garden (London : HarperCollins 2007/New York : G. P. Putnam’s Sons 2007)
Übersetzung: Anke u. Eberhard Kreutzer
Deutsche Erstausgabe (geb.): April 2009 (Karl Blessing Verlag)
384 Seiten
EUR 19,95
ISBN-13: 978-3-89667-245-2
http://www.randomhouse.de/blessing
Simmons, Dan – Drood
_Das geschieht:_
Im Sommer des Jahres 1865 überlebt Charles Dickens, der nicht nur in seiner englischen Heimat berühmte Schriftsteller, ein schreckliches Eisenbahnunglück. Während er den zahlreichen Verletzten zu helfen versucht, entdeckt er eine bizarre Gestalt, die sich an den Opfern zu schaffen macht: Dies ist Dickens‘ erste Begegnung mit dem mysteriösen Drood, der ihn in den nächsten fünf Jahren – die letzten seines Lebens – immer wieder peinigen wird.
Nur seinen engsten Vertrauten zieht Dickens ins Vertrauen. Der kränkliche und opiumsüchtige Wilkie Collins, ebenfalls ein erfolgreicher Autor, mag an die Existenz von Drood lange nicht glauben, bis ihn ein ehemaliger Polizist eines Besseren belehrt. Inspector Field ist in Ungnade gefallen, nachdem Drood praktisch unter seinen Augen einen Edelmann ermordete. Besessen verfolgt Field den Schurken seit Jahren, um sich zu rehabilitieren und Drood stoppen zu können, der unter dem Pflaster von London ein Reich des Schreckens etabliert hat: In ehemaligen Steinbrüchen und Grabgewölben hausen die Ausgestoßenen und Verdammten der großen Stadt, die zum Sklaven eines Mannes wurden, der als intimer Kenner altägyptischer Riten sogar den Toten befehlen kann.
Als Collins seinem Freund Dickens helfen will, gerät er ebenfalls in Droods Gewalt. Verzweifelt versucht Collins zu entkommen, doch Drood und seine Schergen lauern überall. Systematisch werden jene ermordet, die ihnen in die Quere kommen. Nur Dickens eilt von Erfolg zu Erfolg, was in Collins die Frage aufkommen lässt, ob ihn sein Freund womöglich verraten und an Drood verkauft hat. Als Dickens ahnt, dass Collins ihn verdächtigt, beginnen beide Männer ein heimliches Katz-und-Maus-Spiel, das nur einer überleben wird – oder keiner, falls Drood es so will …
_Ein Autor zwischen allen Stühlen?_
Wie bespricht man einen so umfangreichen und mit Handlung nicht geizenden Roman? Schon die leserübliche Eingangsfrage lässt sich kaum beantworten: Welchem Genre lässt sich „Drood“ zuordnen? Dan Simmons entzieht sich ihr mit bemerkenswerter Energie. Er will – immerhin das wird bald deutlich – primär eine unterhaltsame Geschichte erzählen. Die Kategorisierung überlässt er denen, die ohne Schubladen nicht leben (oder lesen) können. Der Versuch wird dennoch unternommen: „Drood“ ist Historien-Roman, (doppelte) Autoren-Biografie, Liebesgeschichte, Horror, Krimi und Abenteuer, wobei die Grenzen verschwimmen und die Genre-Anteile sich in ständig wechselnder Intensität mischen. (Man könnte das alles auch unter dem hilfreichen Nonsense-Begriff „Belletristik“ subsumieren …)
Die Unberechenbarkeit der daraus resultierenden Geschichte irritiert. Einerseits ist das vom Verfasser, der sein Publikum in die Irre führen möchte, durchaus gewollt, andererseits ist es aber auch die unschöne Folge einer Story, die sich offensichtlich selbstständig gemacht hat. Deutlich wird jedenfalls, was Simmons nicht schreiben wollte: eine weitere Gruselgeschichte in viktorianischer Kulisse, in der Drood das geniale Scheusal gibt, das letztlich doch sein Schicksal ereilt. Folgerichtig bleibt die Identität von Drood ebenso unklar wie das Ende von Dickens‘ letztem Roman, was in weiterer Konsequenz eine der zahlreichen literarischen Spielereien ist, die Simmons sich und seinen Lesern gönnt.
Eindeutig lässt „Drood“ einen roten Faden vermissen. Knapp 1000 Seiten ist dieses Buch stark; die Geschichte benötigt so viel Papier objektiv nicht. Darin spiegelt Simmons freilich die zeitgenössische Literaturwelt wider: Dickens und Collins schrieben in einer Zeit ohne die Attraktionen und Ablenkungen des 21. Jahrhunderts. Jene Menschen, die sich Freizeit leisten konnten, lasen – konzentriert und ausgiebig. 1000 Seiten „Drood“ hätten 1865 kein Aufsehen erregte; Romane waren oft zwei- oder dreibändig. Mäandrierende Handlungen waren kein Manko, sondern wurden in den Lektüre- und Verständnisprozess integriert.
_Ein Drood als Schnittmenge zweier ‚Freundschaften’_
Das hat sich geändert. Auf den Punkt soll ein Autor heute kommen. In dieser Hinsicht wird „Drood“ vielfach zur harten Geduldsprobe. Viel hat sich Simmons vorgenommen – zu viel womöglich, denn Vielschichtigkeit ist kein literarisches Qualitätsmerkmal, wenn nur der Verfasser weiß, worauf er eigentlich hinauswill. Falls „Drood“ primär die Geschichte einer von Neid und Konkurrenzdenken überlagerten Freundschaft ist, deren Scheitern sich in der Manifestation eines Dämons namens Drood ausdrückt, geht dies in der Unzahl der Handlungsstränge unter.
Benötigt „Drood“ überhaupt ein phantastisches Element? Diese Frage stellte sich schon, als Simmons sein monumentales Epos [„Terror“ 4278 (2007) mit einem Polar-Monster anreicherte, obwohl die Geschichte auch ohne den so erzeugten Horror glänzend funktionierte. Offenbar möchte sich Simmons ein Hintertürchen offenhalten und jene Leser nicht verlieren, die ihn als Verfasser ausgezeichneter Science und Weird Fiction kennen und schätzen. Unerquicklicherweise wirken die damit einhergehenden Effekte in „Drood“ aufgesetzt.
Dabei ist die Geschichte der ‚Freundschaft‘ zwischen Charles Dickens und Wilkie Collins spannend wie ein Krimi. Simmons hat ausgiebig recherchiert und zwei Männer zu nicht nur literarischem Leben erweckt. Stimmen alle Details? Das ist nebensächlich, denn viel wichtiger ist die Geschichte, die Simmons daraus formt. Sowohl Dickens als auch Collins sind Getriebene und Besessene, die schon vor dem Erscheinen Droods einander belauern. Collins, der Jüngere, will den charismatischen Älteren aus dem Olymp vertreiben, um selbst seine Stelle einzunehmen. Er hungert nicht nur nach Ruhm, sondern ersehnt auch den gesellschaftlichen Aufstieg, wie er Dickens gelang.
Der ist sich seiner Gipfelstellung nicht nur bewusst, sondern auch keinesfalls bereit, sie zu räumen. Dickens durchschaut Collins, denn er ist nicht nur der bessere Autor, sondern durchaus durchtrieben. Wie man sich in der Öffentlichkeit ins rechte Licht setzt, versteht er besser als Collins. Dass er Dickens niemals das Wasser reichen konnte und was er als Freund ungeachtet dessen an ihm hatte, begreift Collins viel zu spät.
Wie Kater umkreisen der Alte und der Junge sich. Viktorianische Höflichkeit betont die Härte ihres Duells noch, das über unzählige Runden geht, unfaire Methoden wie den Einsatz von Hypnose einschließt und die Kontrahenten körperlich wie geistig zermürbt. Ganz selten fallen die Masken, und purer Hass bricht sich Bahn. Angesichts dieser realen Unbarmherzigkeit wirkt Drood wie ein Geisterbahn-Bösewicht.
Gleichzeitig spornen sich Dickens und Collins zu literarischen Höchstleistungen an. So erzählt „Drood“ auch von der Geburt des modernen Kriminalromans, der beiden Autoren wichtige Entwicklungsimpulse verdankt. Wie die Psyche das menschliche Handeln bestimmt, spielte Collins noch vorsichtig, aber schon überzeugend in „The Moonstone“ (1868; dt. „Der Monddiamant“) durch. Dickens griff dies 1870 in seinem letzten Roman (s. u.) auf. „Drood“ wiederum macht (in Romanform) deutlich, wie sich die beiden Männer in die gefährlichen Untiefen der menschlichen Seele vortasten – und dort verlieren.
_Die Vergangenheit nimmt Gestalt an_
„Drood“ ist ein Roman, dessen Verfasser sehr viele Seiten dem Versuch widmet, seinen Lesern die Welt des 19. Jahrhunderts näherzubringen. Das geschieht zwar auf Kosten einer stringenten Story, aber Simmons handelt generell richtig. Obwohl die viktorianische Ära von Dickens & Collins kaum 150 Jahre zurückliegt, käme sich ein Mensch der Gegenwart im London der Jahre 1865 bis 1870 wie ein Außerirdischer vor.
Die Erkenntnis dessen, was diese Fremdartigkeit ausmacht, ist ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis von Simmons‘ nicht nur inhaltlich seltsamen Geschichte. Im 21. Jahrhundert ist die allgegenwärtige Präsenz mehr oder weniger prominenter Zeitgenossen alltäglich geworden. Deshalb ist es beispielsweise schwierig nachzuempfinden, wie berühmt Charles Dickens wirklich war – nicht nur ein genialer Erzähler, sondern auch begnadet im Vortrag seiner Werke; ein Superstar seiner Zeit, der sein Publikum ohne Verstärker oder digitale Effekte, sondern nur mit der Kraft seiner Stimme zu fesseln und hysterische Ausbrüche zu erzeugen vermochte.
Wie dies gelingen konnte, vermag Dan Simmons überzeugend deutlich zu machen. ‚Sein‘ Charles Dickens ist kein fehlerfreier, aber ein faszinierender Mann und in seinem Metier der unnachahmliche Meister. Deshalb bedeutete sein Tod am 9. Juni 1870 einen doppelten Verlust: das Ende eines nicht von Verlagen und Medien gehypten, sondern von seinen Lesern gekürten Bestsellerautoren, der sein letztes Werk unvollendet lassen musste.
_Ein Geheimnis fasziniert die lesende Welt_
Am 1. April 1870 erschien die erste Lieferung des Romans „The Mystery of Edwin Drood“, der wie seinerzeit üblich zunächst in Fortsetzungen erschien. Für den März 1871 war der zwölfte und letzte Teil angekündigt. Da „The Mystery …“ eine Kriminalgeschichte erzählte, würde dieses Finale gleichzeitig die Auflösung eines Mordfalles bieten, dessen Autor alle seine beträchtlichen Register zog, um die Spannung zu schüren. Doch Dickens, der noch schrieb, während „The Mystery …“ bereits erschien, und den Lieferungen dabei nie weit voraus war, starb über den Fahnen des sechsten Teils, der im September 1870 postum erschien. Notizen über den Ausgang der Geschichte hinterließ Dickens nicht.
Womöglich wurde „The Mystery …“ gerade auf diese tragische Weise unsterblich: Dickens musste nie unter Beweis stellen, ob die Auflösung seinem Rätsel genügte. Stattdessen hinterließ er ein an offenen Fragen und Rätseln reiches Fragment, an dessen Interpretation, Entschlüsselung oder Vollendung sich in den folgenden Jahren und Jahrzehnten Literaturwissenschaftler und Schriftsteller, aber auch und erst recht unzählige Hobby-Kriminologen versuchten.
Simmons verknüpft das Drood-Rätsel geschickt mit einem Unglück, dem Charles Dickens am 9. Juni 1865 nur knapp mit dem Leben entkam: Er saß in dem Zug, der nahe Staplehurst in der englischen Grafschaft Kent auf einem Eisenbahnviadukt entgleiste. Zehn Fahrgäste starben, vierzig wurden zum Teil schwer verletzt. Dickens wurde von den Bildern dieses Unglücks verfolgt. Für „Drood“ knüpfte Simmons hier an. In diesem Zusammenhang war es außerdem hilfreich, dass Dickens mysterygerecht auf den Tag genau fünf Jahre nach dem Unfall starb.
Solche realen Ereignisse werden vom Verfasser entweder aufgegriffen, aber auch chiffriert und verfremdet. Zusammen mit unzähligen Anspielungen, die den Roman zur Freude literaturhistorischer „nitpicker“ durchziehen, machen sie „Drood“ zum Selbstbedienungsladen, in dem jeder Leser finden kann, was ihm gefällt. Das ist die positive Deutung, denn „Drood“ ist auch ein mit Überraschungen allzu prall gefüllter Koffer, dessen Inhalt dem Leser beim Öffnen um die Ohren fliegt. Der Rezensent kann und mag hier kein abschließendes Urteil treffen, sondern beschränkt sich auf die (persönliche) Feststellung, dass sich selten ein Buch mit 1000 Seiten auch ohne roten Faden so flüssig und spannend lesen ließ wie „Drood“.
_Der Autor_
Dan Simmons wurde 1948 in Peoria, Illinois, geboren. Er studierte Englisch und wurde 1971 Lehrer; diesen Beruf übte er 18 Jahre aus. In diesem Rahmen leitete er eine Schreibschule; noch heute ist er gern gesehener Gastdozent auf einschlägigen Workshops für Jugendliche und Erwachsene.
Als Schriftsteller ist Simmons seit 1982 tätig. Fünf Jahre später wurde er vom Amateur zum Profi – und zum zuverlässigen Lieferanten unterhaltsamer Pageturner. Simmons ist vielseitig, lässt sich in keine Schublade stecken, versucht sich immer wieder in neuen Genres, gewinnt dem Bekannten ungewöhnliche Seiten ab.
Über Leben und Werk von Dan Simmons informiert die schön gestaltete Website [www.dansimmons.com.]http://www.dansimmons.com
_Impressum_
Originaltitel: Drood: A Novel (New York : Little, Brown & Co. 2009)
Deutsche Erstausgabe (geb.): Oktober 2009 (Wilhelm Heyne Verlag)
Übersetzung: Friedrich Mader
976 Seiten
EUR 24,95
ISBN-13: 978-3-453-26598-1
http://www.heyne.de
_Dan Simmons auf |Buchwurm.info|:_
[„Terror“ 4278
[„Ilium“ 346
[„Olympos“ 2255
[„Sommer der Nacht“ 2649
[„Im Auge des Winters“ 2956
[„Kinder der Nacht“ 4618
[„Lovedeath“ 2212
[„Die Feuer von Eden“ 1743
[„Das Schlangenhaupt“ 1011
[„Welten und Zeit genug“ 790
[„Endymion – Pforten der Zeit“ 651
[„Fiesta in Havanna“ 359
[„Hardcase“ 789
[„Hard Freeze“ 819
[„Hard as Nails“ 823
Friedman, Michael Jan – Star Trek – Next Generation: Tod im Winter
_Das geschieht:_
Nach dem Tod des Klon-Praetors Shinzon befindet sich das Romulanische Reich in Aufruhr. Lange geknechtete Kolonialwelten nutzen die Gunst der Stunde, um gegen die Zentralgewalt aufzubegehren. Tal’Aura, Shinzons Nachfolgerin, sitzt nicht fest im Sattel. Ihre Kritiker will sie durch besondere Regierungsstrenge in Schach halten. Sie hat deshalb ihre Agentin Sela auf den Eisplaneten Kevratas geschickt. Diese soll jene Rebellen, die sich dort ernsthaft zu organisieren beginnen, ausspionieren, damit sie später durch einen gezielten Angriff vernichtet werden können.
In der Umlaufbahn der Erde wird das Föderationsraumschiff „Enterprise“ gründlich überholt, nachdem es im Kampf gegen Shinzon fast zerstört wurde. Captain Jean-Luc Picard hat die meisten Mitglieder seiner bewährten Crew verloren. Nur Sicherheitschef Worf und Chefingenieur Geordi La Forge blieben an Bord. Selbst Dr. Beverly Crusher, Picards große und heimliche Liebe, mustert ab. Sie wurde von der Föderation auf eine humanitäre Geheimmission geschickt. Ausgerechnet auf dem Planeten Kevratas wütet seit vielen Jahren das „Blutfeuer“, eine tödliche Seuche. Die Romulaner interessiert die hohe Sterberate nicht, sodass die Kevrater die Föderation um Hilfe riefen – ein Affront gegen die Regierung, den die Romulaner nicht dulden.
Als Dr. Crusher auf Kevratas eintrifft, wird sie bereits erwartet. Kurze Zeit später gilt sie auf der Erde als verschollen und wahrscheinlich tot. Die Föderation beauftragt Picard, nach ihr zu suchen. An Bord eines Frachtraumschiffs reist er heimlich nach Kevratos. Begleitet wird Picard von Dr. Greyhorse, einem ehemaligen Kollegen Crushers, denn die Seuche soll weiterhin bekämpft werden. Die Romulaner benötigen wiederum nicht lange, um die Neuankömmlinge zu entdecken. Sie eröffnen die Jagd auf Picard und seine Gefährten, die aber deutlich schwieriger zu überrumpeln sind als Dr. Crusher …
_“Nemesis“ und die Folgen_
Der Beinahe-Zusammenbruch des Romulanischen Reiches wurde nicht nur für dessen ehrgeizigen Praetor Shinzon zur Nemesis. Auch das „Star-Trek“-Franchise stand nach dem gleichnamigen Film von 2002 vor dem Kollaps. Ein simpel gestricktes Drehbuch mit einer wenig originellen Handlung sollte durch einen Overkill an Action und Spezialeffekten kompensiert werden. Das widersprach zu allem Überfluss auch dem Geist der „Next Generation“-Serie, die in ihrem vierten Kino-Abenteuer von Spektakel zu Spektakel, von Charakterbruch zu Charakterbruch & von Logikfehler zu Logikfehler hastete.
Während das Franchise im Bereich Film sieben Jahren benötigte, um nach [„Star Trek – Nemesis“]http://www.powermetal.de/video/review-312.html neu Fuß zu fassen, lief das Geschäft mit den Romanen zur Serie (oder besser: zu den Serien) weiterhin gut. Da „tie-in“-Autoren nicht üppig entlohnt werden und die immensen Kosten eines Filmdrehs entfallen, barg der Plan, die „Next Generation“ zumindest im Buch wieder aufleben zu lassen, nur ein überschaubares finanzielles Risiko, aber viele Möglichkeiten.
Über die Planspiele in diesem Zusammenhang informiert Fun-Fiction-Autor und „Star Trek“-Experte Julian Wangler in einem der beiden Nachworte zur deutschen Ausgabe von „Death in Winter“. Mit diesem Roman begann 2005 der Relaunch, durch den die „NG“-Saga elf Jahre nach dem Ende der TV-Serie quasi eine achte Staffel erhielt; eine Prozedur, die das Franchise zuvor mit der Fortsetzung von „Star Trek – Deep Space Nine“ erfolgreich durchexerziert hatte.
_“And now for something completely different …“_
Im „Star-Trek“-Universum geschieht schon sehr lange nichts mehr ohne sorgfältige Vorplanung. Dass ein Franchise die Überraschung als Risikofaktor hasst, liegt in seiner Natur, die es als profitorientierte Geldmaschine definiert. Trotzdem konnte man nach „Nemesis“ und „Star Trek – Enterprise“ nicht einfach weitermachen wie bisher, da die Fans der alten, eher schlecht als recht über die Jahre gebrachten Muster offensichtlich müde waren.
Also wurde die „Next Generation“ einem behutsamen Lifting unterzogen. Was sich in „Nemesis“ ankündigte, wurde umgesetzt: Die klassische Crew der „Enterprise-E“ hat sich fast vollständig in alle Winde des Weltalls zerstreut. Captain Picard muss zentrale Führungspositionen neu besetzen. Er kämpft mit den Problemen, die ihm der Verlust seiner ‚Familie‘ bereitet. Data ist tot, Commander Riker mit Deanna Troi auf die „Titan“ gewechselt. Nur Worf und Geordie La Forge sind ihm geblieben; sogar Beverly Crusher ist verschwunden.
Die komplizierte, seltsame und weder in der TV-Serie noch in den Kinofilmen jemals geklärte Liebesgeschichte zwischen Picard und Crusher – von Julian Wangler in einem weiteren Nachwort rekonstruiert – ist einer der Fixpunkte von „Tod im Winter“. Zweites Standbein ist die Installation einer neuen ‚Familie‘, mit der Picard auf neue Weltraum-Reisen gehen wird, wobei die individuellen Eigenheiten der ‚Neuen‘ die „Star Trek“-typischen Menscheleien garantieren werden. Die Storyline wird in der „NG“-Gegenwart nach Shinzon verankert, denn selbstverständlich giert der Trekkie nach Neuigkeiten aus der Zukunft.
_“The same procedure as every year …“_
Die werden ihm freilich nur tröpfchenweise verabreicht. Der „NG“-Relaunch weist leider nur zu gut bekannte Mängel auf. Mit „Tod im Winter“ startet eine neue Serie. Dieser erste Band ist vor allem Einleitung. Ständig werden große Neuigkeiten – Revolution auf Romulus! Meuterei in der romulanischen Flotte! Die „Enterprise-E“ wird runderneuert! – angekündigt, die jedoch höchstens ansatzweise umgesetzt werden. „Tod im Winter“ bleibt eine 300-seitige Ouvertüre. Der Leser wird auf kommende Bände vertröstet und mit einem x-beliebigen Planetenabenteuer abgespeist.
Denn Beverly Crushers und Picards Odysseen auf dem Eisplaneten Kevratas bilden simple „Star Trek“-Routine, wie wir sie aus mehr als 170 TV-Episoden kennen. Es wird gefangen, geflüchtet, gerauft & in letzter Sekunde entkommen. Die Kevrater bleiben blass bis nichtssagend, ihr gar grausames Schicksal – Seuche & Romulaner-Knute – lässt kalt. Vor dem geistigen Auge des Lesers erstehen dazu die typischen „Star Trek“-Pappkulissen, die von den üblichen, in exotische Lumpen gekleideten und notdürftig maskierten Statisten bevölkert werden.
Auch die politischen Verwicklungen im Romulanischen Imperium drehen sich im Kreis. Tal’Aura, Sela & Co. benehmen sich so eindimensional brutal und gemein, wie es die Romulaner seit jeher zu tun pflegen. Die dabei zelebrierten S/M-Rituale wirken eher lächerlich als erschreckend. Schon immer projizierte „Star Trek“ leicht verfremdete irdische Moralvorstellungen und Glaubensfragen auf pseudo-exotische ‚Außerirdische‘. In „Tod im Winter“ sind es halt Romulanismen, die ermüdend breitgetreten werden, statt endlich so etwas wie eine Handlung in Gang zu bringen.
_Alte Besen kehren – aber nicht gut_
Wie sollte auch ein echter Neuanfang gelingen, wenn ausgerechnet ein Autor wie Michael Jan Friedman angeheuert wird? Friedman gehört zu den Veteranen des „Star Trek“-Franchises. Er schreibt seit zwei Jahrzehnten Romane zu allen bekannten Serien, außerdem Drehbücher und Scripte für „Star Trek“-Comics. Sein zweifellos profundes Hintergrundwissen ließ er darüber hinaus in diverse „Star Trek“-‚Sachbücher‘ einfließen. Kurz gesagt: Friedman weiß, wie das Franchise-Universum funktioniert.
Das macht ihn keineswegs zu einem besonders guten Schriftsteller. Aus Sicht des Franchises ist das sekundär. Wichtiger ist: Friedman wird schreiben, was weder die strengen Trekkies, denen jedes Detail der Gesamt-Saga geläufig ist, noch die ’normalen‘ Leser vor den Kopf stoßen wird. Zudem liefert er prompt und pünktlich. Originalität und Raffinesse gehören dagegen nicht zu seinem Repertoire. „Tod im Winter“ wimmelt von faulen Tricks, mit denen der Verfasser über die Runden kommen will.
So startet Friedman gleich mit zwei Prologen in die Handlung. Er täuscht damit eine Bedeutsamkeit vor, die sich bei kritischer Lektüre als nichtig erweist bzw. Seiten schinden soll. Super-Agent Manathas bleibt trotz des „San Francisco“-Prologs ein Stereotyp, Beverly Crushers Mission auf Kevratas würde bei ersatzloser Streichung des „Arvada III“-Prologs ebenso funktionieren. Die Gastauftritte von Worf, La Forge und Admiral Janeway sind sinnfreies „name dropping“; die alten Kämpen sollen wenigstens erwähnt werden, um nostalgische Alt-Leser zu locken.
Die Liebesgeschichte zwischen Picard und Crusher ist gleichzeitig steif und an Peinlichkeit schwer zu überbieten. Sie drückt aufs Tempo und erschöpft sich in Allgemeinplätzen. Übel ist das angeflanschte und dieser merkwürdigen Liebe gewidmete Finale, das eine entlarvende Mischung aus Klischee und Gleichgültigkeit darstellt.
_Wie kann & wird das weitergehen?_
Nein, „Tod im Winter“ ist alles andere als ein gelungener Start in eine neue „NG“-Ära. Stattdessen passt sich dieses Garn beunruhigend gut in die endlose Reihe der „Star Trek“-Routine-Romane ein, mit denen der |Heyne|-Verlag um 2000 Schiffbruch erlitt, weil sie niemand mehr lesen wollte. Ungeachtet dessen startet der |Cross Cult|-Verlag, bei dem das Franchise eine neue deutsche Heimat fand, eine regelrechte „Star Trek“-Offensive. Immer neue Reihen werden gestartet, kein Monat vergeht ohne die Veröffentlichung neuer Titel. Sollten diese immerhin schön gestalteten, sauber übersetzten und mit informativen Nachworten ergänzten Romane ihr inhaltliches Niveau nicht deutlich steigern, ist es keine Unkerei, das absehbare Ende auch der neuen „Star Trek“-Offensive anzukündigen.
_Der Autor_
Michael Jan Friedman ist einer jener „prose mechanics“, die für die „tie-in“-Produktion unentbehrlich sind, weil sie schnell und billig Lesefutter liefern können. Vor knapp einem Vierteljahrhundert als ‚richtiger‘ Schriftsteller gestartet, ließ sich Friedman schon Ende der 1980er Jahre für das „Star Trek“-Franchise rekrutieren. Seitdem schreibt er nicht nur für alle bekannten Serien, sondern auch für neue, nur in Buchform erscheinende „Star Trek“-Inkarnationen. Darüber hinaus scriptet Friedman „Star Trek“-Comics, verfasst Drehbücher, ‚Sachbücher‘ zum „ST“-Universum sowie alles, was das Franchise für verkäuflich hält.
Dadurch noch längst nicht ausgelastet, stellt Friedman seine flinke, glatte Feder auch anderen Franchises zur Verfügung. Er hat diverse „Marvel“-Helden und -Schurken von Comic- zu Romanfiguren umgearbeitet oder neue Abenteuer von „Lois & Clark“ erdacht. Die simplen, eingefahrenen, routiniert abgewandelten Handlungsmustern folgenden und durchaus lesbaren Romane sind für den raschen Verbrauch bestimmt, Masse ist wichtiger als Klasse. Damit ist Friedmans Werk übergreifend charakterisiert.
_Impressum_
Originaltitel: Death in Winter (New York : Pocket Books 2005)
Dt. Erstausgabe: September 2009 (Cross-Cult Verlag/Star Trek – The Next Generation 1)
Übersetzung: Stephanie Pannen
Cover: Martin Frei
306 Seiten
EUR 12,80
ISBN-13: 978-3-941248-61-8
http://www.cross-cult.de
http://www.startrekromane.de
_Mehr |Star Trek| auf |Buchwurm.info|:_
[„40 Jahre STAR TREK – Dies sind die Abenteuer …“ 3025
[„Jenseits von Star Trek“ 1643
[„Star Trek – Titan 1: Eine neue Ära“ 5483
[„Star Trek – Vanguard 1: Der Vorbote“ 4867
[„Star Trek Voyager: Endspiel“ 4441
[„Star Trek Deep Space Nine: Neuer Ärger mit den Tribbles“ 4171
[„Star Trek V – Am Rande des Universums“ 1169
[„Star Trek Voyager – Das offizielle Logbuch“ 826
[„Sternendämmerung“ 673
[„Sternennacht“ 688
Asquith, Cynthia (Hg.) – Schrecksekunden. Aus dem Geisterkabinett der Lady Cynthia Asquith
17 Kurzgeschichten sollen eine Momentaufnahme der ‚modernen‘ Phantastik darstellen, wie sie 1952 gesehen wurde:
|Elizabeth Bowen: Vorwort|, S. 7-10
|Rosemary Timberley: Weihnachtliches Zusammentreffen| („Christmas Meeting“), S. 11-14: An besagtem Feiertag trifft eine Frau einen Geist – oder war es umgekehrt …?
|L. A. G. Strong: Danse Macabre| („Danse Macabre“), S. 15-21: Nach dieser Ballnacht an der Seite einer unirdisch schönen Frau entsagt Lebemann Flanagan schlagartig allen Ausschweifungen …
|G. W. Stonier: Aus den Erinnerungen eines Geistes| („The Memoirs of a Ghost“), S. 22-26: Nach dem Tod wird das Leben nicht unbedingt besser, wie uns diese frustrierte Spukgestalt erläutert …
|Nancy Spain: Die Verwirrung der Schlange McKoy| („The Bewilderment of Snake McKoy“), S. 27-40: In seinem Haus lernt der Schriftsteller eine Mieterin kennen, die schon lange auf die Möglichkeit zum Beginn eines neuen Lebens wartet …
|V. S. Pritchett: Don Juans seltsamstes Abenteuer| („A Story of Don Juan“), S. 41-46: Der große Liebhaber wird in eine gespenstische Falle gelockt, wofür er sich auf die ihm eigene Art rächt …
|Walter de la Mare: Schutzgeist| („The Guardian“), S. 47-61: Einem Nachtmahr entspringt eine zarte aber tragische Liebesgeschichte …
|Rose Macaulay: Die Rehabilitierung des Tiberius| („Whitewash“), S. 62-67: Ein römischer Kaiser frönt auch 2000 Jahre nach seinem Tod perversen Spielchen …
|C. H. B. Kitchin: Die Chelsea-Katze| („The Chelsea Cat“), S. 68-89: Es gibt einen guten Grund, wieso Sammler Mallowbourne die erworbene Porzellankatze buchstäblich wie die Pest zu hassen beginnt …
|L. P. Hartley: W. S.| („W. S.“), S. 90-101: Autor Streeter erhält böse Briefe von einem ebensolchen Leser, und aus den Absendern wird deutlich, dass dieser ihm unaufhörlich näher kommt …
|Mary Flitt: Das Amethystkreuz| („The Amethyst Cross“), S. 102-127: Im einsamen Haus am Moor lebt eine alte Gewalttat um Mitternacht bedrohlich wieder auf …
|Eleanor Farjeon: Spooner| („Spooner“), S. 128-140: Wenig hilfreich ist es, wenn nur die Katze weiß, was den alten Freund nach seinem Tod so unruhig umgehen lässt …
|Evelyn Fabyan: Fliegerangriff bei Nacht| („Bombers‘ Night“), S. 141-152: Die tote Gattin kehrt zurück und fordert die am Traualtar geschworene ewige Liebe ein …
|John Connell: Zurück an den Anfang| („Back to the Beginning“), S. 153-160: Auch für einen modernen Teufelspakt muss der Preis schließlich gezahlt werden …
|Collin Brooks: Eigentum bei Fertigstellung| („Possession on Completion“), S. 161-172: Wenn erst ein Gespenst ein Haus heimisch wirken lässt, kann man notfalls eines erschaffen …
|Elizabeth Bowen: Die Hand im Handschuh| („Hand in Glove“), S. 173-185: Die hartherzige Nichte hätte die Kleidertruhe der wunderlichen Tante nicht gar so heftig plündern sollen, denn diese hat dort eine garstige Überraschung hinterlassen …
|Eileen Bigland: Eine ätherische Erscheinung| („The Lass with the Delicat Air“), S. 186-202: Ein hässliches Eifersuchtsdrama nimmt viele Jahre nach dem Tod der Opfer ein versöhnliches Ende …
|Cynthia Asquith: Ein Grab zu wenig| („One Grave Too Few“), S. 203-219: Das neue Haus hat einen alten Makel: Schwangere Bewohnerinnen werden hier nie alt …
_Eine Bestandsaufnahme zeitgenössischen Horrors_
Die Phantastik unterliegt wie alle literarischen Genres bestimmten Moden, die wiederum an gesellschaftliche Entwicklungen gekoppelt sind. Der frühe Grusel gab sich deshalb gern moralisch; Attacken aus dem Jenseits wurden als ‚gerechte‘ Strafen für Verfehlungen im Hier & Jetzt liebevoll ausgemalt, auf dass die Leser daraus (hoffentlich) lernten, sich an Gesetze und Regeln zu halten.
Spätestens der I. Weltkrieg brachte ein Ende solcher Bigotterie; sie starb zwar nicht aus, aber sie wirkte antiquiert in einer Zeit, die ganz andere Quellen des Schreckens offenbart hatte. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts entstand außerdem die Wissenschaft der Psychologie, die sich trotz ihrer Fehler und Anfeindungen behaupten konnte. Die Erforschung des menschlichen Hirns, seiner Funktionen und – für die Phantastik von besonderem Interesse – seiner Fehlfunktionen versetzte der Phantastik einen Energiestoß: Der Schrecken, den bisher pittoreske Gestalten aus dem Totenreich verbreitet hatten, kam nunmehr auf dem Umweg über besagtes Hirn in diese Welt – wenn er nicht sogar ausschließlich dort seinen Ursprung hatte!
Der II. Weltkrieg brachte die Gewissheit, dass der Mensch grundsätzlich keine Gespenster, Vampire oder Werwölfe benötigt, um sich das Leben zur Hölle zu machen; er schafft dies sehr gut allein. Die Geistergeschichte passte sich auch dem an. Sie kappte ihre Wurzeln nicht, aber sie gedieh sehr gut auch im modernen Alltag. Mit „The Second Ghost Book“ wollte (Lady) Cynthia Asquith (1887-1960), selbst Autorin und eine profunde Kennerin der Phantastik, diesen Wandel 1952 belegen. Sie sammelte 20 aktuelle Kurzgeschichten, die den Status der ’neuen‘ Geistergeschichte dokumentieren sollten. Ihr diese Aufgabe zu übertragen, lag nahe, denn Lady Cynthia hatte 1927 herausragende Exempel der klassischen „ghost story“ zu einem ersten „Ghost Book“ zusammengestellt.
_Eine durchwachsene Grusel-Mischung_
Das neue Projekt wurde schon von zeitgenössischen Kritikern nicht durchweg für gelungen gehalten. (Erfolgreich war es allerdings; Lady Cynthia edierte vor ihrem Tod noch ein drittes „Ghost Book“, dann übernahmen andere Herausgeber und führten die Reihe bis 1977 fort; sie umfasst insgesamt – das ist kein Scherz – 13 Bände.) Dafür ist zum einen die schwankende Qualität der aufgenommenen Erzählungen verantwortlich. Die meisten Storys lesen sich unterhaltsam, aber herausragend sind nur wenige. Fatalerweise sind zum anderen viele Geschichten, die sich ausdrücklich ‚modern‘ geben, reichlich misslungen, d. h. langweilig.
Rose Macaulay (1881-1958) setzt auf die Wirkung einer Idee, die nicht so originell ist, wie sie wohl dachte. Walter de la Mare (1873-1956), ein Großmeister der hintergründigen Phantastik, liefert ein ebenso prätentiöses wie lahmes Mini-Drama ab, das bereits die meisten Erstleser nicht berührte, sondern ratlos zurückließ; was sonst von der Literaturkritik gern damit begründet wird, dass besagte Leser dem Künstler intellektuell nicht gewachsen sind, kann hier beim besten Willen nicht geltend gemacht werden. Eleanor Farjeon (1881-1965) stellt mit einer Tiergeister-Mär unter Beweis, wie schlüpfrig der schmale Grat zwischen Rührung und Rührseligkeit ist. Eileen Bigland (1898-1970) und Evelyn Fabyan schlagen (oder stürzen) mit ihren durch den Tod nicht beendeten Liebesdramen in dieselbe Kerbe. Was ‚moderner‘ Grusel sein kann, vermag Collin Brooks (1893-1959) deutlich zu machen. Seine Geschichte vom Jedermann, der dem Wahnsinn verfällt, ist stringent durchkomponiert und verfehlt ihre Wirkung nicht.
Gern endet die ‚moderne‘ Geistergeschichte offen. Der Leser muss sich zusammenreimen, was geschehen ist oder geschehen sein könnte. Nancy Spain (1917-1964) und Leslie Poles Hartley (1895-1972) setzen auf diese Form, doch am besten und gewiss nicht beabsichtigt gelingt ihnen der Beweis, dass man diesen Trick beherrschen muss, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Wie man es besser macht, zeigt Rosemary Timberley (1920-1988) in ihrer nur dreiseitigen Kurzgeschichte.
Interessanterweise wirken vor allem jene Storys gelungen, die sich an die klassischen Vorgaben halten. Clifford Henry Benn Kitchin (1895-1967), Leonard Alfred George Strong (1896-1958) oder Cynthia Asquith selbst legen Geschichten vor, die sehr gut ins erste „Ghost Book“ gepasst hätten. Die ‚alte‘ Geistergeschichte fasziniert offensichtlich trotz ihrer antiquierten Formen zuverlässiger als die betont gegenwärtige Phantastik – und so ist es geblieben, denn die erwähnten Erzählungen stechen auch im 21. Jahrhundert noch positiv hervor. Auch hier kommt es freilich auf das individuelle Talent an: Die an sich sehr stimmungsvolle Gruselmär von Mary Flitt leidet unter ihren Abschweifungen und einem unnötigen Perspektivensprung, der die Unmittelbarkeit des Geschehens negiert.
_Geister können komisch sein_
Schrecken und Humor scheinen einander auf den ersten Blick auszuschließen. Doch das „befreiende Gelächter“ gehört zur Geistergeschichte, die ihre Wirkung durch wohl dosierten Witz erstaunlich erhöhen kann. George Walter Stonier (1903-1985) amüsiert mit dem ungewöhnlichen Blick eines ‚Insiders‘ auf das Jenseits, das hier ebenso schrecklich wie vergnüglich prosaisch erscheint. Victor Sawdon Pritchett (1900-1997) parodiert die klassische Don-Juan-Sage; er bewahrt ihren Duktus und verschneidet sie geschickt mit einer durchaus klassischen Geisterstory, die einen für alle Beteiligten ungewöhnlichen Verlauf nimmt. John Connell interpretiert die alte Geschichte vom Pakt mit dem Teufel formal wie stilistisch nicht nur sehr zeitgemäß, sondern befleißigt sich dabei eines trockenen und sardonischen Humors. Elizabeth Bowen (1899-1973) erzählt eine Geistergeschichte, deren Auflösung wenig schlüssig erscheint. Der Reiz des Erzählten beruht auf einem hinterlistigen Unterton, der das Geschehen wirkungsvoll konterkariert.
Letztendlich erweist sich „Schrecksekunden“ ungeachtet des hehren Anspruchs als Sammlung nur bedingt gelungen. Nach mehr als einem halben Jahrhundert müssen und können die Geschichten für sich selbst bestehen – oder auch nicht. Anthologien sind stets wie Wundertüten: Der Inhalt kann sowohl überraschen als auch enttäuschen. In diesem Fall überwiegen – knapp – die erfreulichen Entdeckungen.
PS: Von wegen „ungekürzte Ausgabe“, wie im Impressum behauptet wird! Es fehlen in der deutschen Fassung drei Storys der Originalausgabe: „Autumn Cricket” (von Lord Dunsany), „Captain Dalgety Returns“ (von Laurence Whistler) und „The Restless Rest-house“ (von Jonathan Curling).
_Impressum_
Originaltitel: The Second Ghost Book (London : J. M. Barrie 1952) bzw. A Book of Modern Ghosts (New York : Charles Scribner’s Sons 1953)
Übersetzung: Jeannie Ebner
Dt. Erstausgabe: April 1973 (Fischer Verlag/TB Nr. 1348)
219 Seiten
ISBN-13: 978-3-596-21348-1
http://www.fischerverlage.de
McCrery, Nigel – Kaltes Gift
_Das geschieht:_
Seit sie als Kind miterleben musste, wie die Großmutter in einem Anfall von Irrsinn ihre Geschwister niedermetzelte, ist Madeleine Poel selbst eine psychisch gestörte Frau, die sich zu einer bemerkenswert erfolgreichen Serienmörderin gemausert hat. Sie tötet nicht, um sich damit zu brüsten, sondern macht sich an alte Frauen ohne Familie und Freunde heran, die sie an ihre Großmutter erinnern, freundet sich mit ihnen an und macht sich ihnen unentbehrlich, während sie ihnen tödliche Pflanzengifte verabreicht, deren Dosis sie ständig steigert. Haben die Opfer ihr alle Vermögenswerte überschrieben, macht Madeleine ein Ende mit ihnen, schlüpft in ihre Identitäten, macht auch Haus und Mobiliar zu Geld und zieht in eine andere Stadt, wo sie ihr tödliches Spiel neu beginnt.
Die Polizei kommt ihr auf die Spur, als nahe Chelmsford in der Grafschaft Essex ein Sportwagen in den Wald rast und dabei eine weibliche Leiche entdeckt wird. Sie wird als Violet Chambers identifiziert, was für arge Verwirrung sorgt, hebt die doch offensichtlich tote Frau immer noch Geld von ihrem Konto ab und schreibt sogar Karten. Detective Chief Inspector Mark Lapslie übernimmt den Fall, obwohl er aufgrund einer exotischen Krankheit, die ihn Geräusche buchstäblich schmecken lässt, gesundheitlich und psychisch stark angeschlagen ist. Zur Seite gestellt wird ihm nur die unerfahrene Emma Bradbury. Schon bald argwöhnt Lapslie, dass man ihnen die Ermittlungen ‚von oben‘ schwermacht. Wichtige Unterlagen werden heimlich kopiert und die Beamten überwacht.
Auf unorthodoxe Weise versucht Lapslie sich Klarheit zu verschaffen und seine Gegner bloßzustellen. Die Zeit drängt, denn in Madeleines Spinnennetz zappelt bereits ein neues Opfer …
_Serienmord britisch unterkühlt_
Nicht nur, aber vor allem seit Hannibal Lecter seine Zähne in diverse (immer kochkundig durchgebratene) Pechvögel schlug, hat sich der Serienkiller zur Inventarfigur des modernen Thrillers gemausert. Es existiert sogar ein eigenes Subgenre, in dem sich absolut durchgeknallte aber merkwürdigerweise trotzdem geniale Meuchelbolde beim Versuch förmlich überschlagen, sich gegenseitig in der Kreation absurder und möglichst geschmackloser Folter- und Mordmethoden auszustechen. Das Ergebnis lässt sich viel zu oft und nicht unerwartet in einem Wort zusammenfassen: lächerlich!
Den ‚echten‘ Serienmörder machen vor allem sorgfältige Planung und Zurückhaltung erfolgreich. Er – oder in unserem Fall sie – hat Methoden entwickelt und verfeinert, die ihn unter dem Radar der Polizei arbeiten lässt. Auch die Mitmenschen werden doppelt getäuscht – als Opfer und als ahnungsloser Hintergrundchor, zwischen dessen Mitgliedern der Killer förmlich verschwindet.
Der eher dem Spektakulären zugeneigte Leser mag dies langweilig finden. In der Tat muss sich ein Schriftsteller mehr Mühe geben, einen ’nur‘ raffinierten Mörder spannend ins literarische Leben zu rufen, als einen irren Primetime-Schlitzer. Wenn dieses Kunststück gelingt, ist die Wirkung freilich nachhaltiger; Nigel McCrery stellt dies mit „Kaltes Gift“ unter Beweis.
_Mord ist k/ein unterhaltsamer Akt_
Dabei spart er nicht an grausigen Details. Madeleine liebt es, ihre Opfer dabei zu beobachten, wie sie sich in Giftqualen winden, und wir Leser sind bei diesen hässlichen Lebensenden dabei. Es fehlen auch nicht die heute so beliebten Seziersaal-Sequenzen, wobei McCrery faulige Leichen detailfroh zu beschreiben weiß. Dabei schreitet er durchaus selbstzweckhaft zur Tat, vermeidet aber jederzeit, Madeleine in eine schäumende Schreckensgestalt zu verwandeln.
Madeleine ist total verrückt, und Madeleine ist eine kranke Frau. Diese Dualität darzustellen, ist schwierig. McCrery gelingt es; immer wieder ertappt sich der Leser dabei, wie er Mitleid mit dieser Frau empfindet und ihr die Daumen drückt, dass der aktuelle Coup gelingt. Das liegt an der perfiden Beiläufigkeit, mit der Madeleine mordet. Sie hat kein schlechtes Gewissen, und sie geht sehr gewissenhaft vor. Noch beeindruckender als ihre Kenntnis floraler Gifte ist ihr Talent zur Mimikry. Sie verschmilzt förmlich mit der Persönlichkeit ihrer Opfer und hat durchaus ihre Probleme damit. McCrery schildert diesen Prozess ungemein eindringlich.
_Mord hat seinen eigenen Geschmack_
Die Madeleine in „Kaltes Gift“ ist eine Serienmörderin im Anfangsstadium des endgültigen geistigen Zerfalls. McCrery zieht eine diesbezügliche Parallele zu ihrem Jäger. Inspector Lapslie ist seinerseits ein Gefangener seines eigenen Gehirns. Es verwandelt ein Geräusch in einen Geschmack – eine Krankheit, gegen die es keine Heilung gibt und die ihr Opfer isoliert. Lapslie hat seine Familie verlassen müssen und droht auch seine Arbeit und damit seinen letzten Halt zu verlieren. Anders als Madeleine findet er einen Weg, sich mit seinem Zustand zu arrangieren.
Allerdings würde die Geschichte auch ohne Lapslies Leiden problemfrei funktionieren. „Kaltes Gift“ profitiert von McCrerys profunder Kenntnis des modernen Polizeialltags; der Autor war selbst viele Jahre Polizist. Leider konnte er der Versuchung nicht widerstehen, seinem Helden ein Handicap aufzuerlegen, das ihn ‚interessanter‘ (und telegener?) machen und seine Persönlichkeit vertiefen soll. So dankbar man dem Verfasser ist, dass er dies nicht versucht, indem er Lapslie und Bradbury (die faktisch kaum eine Rolle spielt) zu einer tragischen Liebesbeziehung zwingt, muss man doch zu dem Schluss kommen, dass die Lapslie-Geschichte, die lange parallel zu, aber unverbunden mit dem Madeleine-Strang verläuft, mit diesem in Sachen Intensität und Überzeugungskraft nicht mithalten kann.
_Alles Böse kommt von oben_
Den eigentlichen Minuspunkt setzt indes dick ein seltsamer Subplot um ministerielle Intrigen, der hinter dem eigentlichen Geschehen herhinkt, bis ihm McCrery kurz vor dem Finale endlich ein Aufholen gestattet. Mit diesem plump gestrickten Komplott scheint der Verfasser jene Prise Gesellschaftskritik über seine Geschichte streuen zu wollen, die ein ‚richtiger‘ Kriminalroman heutzutage mitbringen muss. Die beiläufigen und nie wirklich in die Handlung integrierten Tücken staatlich legitimierter Schlipsschurken schaden dem Roman sehr.
Die Erklärung ist im Grunde einfach: McCrery plante Lapslie als Helden einer neuen Krimi-Serie. Die beschriebenen Beimischungen, zu denen sich noch die Beziehung des Inspectors zu seinem ‚besten Feindfreund‘, einem melancholisch gewitztem Gewaltverbrecher, sowie die aufkeimende Freundschaft zu einer körperbehinderten Pathologin gesellen, sind Investitionen in die Zukunft – Elemente, die in den nächsten Bänden ein seifenoperliches Eigenleben entwickeln werden. Originell ist das nicht, und ob es weiterhin spannend wird, bleibt abzuwarten. Von „Kaltes Gift“ wird dem Leser jedenfalls Madeleines Höllenfahrt im Gedächtnis bleiben – und das zu Recht!
_Der Autor_
Nigel McCrery wurde 1953 in London geboren. In Englands Hauptstadt war er später neun Jahre als Polizeibeamter tätig, was ihm in seiner zweiten Karriere sehr hilfreich war. McCrery studierte in Cambridge und arbeitete dann für die BBC. Dort entwickelte dort die Figur der Gerichtsmedizinerin Dr. Samantha Ryan. Sie fand 1996 ihren Weg ins Fernsehen und wurde dort vor und hinter der Kamera außergewöhnlich sorgfältig und kundig in Szene gesetzt.
Als Serie spielfilmlanger, lose verbundener Episoden, entwickelte sich „Silent Witness“ zum Straßenfeger und wurde (bis 2004) mit Amanda Burton in der Rolle ihres Lebens (und ab 2004 in neuer Besetzung) fortgesetzt. McCrery selbst schloss die Reihe 2003 ab, sodass andere Autoren die Drehbücher verfassten, was aber dem Erfolg keinen Abbruch tat.
Es folgten einige Einzel-Thriller, bis McCrery 2007 eine neue Serie um den beruflich und privat tüchtig gebeutelten Inspector Mark Lepslie startete. Neben diesen Romanen verfasste McCrery eine Reihe von Sachbüchern über polizeiliche und militärische Themen.
Die Mark-Lepslie-Romane von Nigel McCrery:
(2007) Kaltes Gift („Still Waters“)
(2009) „Tooth and Claw“ (noch kein dt. Titel)
Mehr von Nigel McCrery auf |Buchwurm.info|:
[„Denn grün ist der Tod“ 363
[„Die Fremde ohne Gesicht“ 2506
_Impressum_
Originaltitel: Still Waters (London : Quercus 2007/New York : Pantheon Books 2007)
Übersetzung: Ilse Bezzenberger
Deutsche Erstausgabe (gebunden): April 2009 (Droemer Verlag)
378 Seiten
EUR 16,95
ISBN 978-3-426-19791-2
http://www.droemer-knaur.de
Philip Kerr – Das Janus-Projekt [Bernhard Gunther 4]

Philip Kerr – Das Janus-Projekt [Bernhard Gunther 4] weiterlesen
John Connolly – Der Kollektor [Charlie Parker 6]
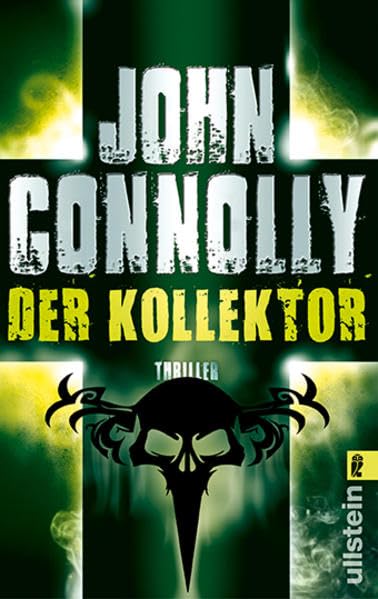
John Connolly – Der Kollektor [Charlie Parker 6] weiterlesen
David Knight – Der Fall 561
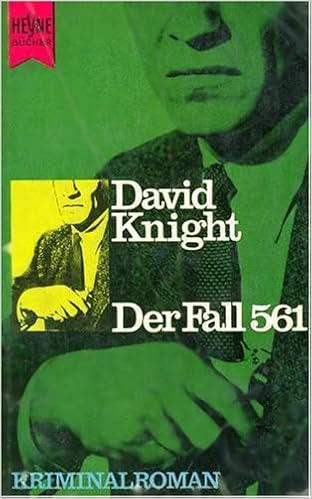
Block, Lawrence – Verluste
_Das geschieht:_
Mit Mickey Francis „Mick“ Ballou verbindet Privatdetektiv Matthew Scudder eine lange, enge und seltsame Freundschaft, denn der irischstämmige Gangsterboss ist ein brutaler Mann, der nicht nur in New York City viele Feinde grausam zu Tode brachte. Doch als Freund ist Ballou jemand, auf den man sich unbedingt verlassen kann, was Scudder schon mehrfach das Leben gerettet hat.
Nun soll er Ballou helfen, nachdem der zwei seiner ‚Angestellten‘ tot in einem Lagerhaus fand, wo sie Diebesgut abholen sollten. Dort wurden sie regelrecht hingerichtet. In der Tat glaubt sich Ballou seit einiger Zeit herausgefordert und bedroht, ohne seinen Gegner namhaft machen zu können. Scudder lässt vergeblich seine Verbindungen spielen. Als er schon aufgeben will, wird er von zwei Strolchen überfallen, bedroht und aufgefordert, Ballou seinem Schicksal zu überlassen. Als sie anfangen, ihn zwecks Festigung dieser Botschaft zu verprügeln, wehrt sich Scudder und kann seinen Peinigern eine Lektion erteilen.
Damit ist auch er auf die Todesliste des unsichtbaren Verfolgers gerutscht. Nur einem Zufall verdankt es Scudder, dass er einem Mordanschlag entkommt, bei dem stattdessen einer seiner ältesten Freunde auf der Strecke bleibt. Einen Tag später besucht er Ballou in dessen Kneipe, als ein Überfall mit Schnellfeuergewehr und Bombe erfolgt.
Obwohl ihm die Polizei im Nacken sitzt, schweigt Scudder eisern, während er seine Nachforschungen neu aufnimmt. Endlich hat er Erfolg, doch der Mann, der buchstäblich Ballous Kopf will, ist definitiv seit über dreißig Jahren tot. Das hält Scudder und Ballou nicht davon ab, privat mit dem scheinbaren Geist abzurechnen …
_Das Gesetz muss draußen bleiben_
Angesichts der Tatsache, dass auf den 300 (immerhin eng bedruckten) Seiten dieses Romans 28 Menschen ihr Leben gewaltsam lassen (falls ich richtig gezählt habe), trifft das originale „Everybody Dies“ den Nagel eher auf (oder die Kugel in) den Kopf als der deutsche Titel. Andererseits passt auch „Verluste“ zu dem gleichzeitig ultrabrutalen und wehmütigen Geschehen.
Der Plot ist eher Nebensache; primär der kritische und im Krimi die gespiegelte Realität suchende Leser sollte ihn nicht zu ernst nehmen. Eine Fehde dürfte sich nicht nur angesichts der erwähnten Opferstrecke kaum so problemlos und vor allem polizeifrei durchexerzieren lassen wie von Block geschildert. Gerade zwei Szenen widmet der Verfasser der genretypischen Konfrontation zwischen dem Detektiv und den offiziellen Ordnungshütern, doch das wirkt eher pflichtschuldig und bleibt folgenlos für die Handlung.
Die spielt in jener Grauzone, in die Autor Block die Alltagswelt seines dienstältesten Serienhelden im Laufe der Jahre verwandelt hat. Scudder begann 1976 in „The Sins of the Fathers“; dt. „Mord unter vier Augen“) noch recht konventionell zu ermitteln. Der Ex-Cop, der nach einem fatalen Fehlschuss zu saufen begann, war in seiner menschlichen Schwäche bei unvermindert ausgeprägten kriminologischen Fähigkeiten durchaus eine Klischeefigur des Krimi-Genres. Diese Ebene verließ Scudder erst allmählich, oder besser ausgedrückt: Die Figur wurde im Denken und Handeln vielschichtiger.
_Die menschliche Meta-Ebene_
Wobei Block vor allem in moralischer Hinsicht konsequent einen Sonderweg eingeschlagen hat. Scudder ist ein Mann, der sich vom ethischen Primat der gesellschaftlichen Mehrheit abgekoppelt hat und sich an Regeln hält, deren Alltagstauglichkeit er real erfahren und überprüft hat. Stimmen diese Regeln mit dem geschriebenen oder ungeschriebenen Gesetz nicht überein, werden sie von ihm nur insoweit berücksichtigt, dass ihn die Missachtung nicht ins Gefängnis bringt.
Was eigentlich einen kriminellen Opportunisten auszeichnen müsste, wirkt bei Scudder durchaus überzeugend. Er hat das Gesetz für sich von allen politisch, juristisch oder medial verursachten Überwucherungen befreit und auf ein erprobtes Grundwerk zurückgebaut, das Selbstjustiz, Notwehr ohne polizeiliche Überprüfung oder die Freundschaft zu einem Kapitalverbrecher zulässt.
Womit die Liste der Gesetzesverstöße, derer sich Scudder allein in „Verluste“ schuldig macht, noch längst nicht abgeschlossen ist. Dem muss man sich als Leser beugen oder die Lektüre aufgeben. Leicht wird das aber nicht fallen, denn Scudder hat gute Gründe, um seinen persönlichen Weg zu begründen. Dass man darüber hinaus seine sehr brutalen Racheaktionen billigt, liegt daran, dass es stets nur echten Abschaum erwischt. Das funktioniert mit dieser Präzision nur im Roman und verärgert hier den Gutmenschen, an dessen Adresse sich Blocks Scudder-Geschichten sehr offensichtlich nicht richten.
_Das Alter als Summe von Entscheidungen_
Er mag sich versöhnlich gestimmt fühlen, wenn er zur Kenntnis nehmen kann, wie breit der Raum ist, den Block seinen Protagonisten zum Philosophieren (und Räsonieren) lässt. „Verluste“ ist der 14. Roman der Scudder-Serie. Seinen Detektiv lässt der Autor chronologisch altern, so dass Scudder in diesem 1998 veröffentlichten Buch auf eine mehr als drei Jahrzehnte währende ‚Literaturgeschichte‘ zurückblickt. Da New York City sein permanenter Standort blieb, wird jede Fahrt durch diese Stadt per se zu einer Erinnerungstour.
Das Alter spielt eine katalytische Rolle. Viele Figuren gehören zum Stammpersonal der Scudder-Serie. Sie haben viel und oft gemeinsam durchgemacht, was tiefe Spuren hinterlassen hat. Scudder selbst spürt, dass seine Kräfte nachlassen. Den Anschluss an die digitale Welt der Gegenwart hat er hoffnungslos verloren. In seiner Arbeit hält er sich an eine klassische und zeitlose Ermittlungspraxis, für die er nicht unbedingt einen Computer oder ein Handy benötigt. Wenn das nicht mehr reicht, greift Scudder auf ein kleines aber bewährtes Netzwerk von Helfern zurück.
Wenn das Ende näher rückt, beginnt der Mensch sich zu fragen, was er aus seinem Leben gemacht hat. Nicht nur Scudder denkt so. Mehrfach weist er darauf hin, dass „Verluste“ eigentlich Mick Ballous Geschichte erzählt. Der alternde Schwerverbrecher wird von besagter Frage gequält, weil ihm die Antworten nicht gefallen. Für eine Weile zieht er sich sogar in ein Kloster zurück, aber Block ist kein Gartenzwerg-Moralist: Ballou ist und bleibt Ballou. Ebenso geläutert wie notfalls mordlüstern kehrt er in die Geschichte zurück.
_Schweigen wäre manchmal wirklich Gold!_
Lakonie und Redseligkeit sind zwei Eigenschaften, die nicht nur auf den ersten Blick schwer zusammenkommen. Fast gelingt Block dieses Kunststück, wenn er seine Figuren ausgiebig über ihre Gefühle sprechen lässt, ohne sie dadurch der Lächerlichkeit preiszugeben. (Anmerkung: Nicht die Gefühle sind dabei das Problem, sondern das schauerlich oft fehlende Talent von Schriftstellern, diese adäquat zu schildern.) Ballou und Scudder erschießen Strolche, ohne zu fackeln, Gattin Elaine gestattet ihrem Matthew das Fremdgehen – oh ja, sie sind alle erfahren und weise und cool genug, um sich über die Klippensprünge ihrer Leben auslassen zu können.
Der Kritik gefällt so etwas, denn es verleiht dem Krimi ‚literarische‘ Qualitäten, die er zwar nicht nötig hat, die ihn aber offenbar trotzdem adeln, wenn sie denn gefunden werden. Wahrscheinlich schreibt Block ohnehin, wie und was er für richtig hält. Unabhängig davon hätte er die Flut der Lebensbeichten eindämmen sollen. Es irritiert, wie rasch man lernt, während des Lesens das Nahen jener Stellen zu erkennen, an denen Block den Gang herausnimmt und seine Figuren im Leerlauf schwadronieren lässt.
Angesichts der Generalqualitäten dieses Buches ist das freilich eine lässliche Sünde. Mit seiner Scudder-Serie hat Lawrence Block als Schriftsteller einen Punkt erreicht, an dem er seinem Publikum zuverlässig Lesestoff einer Qualität liefert, die anscheinend zu gut für die Buchfabriken und Bestsellerlisten dieser Welt ist. Peinlich viele Jahre wurden nicht nur die Scudder-Romane nicht mehr in Deutschland verlegt. Die bunte Welt der Kleinverlage ermöglicht nun Blocks Rückkehr. Zwei weitere Scudder-Bücher hat der Autor nach „Verluste“ noch geschrieben. Genügt diese Info als Wink mit dem Zaunpfahl?
_Der Autor_
Lawrence Block, geboren am 24. Juni 1938 in Buffalo (US-Staat New York) gehört zu den Schriftstellern, die nicht zwischen „Literatur“ und „Krimi“ unterscheiden und trotzdem – oder gerade deshalb – ein Werk von bemerkenswert konstanter Qualität vorlegen. Das ist umso erstaunlicher, als Block ein ungemein fleißiger Autor ist und Kunst und Quantität sich angeblich ausschließen.
Noch während seines Studiums veröffentlichte Block 1957 erste Kurzgeschichten. Ab 1959 arbeitete er u. a. Kolumnist und sichtete für einen Verlag eingehende Manuskripte, bevor er freier Schriftsteller wurde. In einem halben Jahrhundert entstanden mehr als 50 Romane und 100 Kurzgeschichten. Block schrieb unter Pseudonymen wie Jill Emerson, Chip Harrison, Paul Kavanagh oder Sheldon Lord und schuf bisher fünf Serien, unter denen die um den Regierungsagenten Evan Tanner (1966-1998), den auf Kunstraub spezialisierten Dieb und unfreiwilligen Privatdetektiv Bernie Rhodenbarr (ab 1977) und vor allem die um den Privatdetektiv und Alkoholiker Matthew Scudder (ab 1976) feste Bestandteile der Kriminalliteratur sind.
Für seine Arbeit wurde Block mit allen wichtigen Preisen ausgezeichnet. Neben seinen Kriminalromanen verfasst er auch Softpornos, Artikel und Sachbücher (u. a. über das Schreiben) und hat das Drehbuch zum Tobe-Hooper-Splatter „The Funhouse“ (1981, dt. „Kabinett des Schreckens“) geschrieben.
Über seine Arbeit informiert Lawrence Block auf der ausgezeichneten Website: http://www.lawrenceblock.com.
_Impressum_
Originaltitel: Everybody Dies (New York : William Morrow & Co. 1998/London : Orion 1998)
Dt. Erstausgabe: Februar 2008 (Shayol Verlag/Funny Crimes 3906)
Übersetzung: Katrin Mrgulla
296 Seiten
EUR 14,90
ISBN-13: 978-3-926126-75-7
http://www.shayol.biz
_Mehr von Lawrence Block auf |Buchwurm.info|:_
[„Abzocker“ 5378 (Hörbuch: Hard Case Crime)
[„Falsches Herz“ 5707
Coney, Michael – Träume von Pallahaxi
_Das geschieht:_
Erstes Buch: „Der Sommer geht“ (S. 9-258): Der Planet der Stilk umkreist die Sonne Phu und beschert seinen menschenähnlichen Bewohnern ein mildes Klima. Den Umgang mit der Kälte beherrschen die Stilk nicht; sie ist zu einem gefürchteten Phänomen geworden.
Seit Jahren führen Erto und Asta, die beiden Großmächte des Planeten, erbittert Krieg. Noch wissen nur die Regierungen vom bevorstehenden Verhängnis: Phu bildet mit ihrem Riesenplaneten Rax ein komplexes Binärsystem. Kommen die beiden sich zu nahe, kann es geschehen, dass Rax der Sonne den Planeten der Stilk quasi entreißt und mit sich nimmt. Die Umlaufbahn von Rax ist überwiegend sonnenfern, sodass dieses Ereignis, dass nun wieder einmal bevorsteht, dem unfreiwilligen Begleiter einen vierzigjährigen Winter beschert.
Der hohe Regierungsbeamte Burt tritt mit seiner Familie den jährlichen Sommerurlaub in der Hafenstadt Pallahaxi an. Sohn Druv steckt tief in der Pubertät und rebelliert permanent gegen die konservativen und auf ihre gesellschaftliche Stellung pochenden Eltern. In Pallahaxi erneuert Druv die Freundschaft zur schönen Gastwirtstochter Braunauge und gerät zwischen die Fronten einer Rebellion empörter Bürger, die sich von ihrer Regierung verraten & verkauft fühlen …
Zweites Buch: „Erinnerungen an Pallahaxi“ (S. 259-607): Der lange Winter ist nur noch sagenhafte Vergangenheit. Vor acht Generationen haben Besucher von der Erde den Planeten der Stilk entdeckt. 600 Menschen ließen sich in Devon-Station nieder. Als ihr Vertreter fungiert Mr. McNeil, der außerdem versucht, zwischen den beiden nur mühsam Frieden haltenden Städten Yam und Noss zu vermitteln.
Hardy ist der Neffe des Yam-Hauptmanns Borst, den aktuell große Ernteausfälle beunruhigen. Sogar in Noss musste man vorstellig werden, um Fisch zu kaufen; eine Aufgabe, die Borst klugerweise seinem diplomatisch deutlich begabteren Bruder Bruno überließ. Hardy begleitet ihn und verliebt sich in Noss prompt in Talis, die Tochter der Hauptfrau.
Als Bruno einem Mord zum Opfer fällt und Hardy schwere Vorwürfe erhebt, muss er Noss und Talis verlassen. In Yam werden mehrere Anschläge auf Hardy verübt. Nur knapp kommt er mit dem Leben davon. Er entkommt nach Noss, wo man ihm Asyl gewährt. Hardy beginnt in eigener Sache zu ermitteln. Er kommt einer uralten Intrige auf die Spur und löst außerdem das Rätsel der mysteriösen Lorin, die mit den Stilk den Planeten bewohnen …
_Fremde Welt mit bekannten Fehlern_
„Träume von Pallahaxi“ vereint zwei Romane des britischen Schriftstellers Michael G. Coney. Sie ranken sich um ein exotisches Sonnensystem, dessen intelligente Bewohner vom Verfasser nach menschlichem Vorbild geformt wurden. Die Stilk haben sich ‚ihren‘ Planeten untertan gemacht und könnten ein geruhsames Leben führen. Stattdessen pflegt man interne Querelen. Obwohl der Grund nur den jeweiligen Führungsspitzen bekannt ist, liegen im ersten Band die beiden Machtblöcke Erto und Asta, in der Fortsetzung die Städte Noss und Yam im Streit. Die Gesellschaft des Planeten ist streng hierarchisch strukturiert. Die ‚höheren‘ Klassen achten auf ihre Privilegien, während der sprichwörtliche ‚kleine Mann‘ zu spuren hat, wobei kriegsbedingt vorgeschobene Zwangsmaßnahmen hilfreich sind.
In diese mit sich selbst beschäftigte Welt platzt die Bombe einer seltenen Naturerscheinung. Die Stilk könnten sich anpassen, aber die Mächtigen sorgen sich stattdessen ängstlich um ihre Vorrechte. Nur die Jugend ist, sofern noch nicht im Räderwerk des Establishments gefangen, willens und in der Lage, den radikalen Weg zu gehen, der ein Überleben des 40-jährigen Winters ermöglicht.
_Stilk am Scheideweg_
„Der Sommer geht“ beschreibt einen Kampf zwischen Widerstand und Anpassung. Michael Coney gibt ihm Gesichter; auf der einen Seite sind die Konservativen wie Burt und Fayer, Druvs Eltern, aber auch Wolff, als Repräsentant einer schon indoktrinierten Folgegeneration. Ihnen stehen Druv und Braunauge gegenüber, die das System zunehmend kritisch betrachten, seine Schwachstellen erkennen und notwendigen Veränderungen gegenüber aufgeschlossen sind.
Vor allem Druv muss sich entscheiden und seinen eigenen Weg finden, was „Der Sommer geht“ zu einem Science-Fiction-Entwicklungsroman macht. Als prominentester Schriftsteller dieses Subgenres galt lange Robert A. Heinlein (1908-1988), der zahlreiche SF-Romane schrieb, in denen Jugendliche das Abenteuer Leben zu meistern begannen und in mindestens eine dramaturgisch geschickt arrangierte Krise gerieten, in der sie anwenden mussten, was sie gelernt hatten.
Heinlein (aber nicht nur er) schilderte diesen Prozess als Fluss von Erfahrungen, der von den Älteren auf die Jüngeren überging. Diese Jugend war – den zeitgenössischen Systemstrukturen der 1940er und 50er Jahre entsprechend – formbar bis unkritisch unterwürfig, diszipliniert und bienenfleißig bzw. in allen Details das gespiegelte Idealbild der (konservativen) Elterngeneration. Widerspruch war möglich, stellte sich jedoch stets als Fehler heraus, da die Alten tatsächlich alles besser wussten.
_Nach rechts oder nach links?_
Coney steht für jenen Aufbruch, der in den späten 1960er und 70er Jahren diese Vormacht sowie ihre Vertreter in Frage stellte. Auch oder gerade der junge Bürger ließ sich nicht mehr alles als Notwendigkeit diktieren, sondern hinterfragte Entscheidungen und leistete ihnen notfalls keine Folge. Die alten Methoden griffen ohnehin nicht mehr, aber Gewalt und Willkür sollten sie trotzdem konservieren. Das misslang, und für eine Weile schien ein Neuanfang möglich. Zwar ging die Geschichte über diese ‚Tauperiode‘ hinweg, doch konnten ‚Real-Politiker‘ und Global-Konzerne (bisher) nicht alle Errungenschaften dieser Ära wieder abschaffen.
In diesem Zeitfenster entstand „Der Sommer geht“. Der Umbruch auf dem Planeten der Stilk orientiert sich an den realen Unruhen der 1970er Jahre. Coney transponierte die irdischen Parteien und ihre Argumente in eine SF-Handlung. Obwohl er dabei keine Seite von Kritik aussparte, ist doch klar, für wen sein Herz schlägt.
Die Charakterisierung gerät klar aber simpel – zu simpel womöglich, denn Figuren wie Druvs Vater Burt oder vor allem Mutter Fayer sind Karikaturen. Sie stehen für das starre bzw. dumme und insgesamt ungerechte Establishment. Umgekehrt sind auch die ‚Guten‘ auf ihre Weise überzeichnet. Ausgerechnet hier tradiert Coney das Konzept des Jugendromans, der ‚einfach‘ strukturiert sein soll, weil seine Leser die Subtilität einer nicht schwarzweißen, sondern grauen Welt angeblich noch nicht begreifen.
Für besonderes Augenverdrehen sorgt dabei das scheue Aufkeimen der ersten Liebe; was im (wie üblich mit Vorsicht zu genießenden) Covertext als „bezaubernde Liebesgeschichte“ hochgejubelt wird, ist albern mit einschlägigen Klischees durchsetzt, bevor Coney zumindest in „Der Sommer geht“ mit einem unerwarteten Finale zwischen bittersüßer Tragödie und beißender Ironie überrascht.
_Vom Abenteuer zur Routine_
Mehr als drei Jahrzehnte nach „Der Sommer geht“ wirkt Coney in „Erinnerungen an Pallahaxi“ müde. Die Sozialkritik schimmert zwar noch durch, aber die Rückkehr auf die Welt der Stilk ist vor allem ein farbenfrohes Planetenabenteuer, das die grundsätzliche Plot-Konstellation des Vorgängerbandes aufgreift bzw. ein wenig zu offensichtlich imitiert. Wie nicht nur in der Sciencefiction heute üblich, geht der Verfasser vor allem in die Breite. Coney lässt sich Zeit, seinen Lesern den Planeten der Stilk vorzustellen – noch einmal. Dessen Gesellschaftsstruktur hat sich nur scheinbar verändert. Die bekannten Konfliktherde prasseln munter weiter. Erneut haben jene, die es eigentlich nicht verdienen, das Sagen. Sie werden als Widerlinge, Feiglinge und Dummköpfe inszeniert, doch der warnende Unterton ist verschwunden. Der grobe Borst ist beispielsweise ebenso eine Witzfigur wie die zänkischen Hauptfrauen (oder besser Weiber) Lonessa oder Wanda.
Zwischen allen Stühlen stehen wieder junge Menschen. Hardy und Talis sind recht profilarme Inkarnationen von Druv und Braunauge sowie mit vergleichbar holzköpfigen Eltern und anderen Autoritätspersonen geschlagen. Einzig Yams Vater Bruno gibt den gealterten Idealisten, der sich wider besseres Wissen in den Dienst der Tradition stellt und (dafür) ein schlimmes Ende nimmt.
_Eine neue Partei im Planetenspiel_
Als quasi übergeordnete Instanz haben sich inzwischen die Menschen auf Stilks Planet etabliert. In Coneys Entwurf einer möglichen Zukunft sind sie Repräsentanten einer Art Föderation, deren (auch nichtmenschliche) Mitglieder auf der Suche nach Wissen und Bodenschätzen durch das All reisen. Treffen sie dabei auf intelligente, aber technisch ‚unterentwickelte‘ Planetenbewohner, nehmen die Menschen zwar Kontakt mit ihnen auf, halten sich dabei jedoch an eine Nichteinmischungs-Klausel, die eine Weitergabe von Hightech aber auch Nothilfe verbietet.
Die Menschen sind freilich keineswegs aus Erfahrung klug geworden. Zwar enthalten sie ihren ‚Gastgebern‘ jene Supertechnik, die ohne das Wissen um eventuell mit dem Einsatz verbundene Nachteile die Stilk ins Verderben stürzen könnte, umsichtig vor. Doch als die ‚kanalisierte‘ Ausbeutung ins Stocken gerät, soll das Problem mit Gewalt gelöst werden.
Dieser Subplot gehört zu den Hauptschwächen der ohnehin recht orientierungslos zwischen Abenteuer, Liebesgeschichte und Krimi mäandrierenden Story. Die düsteren Beweggründe der Menschen sind aufgesetzt und können nicht überzeugen. Später lösen sie sich in Luft auf bzw. werden vom Verfasser mit einem Nebensatz abgetan. Offensichtlich möchte Coney unbedingt für Tempo und Dramatik sorgen, als das Finale naht. Man kann ihn verstehen, denn die bisher aufgeworfenen und gelösten Rätsel konnten den Leser nicht in atemloses Staunen versetzen. Obwohl viel gereist, verfolgt und intrigiert wird, fehlt dem Geschehen echte Spannung.
Letztlich bringt vor allem die Neuauflage von „Der Sommer geht“ dem Leser Freude. „Erinnerungen an Pallahaxi“ zeigt den ’späten‘ Coney, der den Biss früherer Werke vermissen lässt. Dafür mag sein Gesundheitszustand mitverantwortlich sein. „I Remember Pallahaxi“ gehört zu den letzten, im Buch zu Coneys Lebzeiten nicht mehr veröffentlichten Romanen; der sterbenskranke Autor stellte sie im Wissen um den nahen Tod auf seine Website. Coney hat noch immer sein Talent zur Schilderung fremdartiger Ökosysteme, die er mit erstaunlichen Kreaturen bevölkert. Das nützt jedoch wenig, wenn in diesen Kulissen nichts wirklich Spannendes geschieht. Deshalb überwiegt die Enttäuschung über diesen Doppelband, der in seinem zweiten Teil nur aufwärmt, was im Auftakt noch heiß war.
_Der Autor_
Michael Greatrex Coney wurde am 28. September 1932 im englischen Birmingham geboren. Nach der Schule wurde er Wirtschaftsprüfer; ein Beruf, in dem er herzlich unglücklich war. Er versuchte sich deshalb später u. a. als Manager eines Campingplatzes und arbeitete für eine Brauerei. 1969 verließ Coney, inzwischen verheiratet und Vater einer Tochter, England. Die Familie siedelte sich auf Antigua, eine der Westindischen Inseln, an, wo Coney ein Hotel leitete.
Ebenfalls 1969 erschien eine erste SF-Story im britischen Magazin „Vision of Tomorrow“; weitere Kurzgeschichten folgten und wurden auch in den USA gedruckt. Der Durchbruch gelang Coney jedoch erst als Verfasser von Romanen, die spannende Plots mit exzellenten Beschreibungen fremdartiger Welten verbanden sowie eine intensive aber unaufdringliche Prise Sozialkritik beinhalteten. „Mirror Image“ (1972, dt. „Planet der Angst“), „Winter’s Children“ (1974, dt. „Eiskinder“) und vor allem „Hello Summer, Goodbye“ (1975, dt. „Der Sommer geht“) fanden sowohl den Beifall des Publikums als auch der Kritikerschaft.
1972 verließen die Coneys Antigua und zogen nach Kanada um. Auf Vancouver Island nahm Coney einen Job im Finanzwesen der Forstverwaltung an, den er bis zu seiner Pensionierung Ende der 1980er Jahre ausübte und der ihm die Zeit für weitere Bücher und Storys ließ. Nach Ansicht der Kritik lässt der ‚kanadische Coney‘ die Originalität der frühen Jahre vermissen. Ein letzter Erfolg wurde 1976 „Brontomek!“ (1976, dt. „Brontomek!“), für den Coney 1977 mit einem „British Science Fiction Association Award“ ausgezeichnet wurde. In den 1990er Jahren schrieb er verstärkt und erfolgreich Sachbücher über lokalhistorische Themen.
Coney erkrankte um die Jahrtausendwende an einer Asbestose, die zum Lungenkrebs führte. Als klar wurde, dass er der Krankheit erliegen würde, stellte Coney vier noch unveröffentlichte Bücher ins Internet, wo sie frei verfügbar waren. Michael Coney starb am 4. November 2005 in British Columbia.
_Impressum_
Originaltitel: Hello Summer, Goodbye (London : Victor Gollancz 1975) u. I Remember Pallahaxi (Hornsea : PS Publishing 2007)
Deutsche Erstveröffentlichung dieser Gesamtausgabe: Oktober 2009 (Wilhelm Heyne Verlag/TB Nr. 52543)
Übersetzung: Bernhard Kempen
Cover: Lee Gibbons (Karten: Iris Daub)
607 Seiten
EUR 9,95
ISBN 13: 978-3-453-52543-6
http://www.heyne.de
del Toro, Guillermo / Hogan, Chuck – Saat, Die
_Das geschieht:_
Auf dem John-F.-Kennedy-Flughafen in New York landet ein Passagierflugzeug. In seinem Inneren findet man mehr als 200 blutleere Leichen und vier desorientierte Überlebende, die keine Ahnung haben, wie ihnen wann geschah. Die US-Seuchenbehörde alarmiert ihre „Canary“-Truppe, die das Flugzeug und seinen Inhalt penibel auf mögliche Giftspuren untersuchen soll; im Jahr acht nach 9/11 liegt in den USA die Vermutung einer raffinierten Terroristen-Attacke nahe.
„Canary“-Leiter Ephraim Goodweather und sein Team stellen im Rumpf der Maschine nur eine Abweichung vom Normalzustand fest: Dort steht ein uralter, mit Erde gefüllter Sarg, der kurz darauf spurlos verschwindet. Während der Leser längst seine Schlüsse gezogen hat, herrscht in den Köpfen der Ermittler weiterhin Leere. Erst Abraham Setrakian, ein alter rumänischer Pfandleiher und Wissenschaftler, bringt Goodweather und Co. auf die richtige Spur. Als junger Mann wurde er in ein Konzentrationslager verschleppt, dessen Insassen tagsüber von den Nazis ermordet und nachts von einem Vampir heimgesucht wurden. Setrakian hat dessen Attacken einst überlebt und ist ihm viele Jahre heimlich gefolgt. Nach seiner Emigration in die USA wartet er auf die Wiederkehr des Ungeheuers, um ihm endlich den Garaus zu machen.
Die Ankunft des Vampirs verdankt die noch ahnungslose Menschheit dem ebenso milliardenschweren wie kranken Konzern-Magnaten und Theologen Eldritch Palmer, der so sehr an seinem Leben und seiner Macht hängt, dass er sogar einen Pakt mit dem Teufel eingegangen ist: Der Biss des Vampirs verheißt Gesundung, Unsterblichkeit und übermenschliche Kräfte. Allerdings unterschätzt Palmer die Dankbarkeit seines ‚Gastes‘, der eigene Pläne hat, die sich um die Weltherrschaft drehen. In schmaler Besetzung bemühen sich Goodweather und Co., den „Meister“ zu stoppen, während in den Straßen von New York dessen Saat für Angst und Mord zu sorgen beginnt …
_Breitgetretener Grusel-Quark_
Existiert der Begriff „Event-Bestseller“ eigentlich schon? Falls nicht, habe ich ihn hiermit erfunden und werde ihn umgehend mit Leben füllen; Leben, das diesem seltsamen ‚Roman‘ weitgehend abgeht. Wo beginnt man, wenn man Scheitern einerseits und Enttäuschung andererseits in Worte fassen möchte? Noch stärker als in der modernen Buchindustrie ohnehin üblich, wirkt nebensächlich, was zwischen die Einbanddeckel gebunden wurde. Viel Energie wird stattdessen eingesetzt, um „Die Saat“ multimedial und möglichst werbewirksam zum Ereignis aufzubauschen. Es gibt sogar einen Videoclip zum Buch, der einen Kinofilm anzukündigen scheint.
Das ist nicht unbedingt abwegig, denn „Die Saat“ gilt als geistiges Kind von Guillermo del Toro, der zweifellos ein begnadeter Filmemacher ist. „Cronos“ (1993), „Hellboy“ (2004 u. 2008), „Pans Labyrinth“ (2006) und bald „Der Hobbit“ sind nur die Höhepunkte einer Liste phantastischer Kinowerke. Aber wie stark war und ist del Toro in das „Saat“-Projekt faktisch involviert? Hat er – der Verdacht liegt nahe – nur die „Idee“ gehabt und in groben Zügen entwickelt, worauf ein Lohnschreiber dem vielbeschäftigten Meister zur Seite sprang und das eigentliche Formulieren übernahm? Dass del Toros Name deutlich größer auf dem Titel prangt als „Chuck Hogan“, spricht keineswegs dagegen; del Toro trägt nun einmal den prominenteren und damit kundenlockenden Namen.
_Aus Friedhofserde wird Bockmist_
Ausgerechnet Vampire! Man spricht diese beiden Worte mit einem Stöhnen aus. Die Blutsauger treten sich längst gegenseitig auf die Totenhemden. Vor allem seit sie zur Projektionsfigur für pubertäre Mädchen degenerierten, suchen die Untoten die Unterhaltungsmedien dieser Welt inflationär heim. Immer neue Trittbrettfahrer springen auf diesen Zug auf und versuchen, mit minimalem Erzähltalent ihr Publikum maximal auszubeuten. Schwülstige Lovestory und stumpfer Metzel-Horror bilden die Enden dieser Vermarktungskerze, die an beiden Enden kräftig brennt.
Von einem Mann wie Guillermo del Toro hätte man neue Impulse in Sachen Vampir-Horror erwartet. Stattdessen drischt er nur Stroh. „Die Saat“ bietet keine echte Idee, sondern präsentiert ausschließlich Bekanntes, Bewährtes und Ausgelaugtes im Gewand einer Hit-&-Run-Story. Wer während der Lektüre echte Unterhaltung sucht, mache sich den Spaß, die gerade gelesenen Passagen Szenen aus Filmen zuzuordnen, von denen sie ‚inspiriert‘ wurden. (Keine Sorge, dies ist möglich, ohne dass darüber der rote Faden der Geschichte verloren ginge.)
Dreist proklamiert das Autorenduo die Alleinherrschaft des Klischees. Was eigentlich schon nach wenigen Buchseiten eindeutig ist, wird als Geheimnis förmlich zelebriert. Endlos lassen del Toro und Hogan ihre offenbar zum Wohle der Handlung lobotomisierten ‚Helden‘ über die ‚Rätsel‘ eines mit Erde gefüllten Sarges oder blutleer gesaugte Menschen spekulieren. Verdammt noch einmal – jedes Kind weiß, dass hier Vampire ihr Unwesen treiben! Um das spannungsförderlich zu verschleiern, müssten die Autoren deutlich raffinierter vorgehen.
_Tempo, Tempo, damit niemand einschläft!_
War „Die Saat“ ursprünglich als Drehbuch geplant? Der ‚Roman‘ zerfällt in unzählige Kapitel und Kapitelchen, die einen hektisch geschnittenen, ’schnellen‘ Film vor- und widerspiegeln. Vielleicht ist das gut so; hat der Leser nach wenigen Zeilen begriffen, dass ihm ein weiteres vorgestanztes Ereignismodul vorgesetzt wird und er daraufhin einzunicken droht, wird er zur nächsten ‚Sensation‘ gerissen.
Paradoxerweise tritt die Handlung trotz ständiger Ortswechsel auf der Stelle. An sich klar verständliche Szenen werden erneut ins schier Unendliche gedehnt. Schon die Bergung der scheintoten Flugzeug-Passagiere beansprucht beinahe ein Buchdrittel. Technobabbel soll Realitätsnähe suggerieren. Noch das kleinste und unwichtigste Detail wird exzessiv beschrieben. Vermutlich kann der Leser nach der „Saat“-Lektüre mit geschlossenen Augen ein Flugzeug der Marke Boeing 777 auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Später wird der Vampirismus als virale Mutation ‚wissenschaftlich‘ erklärt, was die Story weder fordert noch ihr hilft.
Als die ’neuen‘ Vampire dann durch die Straßen von New York stürmen, lassen die Autoren ihnen immer wieder neue Bürger ahnungslos vor die Fänge laufen. Dass die Blutsauger gefährlich sind, haben wir spätestens nach der zweiten oder dritten Metzelei verstanden. Folglich ist es unnötig bis kontraproduktiv, uns mit Blutbad vier bis zehn zu langweilen, statt endlich die eigentliche Handlung voranzutreiben!
_Hohle Helden für ein grobes Buch_
Dem dürren Handlungsfaden entsprechend fällt die Figurenzeichnung so flach aus, dass der Mediziner wahrscheinlich von einer Flatline spräche. Ernsthaft fragt man sich, ob ein Name wie „Ephraim Goodweather“ Ironie andeuten soll. Da die Handlung generell unter ihrem Bierernst zusammenzubrechen droht, ist davon nicht auszugehen. Die nicht mit der Schreibfeder, sondern wie mit dem Maschinengewehr zum Einsatz gebrachten Klischees bestätigen die unguten Vermutungen. Ephraim ist ein zerstreutes Genie und viel zu nett für diese grobe Welt. Das zielt primär gegen seinen der Politik und den Medien hörigen Chef, der ihm im Kampf gegen die Vampire ständig in die Parade fährt, um „Panik zu vermeiden“.
Auch privat hat es Ephraim nicht leicht. Von Gattin Kelly wurde er geschieden, weil sie seine idealistische Hingabe an den Job nicht ertrug. Inzwischen hat er in seiner Assistentin Nora eine viel ‚bessere‘ Lebensgefährtin gefunden. Weil er Kelly insgeheim noch immer liebt – so ein Guter ist unser „Eph“! -, merkt er das aber nicht. Stattdessen frönt er seiner Affenliebe zu Sohn „Zach“, einer pubertierenden Pestgestalt, die muffig wird, wenn Papa die Welt retten will, statt mit ihm am Sonntag zum Baseballspiel zu gehen.
Als wissend-würdiger Graubart in beratender Funktion agiert Abraham Setrakian, den die Autoren offensichtlich nach Bram Stokers Dracula-Jäger Van Helsing formten. Während sein Vorbild dem Vampir-Grafen höchst nachdrücklich auf den Fersen war, beschränkt sich Setrakian darauf, im Keller seiner Pfandleihe Anti-Vampir-Waffen zu bunkern. Zu einem echten Plan hat er es nie gebracht. Erst Eph beendet den Dornröschenschlaf dieses ‚Spezialisten‘.
_In der Gewalt von Proll-Vampiren_
Die Gegenseite ist nicht eindrucksvoller aufgestellt. Der vampirische „Meister“ legt großen Wert auf eindrucksvolle Auftritte, die er mit bedrohlichen Ankündigungen à la „Jetzt hat deine letzte Stunde geschlagen!“ zu würzen pflegt. Obwohl er so böse und schlau und böse und stark und böse ist, wird er vom schwächlichen Eph und seinen Mitstreitern mächtig in den untoten Arsch getreten; das kommt auch für den Leser überraschend, nachdem es bis kurz vor dem Finale so aussah, als liefe alles nach Plan für den „Meister“.
Des Meisters untote Schergen entsprechen dem modernen Klischeetyp zwei – sie schmachten keine Jungfrauen an, sondern schneiden ihnen die Hälse durch. Auch sonst können sie vor Kraft kaum laufen, toben meuchelnd durch die Stadt, lassen sich mit Kugeln unterschiedlichsten Kalibers vollpumpen (nützt nichts) und zerbröseln detailfroh eklig, wenn sie angeleuchtet werden oder man ihnen die Köpfe abschlägt – ein Effekt, der in unzähligen Variationen wiederholt wird.
Das Ende bleibt offen, denn „Die Saat“ ist nur der Start in eine Trilogie, für deren Verlauf der erste Teil wahrscheinlich als Blaupause dient: Es wird ca. weitere 1000 Seiten verfolgt (Eph & Co.) und getückt („Meister“ und Brut) sowie gerannt und gemetzelt (alle). Höchstens die Dimension des künstlich aufgerührten Grauens ändert sich, wenn ab Band zwei noch sechs weitere „Mächtige“ mitmischen, die bisher die Umtriebe ihres abtrünnigen Gefährten zwar ungnädig, aber tatenlos zur Kenntnis nahmen. Ob die daraus resultierenden Verwicklungen jene versöhnen können, die sich durch den Auftaktband gekämpft haben? Ekstatisch werden dagegen jene Leser auf die Fortsetzung warten, die ein Faible für frisch aus der Klischee-Retorte gezapften Krawall-Horror haben. Wenigstens sie dürfen sich gut bedient fühlen.
_Die Autoren_
Guillermo del Toro (geb. 1964 in Guadalajara/Mexiko) ist bisher primär als Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent bekannt geworden. Nachdem er zunächst eine Firma für Spezialeffekte gegründet hatte, drehte del Toro 1993 seinen ersten Spielfilm. „Cronos“ dokumentiert bereits die Vorliebe seines Regisseurs für das phantastische Genre, wobei del Toro das Übernatürliche gern als märchenähnliches Element in den realen Alltag einbrechen lässt. So spielen sowohl „The Devil’s Backbone“ (2001) als auch „Pans Labyrinth“ (2006) im faschistischen Spanien des II. Weltkriegs.
Um seine filmischen Fantasien im großen Stil verwirklichen zu können, ging del Toro in den 1990er Jahren nach Hollywood, wo er sich zunächst als kompetenter und filmindustriekompatibler Regisseur für Popcorn-Horror („Mimic – Angriff der Killerinsekten“, 1997; „Blade II“, 2002) empfahl, bevor er sich mit „Hellboy“ (2004) nicht nur einen aufwändigen Filmtraum erfüllen konnte, sondern auch Kommerz mit Imagination zu mischen verstand. Vorläufiger Höhepunkt dieses gelungenen Spagats stellt das Engagement als Regisseur der zweiteiligen Verfilmung des Tolkien-Klassikers „Der Hobbit“ dar, mit der del Toro 2010 und 2011 in die Fußstapfen von Peter Jackson („Der Herr der Ringe“) treten wird.
Guillermo del Toro arbeitet als Drehbuchautor nach eigener Auskunft wie ein Schriftsteller. Für die einzelnen Rollen entwirft er regelrechte Biografien, auf die sich die Darsteller stützen können. Insofern war der Schritt zum ‚echten‘ Buchautoren wohl nur eine Frage der Zeit.
Da del Toro ein vielbeschäftigter Mann ist, holte er sich professionelle Schützenhilfe. Obwohl Chuck Hogan bereits seit 1995 Thriller veröffentlicht, die (auch in Deutschland) von der Literaturkritik positiv aufgenommen werden, blieb der eigentliche Durchbruch als Bestseller-Autor bisher aus. Die Zusammenarbeit mit Guillermo del Toro soll und könnte hier Abhilfe schaffen.
Die „Saat“/“Strain“-Trilogie erscheint im Wilhelm-Heyne-Verlag:
(2009) The Strain (dt. „Die Saat“)
(2010) The Devouring (noch nicht erschienen)
(2011) Eternal Night (noch nicht erschienen)
_Impressum_
Originaltitel: The Strain (New York : HarperCollins 2009)
Übersetzung: Jürgen Bürger u. Kathrin Bielfeldt
Deutsche Erstausgabe (geb.): September 2009 (Wilhelm Heyne Verlag)
527 Seiten
EUR 19,95
ISBN-13: 978-3-453-26639-1
http://www.heyne.de
http://www.heyne.de/diesaat
Als Audio-Book: September 2009 (Random House Audio)
Gesprochen von David Nathan
6 CDs (ca. 420 min)
EUR 24,95
ISBN-13: 978-3-8371-0165-2
http://www.randomhouseaudio.de
Ransom, Christopher – Haus der vergessenen Kinder, Das
_Das geschieht:_
Durch Versicherungsgeld nach dem Unfalltod des Vaters zu Vermögen gekommen und ohnehin auf der Suche nach einem neuen Heim, erwirbt Conrad Harrison, ehemals erfolglos in Hollywoods Filmindustrie tätig, in Black Earth, einem abgelegenen Städtchen im Südwesten des US-Staates Wisconsin, ein 140 Jahre altes Haus. Gattin Joanne, eine erfolgreiche Geschäftsfrau, lässt sich zum Wohl der kriselnden Ehe auf das Abenteuer ein; man denkt sogar über Kinder nach.
Die Harrisons bringen ihre ungelösten Konflikte mit ins neue Heim. Bald verlässt Joanne Black Earth, um an einem achtwöchigen Fortbildungslehrgang teilzunehmen. Allein und eifersüchtig bleibt Conrad zurück. Er mag an Joannes Treue nicht glauben. Außerdem wird ihm sein Haus bald unheimlich. Frauengestalten tauchen trotz sorgfältig verschlossener Türen in den Zimmern auf, Babygeschrei ertönt, eine hässliche und sehr lebendige Kinderpuppe bedroht ihn im Schlafzimmer.
Der erschrockene Neubesitzer stellt Nachforschungen an. Das alte Haus hat eine Vorgeschichte. Es diente lange als „Geburtshaus“. Während des I. Weltkriegs kamen ledige oder verwitwete Frauen hierher, um betreut von einem Arzt ihre Kinder zur Welt zu bringen. Als Spukhaus gilt das Gebäude in Black Earth nicht. Trotzdem wissen einige Bürger mehr, als sie Conrad mitzuteilen gedenken. So hat Nadia Grum, die hochschwangere Tochter der unmittelbaren Nachbarn, Unerfreuliches in dem Haus erlebt, als es noch den Laskis gehörte, deren Kinder dort sämtlich debil und behindert geboren wurden.
In seiner Einsamkeit macht sich Conrad an Nadia heran, was deren labilen Freund Eddy in gefährlichen Zorn versetzt. Während die Erscheinungen im Geburtshaus an Stärke und Gewalt zunehmen, beginnt Conrad an seinem Verstand zu zweifeln. Vergangenheit und Gegenwart mischen sich, bis es – geschürt durch den Geist des Hauses – zur Tragödie kommt …
_Leben & Tod_
Wir haben: das alte, unheimliche Haus; seinen geistig derangierten und daher spukempfänglichen Bewohner; ein ungesühntes Unrecht, das eine Seele nicht in ihrem Grab ruhen lässt; allerlei Freunde, Nachbarn und brave Bürger, die zwar etwas wissen, aber bockig schweigen oder rein gar nichts merken und dem Grauen in die Hände arbeiten.
Wie lässt sich aus diesen Elementen noch Überraschendes destillieren – und wollen wir das überhaupt? Das verfluchte Haus ist ein Klassiker, der eigentlich nur variiert, aber nicht neu erfunden werden muss. Das klappt sowieso nicht, wie viel zu viele Bücher und Filme fatal unter Beweis stellen. Auf die üblichen Zutaten mag oder kann auch Christopher Ransom deshalb nicht verzichten. Trotzdem findet er die Weiche auf ein zwar ebenfalls frequentiertes, aber nicht gar zu oft befahrenes Nebengleis: Nicht alte Schuld und der Drang nach Rache aus dem Totenreich wecken das Geburtshaus. Ausgerechnet die Sehnsucht nach dem Leben gerät außer Kontrolle und gipfelt in einem blutigen Drama.
Die Liebe als dem Hass an Stärke ebenbürtige (und von manchen Philosophen als seelenverwandt betrachtete) Emotion ist wesentlich schwieriger in ein überzeugendes Ungeheuer für eine phantastische Geschichte zu verwandeln als die Botschafter des Todes. Vampire, Zombies, Werwölfe und andere Gestalten der Finsternis sind mehr oder weniger fest definierte Größen, die leicht abgerufen werden können. Doch welche Gestalt nimmt die Liebe an, wenn sie ihre Schattenseite offenbart?
_Sex & Geburt_
Sex und Fortpflanzung sind zwei Manifestationen. Lust und Freude werden nicht selten durch Zorn und Angst gespiegelt. Solche Emotionen bringen die Harrisons ausgerechnet in ein Haus mit, das einst als Geburtsstätte errichtet wurde. Seine Mauern haben sich förmlich vollgesogen mit unkontrollierten Gefühlen. Dazu kommt (natürlich!) ein dunkles Geheimnis, das dazu führt, dass sich die Spannung im Haus zwar über die Jahre abgeschwächt hat, ohne indes verschwunden zu sein, da ihre Quelle weiterhin existiert. Als die Harrisons erscheinen, ‚lädt‘ das Haus sich erneut auf, und seine unsichtbaren Bewohner erscheinen.
Ransom gibt sich – ein wenig zu deutlich – große Mühe, dieses Konzept realistisch mit literarischem Leben zu füllen. Drei Jahre hat er an seinem ersten Roman geschrieben, hat (wie er in einem ausführlichen Nachwort beschreibt) viele persönliche Erlebnisse und Erfahrungen verarbeitet und wurde dabei von einem Eifer getrieben, der ihn über das Ziel manchmal hinausschießen ließ. „Das Haus der vergessenen Kinder“ soll ‚modernen‘ Horror im Stil von Clive Barker, Peter Straub oder Stephen King bieten. Faktisch haben die drei Altmeister jedoch nicht nur das Zweigestirn Tod & Liebe deutlich besser im Griff, sondern auch das Talent und die Erfahrung, eine Geschichte zügig und eindringlich zu erzählen.
_Anfang & Mitte & Ende_
Der Berg kreiste und gebar ein Mäuslein, lautet ein altes Sprichwort, das Ransoms Dilemma präzise beschreibt: Noch bevor wir Black Earth überhaupt betreten haben, stecken wir bereits bis zum Hals in dramatischen Eheproblemen, die zur Explosion mit üblen Folgen eigentlich gar kein Spukhaus benötigen. Conrad und Joanne machen sich das Leben perfekt zur Hölle. Kein Wunder, dass Joanne über viele hundert Seiten aus dem Geschehen verschwinden muss, damit der aufgewühlte Conrad überhaupt in die Lage gerät, das Erscheinen der Gespensterfrau Alma zu registrieren.
Dieser Mittelteil gehört Conrads Kampf mit Einsamkeit und Eifersucht sowie dem Zerfall einer Psyche, die durch ebenfalls aufwendig eingespielte Schuldgefühle aus den Fugen gerät. Freilich ist uns das ziemlich gleichgültig; während es Stephen King gelungen wäre, aus Conrad eine sympathische Figur zu machen, hätten Peter Straub oder Clive Barker ihn in einen überzeugenden Widerling verwandelt. In jedem Fall hätten wir Anteil an seinem Schicksal genommen. Ransoms Conrad ist vor allem irrational. Was ihn treibt und bedrängt, will uns der Autor wort- und bildreich und bitterernst verdeutlichen. Solcher Nachdruck wäre gar nicht nötig und ist eher kontraproduktiv, weil er aufs Tempo drückt und Leerlauf produziert.
In der Zwischenzeit beginnt der Hausspuk genretypisch anzuschwellen. Hier konzentriert sich Ransom auf die üblichen Vorkommnisse: Schatten, Geräusche, dann huschende Gestalten und verängstigte Hunde, schließlich offenes Geistern diverser unzufriedener Seelen. Davon wünscht man sich mehr, denn das weiß der Verfasser eloquent zu beschreiben. Ransom ist kein Subjekt-Prädikat-Objekt-Punkt-Stammler, sondern arbeitet mit Worten, die sich gern zu langen, verschlungenen Sätzen fügen, und er vermag Stimmungen zu vermitteln.
Im Finale zieht Ransom die Zügel fester an. Erst jetzt und jetzt endlich verschmelzen Form und Inhalt. Die Auflösung ist erschreckend (und auch erschreckend banal), aber sie geht in einer Handlung auf, der es an Schock und Konsequenz nicht fehlt. Das versöhnt mit dem langen Weg dorthin, wozu sich die Freude über einen Schriftsteller gesellt, der „Horror“ nicht mit Buh-Grusel für junge oder (im Kopf) allzu jung gebliebene Leser gleichsetzt, sondern (beileibe nicht perfekt aber plausibel) belegt, dass dies auch ein Genre für ein erwachsenes Publikum ist.
_Der Autor_
Christopher Ransom wurde im Jahre 1972 in Boulder (US-Staat Colorado) geboren. Hier wuchs er auf, ging zur Schule und studierte Literatur an der Colorado State University. Nach seinem Abschluss arbeitete Ransom für einen Hersteller von Sportartikeln, bevor er für eine Firma tätig wurde, die Schlangen und andere Reptilien aus tropischen Regionen importierte und verkaufte.
Nach einem zweijährigen Intermezzo in New York City ging Ransom, inzwischen verheiratet, Ende der 1990 nach Los Angeles, wo er sich vergeblich als Drehbuchautor versuchte. 2004 verließen die Ransomes die Filmstadt. In Mineral Point im US-Staat Wisconsin erwarben sie ein altes Haus, dessen Geschichte Ransom zu seinem Romanerstling inspirierte, der nach dreijähriger Arbeit 2009 unter dem Titel „The Birthing House“ (dt. „Das Haus der vergessenen Kinder“) veröffentlicht wurde. Ransom zeigte sich hier als Schriftsteller in der ‚phantastischen‘ Tradition von Dan Simmons, Stephen King, Clive Barker oder Jack Ketchum. Dem Genre blieb Ransom auch in seinem zweiten Roman („The Haunting of James Hastings“) treu.
Über sein Leben und seine Arbeit informiert Christopher Ransom auf seiner Website: [www.ransomesque.com.]http://www.ransomesque.com
_Impressum_
Originaltitel: The Birthing House (New York : St. Martin’s Press 2009)
Dt. Erstausgabe: Juni 2009 (Ullstein Verlag/TB Nr. 28042)
Übersetzung: Marie Rahn
430 Seiten
EUR 8,95
ISBN-13: 978-3-548-28042-4
http://www.ullstein-taschenbuch.de