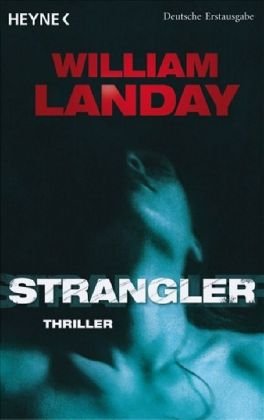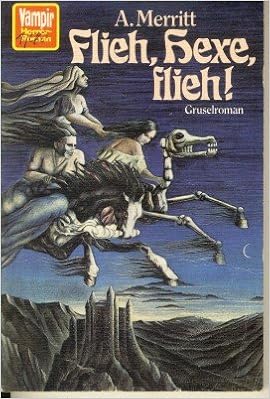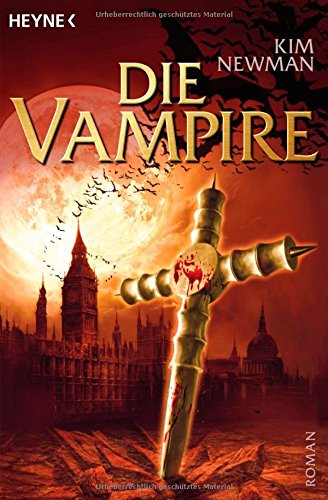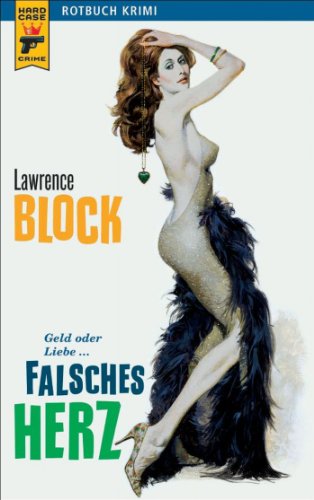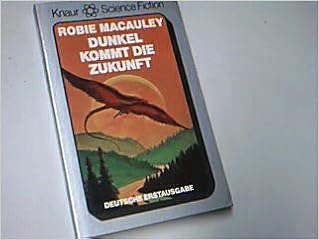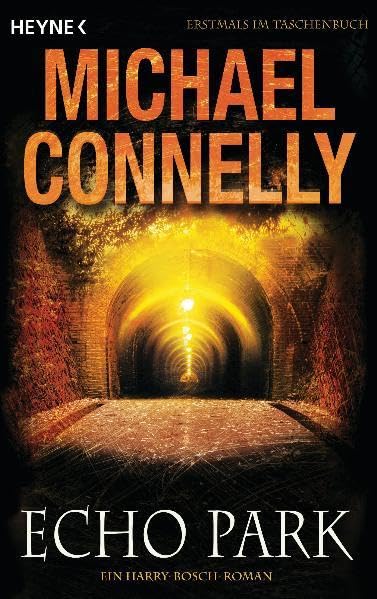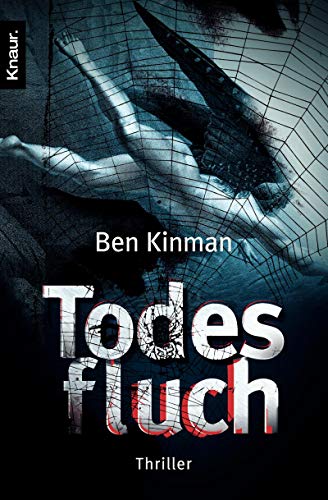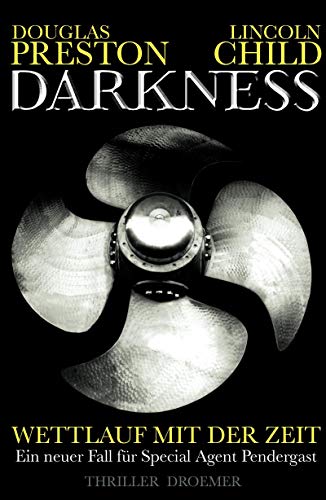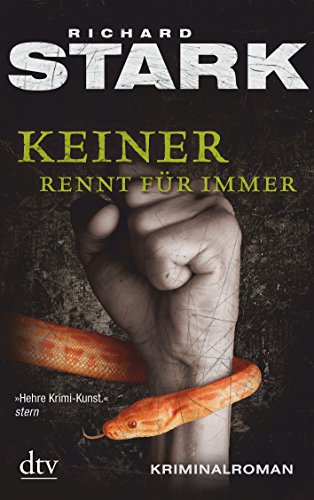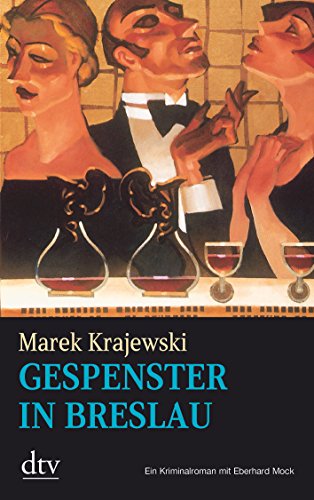_Das geschieht:_
Boston im US-Staat Massachusetts gilt im Jahre 1962 als Großstadt im Aufbruch. Ganze Stadtviertel fallen einer visionsreichen Stadtplanung zum Opfer. In das „Neue Boston“ wird massiv investiert. Großzügig fließen öffentliche Gelder in aufwändige Bauprojekte. Wer Kritik äußert, gilt als Feind des Fortschritts. Dabei gibt es gute Gründe zur Skepsis. Schiebung und Korruption sind allgegenwärtig. Nicht nur hohe Politiker und örtliche Unternehmer füllen sich die Taschen. Auch die Mafia sahnt kräftig ab. Die Polizei ist in diese Machenschaften verwickelt. Mitmachen oder wegschauen, lautet die Devise.
Joe Daley ist eigentlich ein guter Cop. Schon sein Vater war Polizist, bis ihn im Vorjahr eine Kugel traf. Sein Tod stellt die Familie vor eine Zerreißprobe. Ohne die strenge Hand des Vaters ist Joe dem Glücksspiel verfallen. Seine Wettschulden sind so hoch, dass er sich von Vinnie „The Animal“ Gargano, der rechten Hand des Mafia-Paten Carlo Gapobianco, rekrutieren lassen muss, für den er säumige Schutzgeldzahler zusammenschlägt. Joes Bruder Ricky ist ein professioneller Einbrecher, der sich beim letzten Coup dummerweise an Diamanten vergriffen hat, deren Eigentümer unter dem Schutz der Mafia steht. Nun sitzt Gargano auch Ricky im Nacken. Michael, der dritte Bruder, stand im Dienst der städtischen Enteignungskommission, die Mieter und Ladenbesitzer aus ihren Wohnungen und Läden klagt, bevor er die Leitung der „Taktischen Einsatzgruppe“ übernahm, die nach dem „Würger von Boston“ fahndet, der in anderthalb Jahren 13 Frauen ermordet hat.
In die Rolle des Würgers schlüpft Albert DeSalvo, nach Michaels Auffassung ein psychisch instabiler Wichtigtuer. Amy, Rickys Freundin und eine engagierte Journalistin, teilt seine Meinung. Kurz darauf wird sie ermordet: Ihr Ende entspricht bis ins Detail dem Modus Operandi des Würgers, obwohl DeSalvo hinter Gittern sitzt. Polizei und Staatsanwaltschaft ignorieren diese Tatsache. Michael beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Joe und Ricky unterstützen ihn, denn Amy war offenbar einer Verschwörung auf die Spur gekommen: Die Profiteure des „Neuen Boston“ gehen über Leichen. Nun werden sie aufmerksam. Die Mafia wird aktiv. Mit den Rücken zur Wand nehmen die Daley-Brüder einen Kampf auf, in dem sie völlig chancenlos zu sein scheinen …
_Eine Stadt im Würgegriff_
„The Strangler“ lautet der klug gewählte, weil einerseits nur bedingt korrekte, aber andererseits den eigentlichen Kern der Sache treffende Titel dieses ehrgeizigen Romans. Eine Mischung aus Historienkrimi und Thriller hat Autor William Landay konzipiert und dabei zumeist großartige Arbeit mit einer Geschichte geleistet, die in der Vergangenheit spielt, während ihr Inhalt zeitlos ist.
Korruption, Gier, Verbrechen, und das im ganz großen Maßstab: Kein eifriger Frauenmörder ist es, der Boston 1962 in seinem Würgegriff hält. Landay lässt ihn, der zu einer prominenten Gestalt der Kriminalgeschichte wurde, nur eine Nebenrolle spielen. Ob tatsächlich Albert DeSalvo der „Boston Strangler“ war, ist für den Verfasser nebensächlich. ‚Sein‘ Würger ist nur Mittel zum Zweck. Die eigentlichen Verbrechen finden auf einer ganz anderen Ebene statt: Kein Wunder, dass Landay seinen Roman lieber „The Year of the Strangler“ genannt hätte; der Titel wurde vom Verlag als nicht zugkräftig genug abgelehnt.
Auch die USA hatten ihre Wirtschaftswunder-Ära. Nach 1945 lief die im Weltkrieg auf Hochtouren gebrachte Wirtschaft mit voller Kraft weiter. Gewinne und Steuereinnahmen wollten investiert werden. Geld bedeutet Macht. Damit war die Schnittmenge zwischen Politik und Unternehmertum nicht nur in Boston schnell gefunden: Staatsdiener verfügen über gewaltige Geldsummen. „Zum Wohle des Volkes“ ordnen sie die Enteignung und Räumung ganzer Stadtviertel an. Skrupelfreie Geschäftemacher versprechen ihnen finanzielle Zuwendungen und Unterstützung im Wahlkampf, wenn Großaufträge, die legal ausgeschrieben gehören, an sie gehen.
Zum perfekten Funktionieren benötigt diese Maschinerie eine dritte Komponente: Nicht alle Bürger weichen der staatlichen oder städtischen Macht freiwillig. Hier kommt die Mafia ins Spiel, die mit Gewalt durchsetzt, was sich dank friedlichen Widerstandes Jahre hinziehen könnte. Wie das in der Realität aussieht, schildert Landay brutal und überzeugend in „Strangler“. Wenn er die alltägliche Korruption beschreibt, die quasi alle städtischen Bediensteten in Handlanger der einander in Gier verbundenen Schattenherren von Boston verwandelt, läuft der Verfasser zu ganz großer Form auf.
_Historie nimmt Handlung Huckepack_
„Strangler“ ist kein Tatsachen-Roman, der die böse Geschichte einer gleichermaßen moralisch verkommenen wie hilf- und ahnungslos Stadt erzählen will. In einem Nachwort erläutert Autor Landay sein Konzept. Die historische Realität dient ihm als Folie. Die Ereignisse von 1962 bilden den Hintergrund für das eigentliche Geschehen. Zwar bemüht sich Landay um eine akkurate Darstellung, ohne sich sklavisch an die Fakten zu halten. Er lässt reale Personen der Stadtgeschichte auftreten, legt ihnen jedoch seine Worte in die Münder und setzt sie so ein, wie es die Story verlangt. Das Ergebnis ist nicht authentisch, sondern hinterlässt jenen Eindruck unterhaltsamer Glaubwürdigkeit, die einen guten Historienroman auszeichnet.
Dazu kommt ein ausgefeilter Stil. Landay zeigt, dass man den Kriminalroman nicht in die Genre-Ecke drängen soll, weil eben auch seine Autoren literarisch anspruchsvoll schreiben können, ohne dass die Unterhaltung dabei auf der Strecke bleibt. „Strangler“ ist vor allem in den beschreibenden Szenen ein Genuss. Landay schreibt – in der deutschen Fassung tatkräftig und tüchtig unterstützt von seinem Übersetzer – klar und anschaulich, ohne dabei ins Schwafeln oder Predigen zu verfallen. Der Verfasser war selbst Jurist, weshalb die präzise Darstellung der Ablaufprozesse in einer US-Gerichtsbehörde besonders fesselt.
_Großes Drama benötigt Gesichter_
Landay entscheidet sich für eine Dreiteilung der Hauptfigur und platziert die Daleys an den Brennpunkten der Handlung. Joe, der Polizist, repräsentiert den korrupten Unterbau der Stadtverwaltung. Michael, der Jurist, gehört zumindest randständig der selektiv ihren Bürgern dienenden Führungsschicht an. Ricky, der Dieb, steht im Lager des Verbrechens. Damit haben alle Brüder einen guten Blick auf das jeweilige Milieu.
Mit der Charakterisierung tut sich Landay schwer. Joe lässt sich bestechen und von der Mafia instrumentalisieren, Michael von seinen Vorgesetzten manipulieren, Joe stiehlt. Geprägt von irisch-katholischen Grundsätzen (die hier eher wie Gemeinplätze wirken), sind sie trotz ihrer Fehler ‚gute Menschen‘. Landay versucht jede Schwarz-Weiß-Färbung zu vermeiden. Seine Welt ist in unterschiedlichen Grautönen gezeichnet. Nicht nur die Daleys, sondern auch die vielen anderen Figuren, die er in „Strangler“ auftreten lässt, mühen sich mit ihrem Leben ab; selbst mordlustige Mafiosi haben ihre schwachen Momente.
Für diese durchaus der Realität entsprechende Ambivalenz findet Landay manchmal nur klischeeträchtige Bilder. Beispielhaft ist ein Basketballspiel zwischen Joe, Michael und Ricky. Der Verfasser spiegelt im Spielverhalten die unterschiedlichen Persönlichkeiten der Brüder. Dann ändert sich die Perspektive; im Haus hinter dem Spielfeld stehen die Mutter, die Ehefrau und die Freundin. Sie beobachten ihre Söhne, den Gatten und den Geliebten, kommentieren deren Verhalten und entschlüsseln es für diejenigen Leser, die vielleicht immer noch kapiert haben, wessen Geistes Kinder die Daley-Brüder sind. Solche Szenen familiärer Interaktion kennt man aus Kino- und vor allem Fernsehfilmen. Sie sind plakativ und stören die Illusion einer ansonsten geschlossenen und ausgewogenen Romanhandlung.
Ungemein eindimensional denken, handeln und sprechen Landays Mafiosi. Der Autor hat sich anscheinend herausgegriffen, was er bei Puzo, Coppola und Scorsese gelesen oder gesehen hat, und schmeckt es mit einer Prise Sopranos ab. Im Interview erwähnt Landay die oft und gern zitierte Anekdote, dass erst Puzo und Coppola mit „Der Pate“ der Mafia ihr bekanntes Selbstbild verschafft haben: Nachdem sie das Buch gelesen und den Film gesehen und für gut befunden hatten, begannen sie die Film-Gangster in Verhalten und Auftreten zu imitieren. Landay projiziert dies auf ’seine‘ Mafiosi aus Boston. So wirken sie denn auch: wie Laienschauspieler.
Das Ende ist – wiederum erwartungsgemäß – tragisch. Dass es nicht happy ausfallen wird, ist dem Leser schnell klar, denn ein wenig zu stark weht der traurige Wind der Verdammnis durch die Kapitel … Noch einmal lässt der Autor sich fremdinspirieren. Die Matriarchin als rasendes Muttertier und Rächerin ist ein Klischee, dass Landay sich und seinen Lesern hätte ersparen können, zumal es dem sonst überzeugenden Finale angeflanscht wirkt.
Mit solchen Einschränkungen kann der Leser freilich leben. Der Ehrgeiz des Verfassers spiegelt sich unterm Strich positiv in seiner Geschichte wider. Landay schreibt langsam und sorgfältig, er fordert die Aufmerksamkeit seines Publikums. Womöglich muss man nach der Lektüre allzu vieler mit der heißen Nadel gestrickter ‚Bestseller‘ erst wieder lernen, sich auf diese Herausforderung einzulassen …
_Der Autor_
William Landay wurde 1964 in Boston geboren. Seine Jugend verbrachte er in Brookline. Er studierte Jura in Yale und an der Boston College Law School. Nach seinem Abschluss arbeitete er für die Staatsanwaltschaft des Distrikts Middlesex.
Landay war kein Vollblutjurist. Zwischen 1991 und 1997 nahm er sich zwei längere Auszeiten und versuchte sich als Schriftsteller. Die beiden dabei entstandenen Romane wurden abgelehnt, und Landay kehrte ins Büro zurück. In seiner Freizeit schrieb er indes weiter. 2003 veröffentlichte er – inzwischen verheiratet – seinen Romanerstling „Mission Flats“ (dt. „Jagdrevier“), für den ihn die britische „Crime Writers Association“ mit einem „John Creasey Memorial Award“ für das beste Romandebüt des Jahres auszeichnete. Landay gab die Jurisprudenz abermals und endgültig auf. Auch sein zweiter Roman „The Strangler“ (dt. „Strangler“) wurde von der Kritik hoch gelobt.
Über sein Werk informiert der Verfasser auf seiner Website: http://www.williamlanday.com.
_Impressum_
Originaltitel: The Strangler (New York : Delacorte Press 2007)
Übersetzung: Robert Brack
Deutsche Erstausgabe: Januar 2009 (Wilhelm Heyne Verlag/TB Nr. 40584)
528 Seiten
EUR 9,95
ISBN-13: 978-3-453-40584-4
http://www.heyne.de