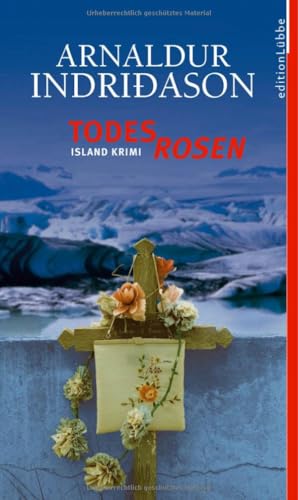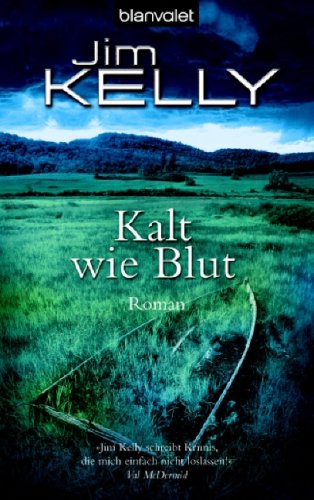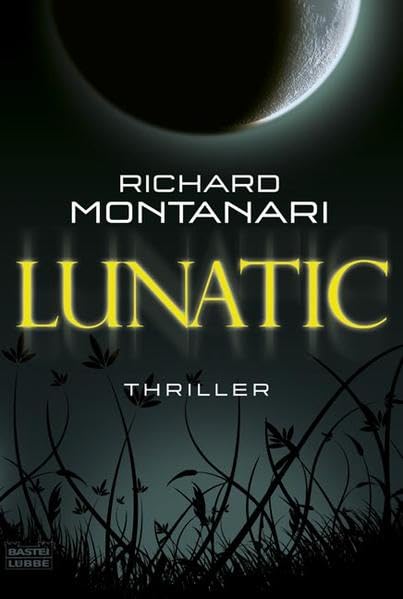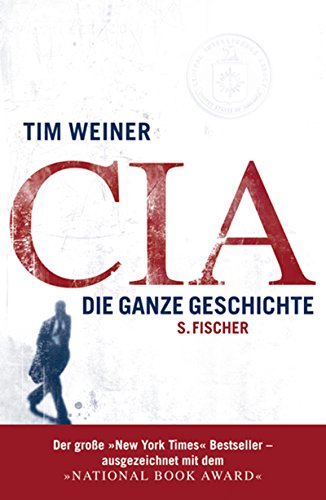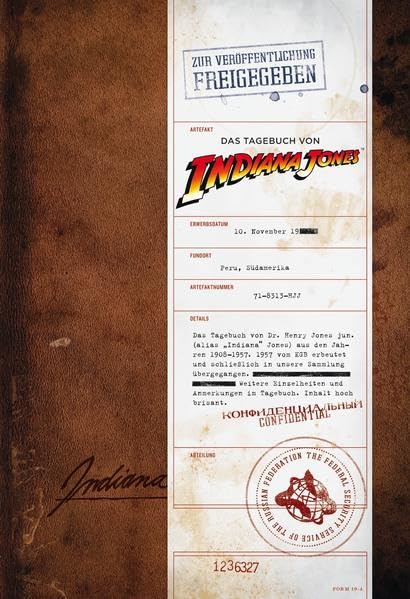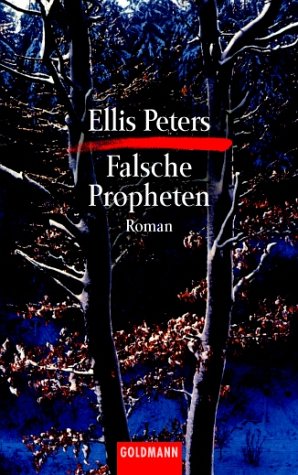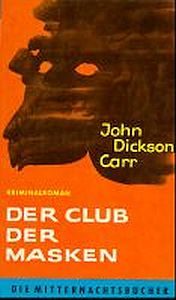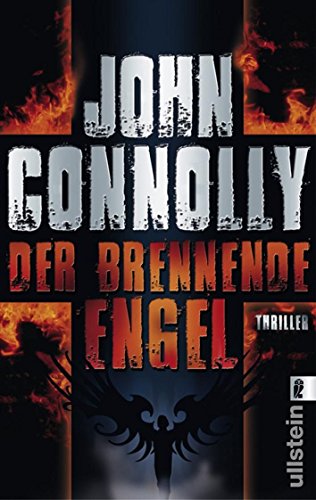Ausgerechnet auf dem Grab des isländischen Nationalhelden Jón Sigurdsson wird die Leiche einer jungen Frau gefunden – nackt, mit Spuren körperlicher Misshandlung übersät und erstickt. Sigurdsson starb 1879; wollte der Mörder etwas mit seiner Tat aussagen?
Kommissar Erlendur Sveinsson, der mit seinem Team die Ermittlungen aufnimmt, ist davon überzeugt, dass die Leiche nicht grundlos dort platziert wurde. Zunächst gilt es jedoch, die Identität des Opfers festzustellen, was sich als erstaunlich schwierig erweist. In seiner Not zieht Erlendur sogar seine Tochter Eva Lind zu Rate, die als Junkie und Gelegenheitsprostituierte die Unterwelt der Hauptstadt Reykjavík kennt.
Endlich bekommt die Leiche einen Namen: Birta gehörte zu den Drogenschmugglern des örtlichen Gangsterbosses Herbert Baldursson, der sie auch an Freier ‚vermittelte‘, denen gern die Hand ausrutscht. Offenbar lief Birtas letzte Party schrecklich aus dem Ruder. Oder hat die junge Frau den Unwillen des brutalen und jähzornigen Herbert erregt?
Erlendur will an so profane Erklärungen nicht glauben. Birta stammt wie Jón Sigurdsson aus den Westfjorden. Mit seinem wenig begeisterten Kollegen Sigurður Óli begibt er sich auf die lange Fahrt zur zerklüfteten Nordwestküste Islands. Er kommt in eine von Rezession und Landflucht gezeichnete Region – ein Niedergang, hinter dem Erlendur allmählich Methode zu erkennen glaubt.
In Reykjavík wird Herbert entführt und bleibt verschwunden. Offenbar gibt es jemanden, der um Birta trauert und ihren Tod rächen will. Ein angesehenen ‚Geschäftsmann‘ wird sehr nervös, denn Herbert erledigt allerlei Drecksarbeit für ihn, die tunlichst unbekannt bleiben sollten. Der ist in seinem Gefängnis inzwischen über die Hintergründe im Bilde und wird zu Erlendurs wichtigstem Zeugen – sollte er überleben …
_Kleine Insel auf krimineller Aufholjagd_
|“Morde werden hier im Affekt verübt. Meistens im Suff. Sie haben nie irgendwas Symbolisches an sich oder irgendeine tiefere Wahrheit. Morde sind hier schäbig, scheußlich und ganz und gar zufällig.“| (S. 97/98)
So spricht Polizist Sigurður Óli und gibt damit eine Grundsatzerklärung ab. Doch er irrt, während sein Kollege Erlendur gedanklich schon weiter ist: An der Wende zum 21. Jahrhundert beginnt sich auf der kleinen Insel hoch im Nordatlantik das Verbrechen zu wandeln. Die Globalisierung sorgt für einen Quantensprung. Verbrechen und Big Business beginnen sich zu vermischen, die Grenzen verwischen dabei. Der Tod wird zum Geschäftsrisiko – ein Faktor, den das organisierte Verbrechen kühl einkalkuliert.
Herbert und vor allem sein unsichtbarer Auftraggeber haben die modernen Regeln verinnerlicht. Das Spektrum ihrer kriminellen Aktivitäten ist breit: Für die Kneipen Reykjavíks importieren sie Prostituierte aus Osteuropa, die regelmäßig gegen ‚frische Ware‘ ausgetauscht werden. Gleichzeitig schmuggeln sie Drogen im großen Stil. Noch lukrativer ist die Aneignung und Ausbeutung politischen und wirtschaftlichen Insiderwissens. Wer gut schmiert und weiß, wann und wo Großprojekte geplant sind, kann früh einsteigen und absahnen; das ist nicht einmal illegal, sondern höchstens moralisch bedenklich – eine Einschränkung, die aus Sicht der „global players“ freilich nur für Schwächlinge von Belang ist.
_Nicht jeder Wurm mag ewig kriechen_
Selbstverständlich bleibt der ‚klassische‘ Mord dem modernen Island erhalten. Weiterhin bringen sich die Menschen aus Hass und Gier und auf denkbar hässliche Arten um. Im Fall der „Todesrosen“ irrt Sigurður Óli trotzdem ein weiteres Mal: Die hier beschriebenen Morde und Mordversuche sind zwar schäbig, aber dennoch von enormer Symbolkraft.
Wie Erlendur Sveinsson mag sich der lange unsichtbar bleibende, weil aufgrund seiner Unauffälligkeit in der Menge verschwindende Kidnapper Herberts nicht damit abfinden, dass nur die kleinen Fische für ihre Taten büßen müssen, während sich die Großen hinter einer Wand aus Geld, Macht und Verbindungen verschanzen. Ihm geht es dabei zwar um Gerechtigkeit, aber nicht um gerechte Strafe. Die Polizei bleibt deshalb außen vor. Selbstjustiz tritt an ihre Stelle.
Doch das Schicksal ist tückisch. Das Blatt wendet sich, die ‚Bösen‘ gewinnen die Oberhand und schlagen zurück. Als sie dennoch fallen, bleibt der Rächer als Opfer zurück. An die Stelle des verbrecherischen Spekulanten wird ein neuer ‚Geschäftsmann‘ treten, der die Beutelschneiderei seines Vorgängers genau studieren und verfeinern wird.
_Der Kommissar und die Last der Welt_
Zu dieser Erkenntnis ist Erlendur längst gelangt. Sein daraus resultierender Schwermut ist verständlich: Was in wirtschaftskriminellen Kreisen Allgemeinwissen ist, kann er, der doch eigentlich Gesetz und Ordnung repräsentiert, nur mühsam und ihm Rahmen einer anstrengenden Recherche in den Westfjorden in Erfahrung bringen. Was er dort entdeckt, hilft ihm wenig, denn während sein Gegner sich aller Regeln enthoben fühlt, muss sich Erlendur daran halten. Er kämpft quasi mit einem auf den Arm gebundenen Rücken.
Ausgeglichen wird dieses Handicap durch Erlendurs ausgeprägten Hang zur intensiven Fahndung und einer Abneigung gegen alles, was sich ihm dabei in den Weg stellt. Wieder einmal lässt Autor Indriðason seinen ohnehin gebeutelten Helden (dazu weiter unten mehr) beruflich ausgiebig gegen geschlossene Türen laufen, hinter denen sich seine Verdächtigen über ihn lustig machen oder sicher wähnen. Sie irren sich, denn Erlendur ist an einem Punkt seines Leben angekommen, an dem er an berufliche Stromlinienform als Voraussetzung einer Karriere keinen Gedanken mehr verschwendet. Solche Menschen sind gefährlich, wie Erlendur beweist, als er sich langsam aber buchstäblich hartnäckig der Lösung entgegenarbeitet. Die hat es in sich und ist mit einem hübschen, weil sehr ironischen Finaltwist verknüpft, der zur Abwechslung einmal funktioniert.
Wie es sich für einen skandinavischen Kriminalisten gehört, ist Erlendur auch privat keine Frohnatur, was noch vorsichtig ausgedrückt ist. Er lebt allein und ist einsam, seine Familienverhältnisse sind desaströs; seine Ex-Gattin hasst ihn viele Jahre nach der Scheidung noch immer aus tiefster Seele, sein Sohn ist Alkoholiker, seine Tochter drogensüchtige Prostituierte. Mit den daraus resultierende Problemen füllt Indriðason manche Buchseite. Erfreulicherweise übertreibt er es nie damit; „Todesrosen“ bleibt Kriminalroman. Hilfreich ist auch ein ausgeprägter Sinn für Humor, der eher schottisch als skandinavisch anmutet. Den hat Erlendur auch nötig, denn die Zukunft hält für ihn noch manche Prüfung bereit.
_Durcheinander als Veröffentlichungsprogramm_
Das weiß der Indriðason-Leser womöglich schon, denn obwohl „Todesrosen“ als siebter Band der Erlendur-Serie in Deutschland erscheint, steht er chronologisch an zweiter Stelle. Der Verlag begann nicht mit Nummer eins, sondern griff sich einfach einen Band aus dem Mittelfeld heraus. Die entstandenen Lücken wurden erst nachträglich gefüllt, als sich herausstellte, dass die deutschen Leser Indriðason-Romane schätzen und wohl auch ältere Titel nicht verschmähen würden. Diese rüde Behandlung sind besagte Leser freilich gewöhnt. Immerhin ist die Reihe inzwischen vollständig und sie wird sogar fortgesetzt, während viele andere lesenswerte Serien rüde gekappt (weil nicht schnell genug einträglich) wurden und werden.
_Der Autor_
Arnaldur Indriðason wurde am 8. Januar 1961 in Reykjavik geboren. Er wuchs hier auf, ging zur Schule, studierte Geschichte an der University of Iceland. 1981/82 arbeitete als Journalist für das |Morgunblaðið|, dann wurde er freiberuflicher Drehbuchautor. Für seinen alten Arbeitgeber schrieb er noch bis 2001 Filmkritiken. Auch heute noch lebt der Schriftsteller mit Frau und drei Kindern in Reykjavik.
1995 begann Arnaldur Romane zu schreiben. „Synir duftsins“ – gleichzeitig der erste Erlendur-Roman – markierte 1997 sein Debüt. Jährlich legt der Autor mindestens einen neuen Titel vor. Inzwischen gilt er – auch im Ausland – als einer der führenden Kriminalschriftsteller Islands. Gleich zweimal in Folge wurde ihm der „Glass Key Prize“ der Skandinaviska Kriminalselskapet (Crime Writers of Scandinavia) verliehen (2002 für „Nordermoor“, 2003 für „Todeshauch“).
Drei seiner Romane hat Arnaldur selbst in Hörspiele für den Icelandic Broadcasting Service verwandelt. Darüber hinaus bereiten die isländischen Regisseure Baltasar Kormákur bzw Snorri Thórisson Verfilmungen von „Nordermoor“ bzw. den Thriller „Napóleonsskjölin“ (Operation Napoleon), den Arnaldur 1999 schrieb, vor.
Die Erlendur-Romane erscheinen gebunden und als Taschenbücher im (Bastei-)Lübbe-Verlag:
(1997) [Menschensöhne 1217 („Synir duftsins“) – TB Nr. 15530
(1998) Todesrosen („Dauðarósir“)
(2000) [Nordermoor 402 („Mýrin“) – TB Nr. 14857
(2001) [Todeshauch 856 („Grafarþögn“) TB Nr. 15103
(2002) [Engelsstimme 2505 („Röddin“) – TB Nr. 15440
(2004) [Kältezone 2274 („Kleifarvatn“) – TB Nr. 15728
(2005) [Frostnacht 3989 („Vetraborgin“) – TB Nr. 15980 (erscheint März 2009)
(2007) „Harðskafi“ (noch nicht in Deutschland erschienen)
_Impressum_
Originaltitel: Dauðarósir (Reykjavík: Vaka-Helgafell 1998)
Übersetzung: Coletta Bürling
Deutsche Erstausgabe: Juni 2008 (|Lübbe|-Verlag/|editionLübbe|)
301 Seiten
EUR 18,95
ISBN-13: 978-3-7857-1612-0
http://www.luebbe.de
Als Hörbuch: Juni 2008 (|Lübbe Audio|)
4 CDs, gelesen von Frank Glaubrecht
340 min
EUR 19,95
ISBN 978-3-7857-3561-9