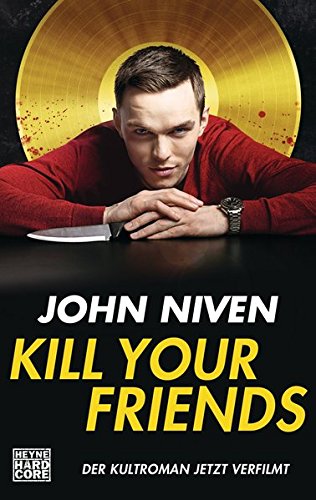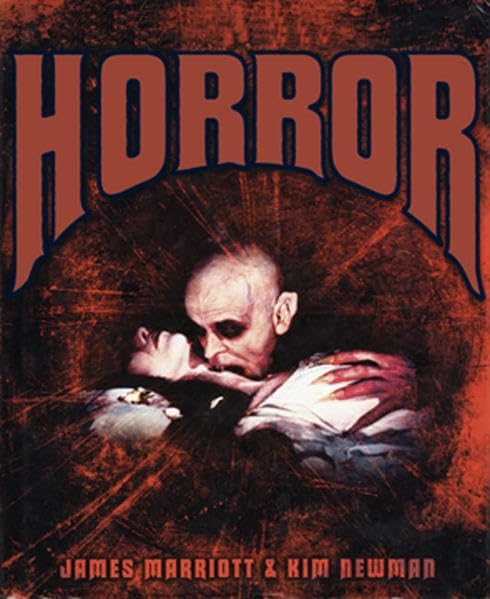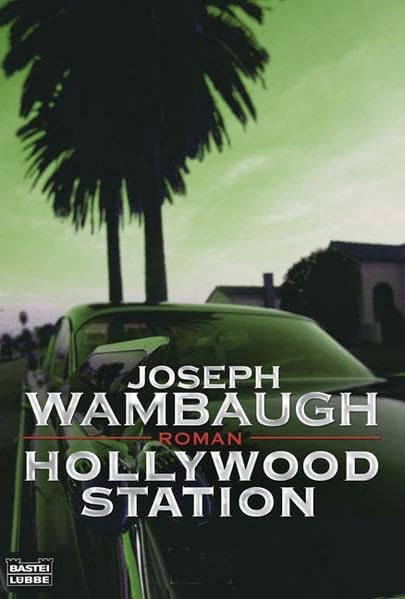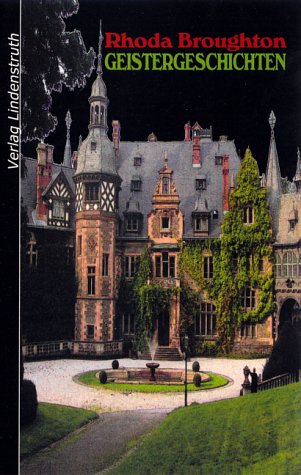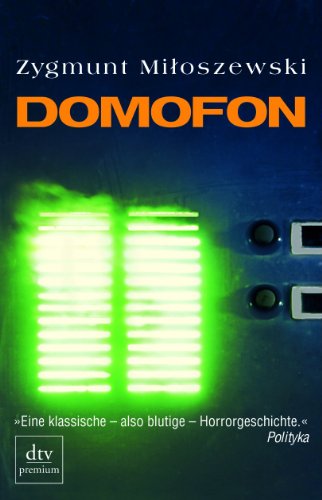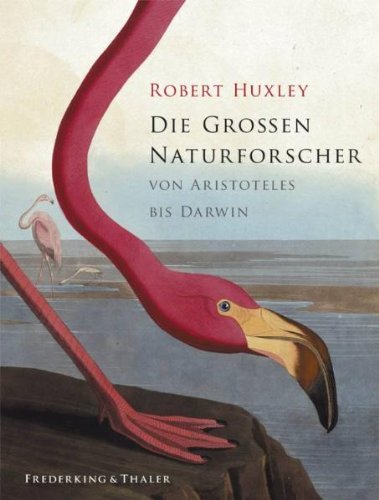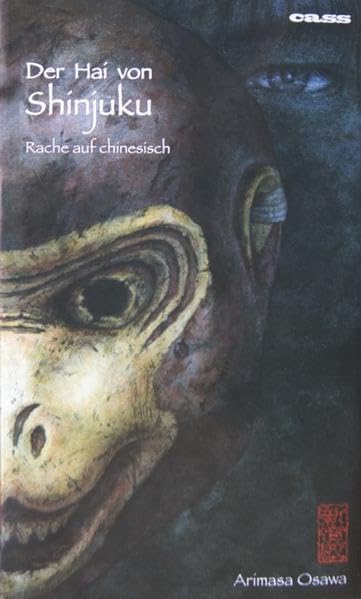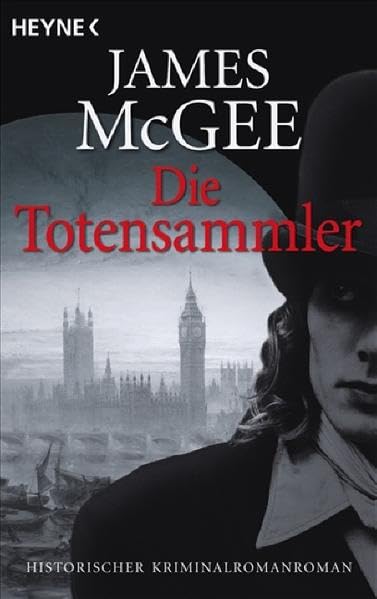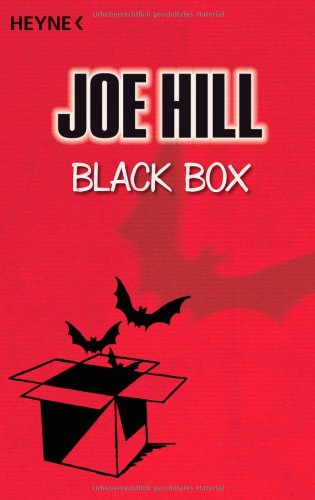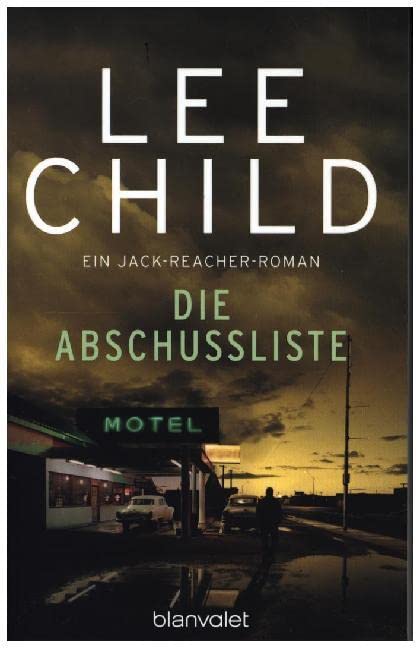Nur Erfolg zählt im Musikbusiness. Als ein bisher erfolgreicher Manager nicht mehr mithalten kann, bringt er einen Konkurrenten um. Was zunächst funktioniert, entwickelt eine verhängnisvolle Eigendynamik mit verheerenden Folgen … – Eher Gesellschafts-Komödie als Krimi, besticht „Kill Your Friends“ durch das Insiderwissen des Verfassers und die brutale Konsequenz der Handlung, die sich bar jeglicher Illusionen in nackter Gier und Bösartigkeit wälzt: eine Lektüre, die man einfach nicht aus der Hand legt. John Niven – Kill Your Friends weiterlesen
Alle Beiträge von Michael Drewniok
James Marriott/Kim Newman (Hgg.) – Horror. Meisterwerke des Grauens von Alien bis Zombie
Die Geschichte des Horrorfilms stellen James Marriott und Kim Newman in elf Kapiteln und auf 250 Seiten dar, wobei sie von fünf Mitarbeitern (Stephen Jones, Rebecca Levene, Kerri Sharp, Stephen Thrower, Pete Tombs) unterstützt werden.
„Horror“ outet den Filmhorror einleitend als Spross einer künstlerischen Tradition, die wesentlich älter als das Kino ist. Der Mensch lässt sich gern Angst einjagen, wenn er sich dabei ungefährdet weiß. Bis ihm per Zelluloid eingeheizt werden konnte, lieferten Literatur und Theater, was sein Herz (oder sein Magen?) begehrte. Folgerichtig waren die ersten Horrorfilme nicht nur in ihrer Darstellung, sondern auch formal sehr theatralisch. James Marriott/Kim Newman (Hgg.) – Horror. Meisterwerke des Grauens von Alien bis Zombie weiterlesen
Ellery Queen – Der Giftbecher

Will C. Brown – Der Fluch von Massacre Bend
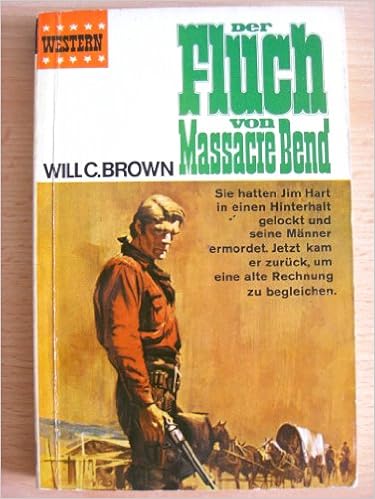
Will C. Brown – Der Fluch von Massacre Bend weiterlesen
David Mack – Star Trek Vanguard 1: Der Vorbote
Der gescheiterte Versuch, die energetische Barriere am Rand der Galaxis zu durchbrechen, hat das Föderationsraumschiff „Enterprise“ schwer beschädigt. Das Angebot der Raumstation „Vanguard“, sein Schiff reparieren und überholen zu lassen, ist für Captain James T. Kirk verlockend aber verdächtig: „Vanguard“ sollte in diesem Jahr 2265 eigentlich noch im Bau sein. Die Grenznähe zu den Reichen der nicht eben friedfertigen Tholianer und der jederzeit kriegerischen Klingonen stimmt Kirk nachdenklich. Was stellt die „Vanguard“ wirklich dar?
In der Tat dient die Raumstation der Föderation als Basis für die eine forcierte Erforschung des Taurus-Sektors, der sich wie ein Puffer zwischen das Territorium der Tholianischen Gemeinschaft und das klingonische Imperium legt. Zwar erhoben beide Mächte nie einen Anspruch auf diesen abgelegenen Winkel, doch die hektischen Aktivitäten der Föderation und die offensichtliche Geheimhaltung erregen Misstrauen. David Mack – Star Trek Vanguard 1: Der Vorbote weiterlesen
Graham Hurley – Die Saat des Zweifels

Graham Hurley – Die Saat des Zweifels weiterlesen
Festa, Frank (Hg.) – Denn das Blut ist Leben. Geschichten der Vampire
_Inhalt_
_Bram Stoker_ [1847-1912]: |Draculas Gast| („Dracula’s Guest“, 1914), S. 7-20: Der nächtliche Spaziergang des englischen Reisenden endet auf einem verfluchten Friedhof, vor dessen Schrecken ihn ausgerechnet ein sehr bekannter Vampirfürst rettet …
_J. Wesley Rosenquist_ [?-?]: |Rückkehr in den Tod| („Return to Death“, 1936), S. 21-27: Scheintod ist ein gefährlicher Zustand in einem Dorf, dessen schlichtgeistige Bewohner an Vampire glauben …
_Graham Masterton_ [geb. 1946]: |Der Laird von Dunain| („Laird of Dunain“, 1992), S. 28-38: Er saugt seine Opfer quasi über Umwege aus, doch letztlich ist der schottische Vampir nicht gegen die Tücke des Objekts gefeit …
_Simon Clark_ [geb. 1958]: |Vampir-Abschaum| („Vampyrrhic Outcast“, 1992), S. 39-49: Sogar unter Blutsaugern gibt es eine Rangordnung, und grässlich ergeht es jenen, die ganz unten stehen …
_Edgar Allan Poe_ [1809-1849]: |Ligeia| („Legeia“, 1838), S. 50-66: Der Tod siegt nur durch die Willensschwäche des Menschen, und Ligeia ist eine überaus willensstarke Frau, die ihr Ende nicht zu akzeptieren gedenkt …
_Edmond Hamilton_ [1904-1977]: |Das Vampirdorf| („Vampire Village“, 1932), S. 67-83: Zwei gut durchblutete Wanderer geraten in ein pittoreskes transsilvanisches Dorf, dessen Bürger sie geradezu frenetisch begrüßen …
_F. Marion Crawford_ [1854-1909]: |Denn das Blut ist Leben| („For the Blood Is the Life“, 1911), S. 84-101: Sie liebte das Leben und den schönen Angelo, auf den die grausam geendete Christina keineswegs zu verzichten gedenkt …
_Brian Hodge_ [geb. 1960]: |Die Alchemie der Stimme| („The Alchemy of the Throat“, 1994), S. 102-132: Er ist seines ewigen Lebens längst überdrüssig und findet doch nicht den Mut, es zu beenden, bis ihn sein junger Liebhaber vor vollendete Tatsachen stellt …
_H. P. Lovecraft_ [1890-1937]: |Das gemiedene Haus| („The Shunned House“, 1928), S. 133-165: Im Keller mästet sich seit vielen Jahren das Verderben, bis ihm zwei mutige Historiker den Kampf ansagen – und sich schrecklich überschätzen …
_Simon Clark_ [geb. 1958]: |Hotel Midnight| („Hotel Midnight“, 2005), S. 166-168: Ein uraltes Haus wechselt samt uraltem Vampir den Besitzer …
_Théophile Gautier_ [1811-1872]: |Die verliebte Tote| („La morte amoureuse“, 1836), S. 169-201: Der junge Priester verfällt einer ebenso schönen wie bösen Frau, die ihn die schauerlichen Freuden des Lebens lehrt …
_Alice Olsen_ [?-?]: |Winternacht| („Winter Night“, 1940), S. 202-206: Vermeide ein Rendezvous, wenn du deine Schöne anschließend am Friedhof absetzen sollst …
_Raymond Whetstone_ [?-?]: |Die durstigen Toten| („The Thirsty Dead“, 1935), S. 207-214: Der einsame alte Mann dauert den jungen Nachbarn, der dessen Einladung annimmt – ein gutes Werk, das sich rächen wird …
_Clark Ashton Smith_ [1893-1961]: |Ilalothas Tod| („The Death of Illalotha“, 1937), S. 215-227: Wahre Liebe kann den Tod besiegen, doch ist der Preis höher, als du ihn möglicherweise zu zahlen bereit bist …
_Graham Masterton_ [geb. 1946]: |Verkehrstote| („Roadkill“, 1997), S. 228-235: Statt ausschließlich in der Vergangenheit zu schwelgen, hätte Graf Dracula sich besser über die aktuellen Pläne der Straßenbaubehörde informiert …
_Karl Hans Strobl_ [1877-1946]: |Das Aderlassmännchen| (1909), S. 236-254: Direkt neben dem Friedhof steht ein Kloster mit dicken, vollblütigen Nonnen, was einen untoten Edelmann nicht in seinem Grab ruhen lässt …
_Anonymus_: |Die Vampirkatze von Nabèshima| („The Vampire Cat“, um 1910): S. 255-264: Der junge Fürst wird von einem Vampir heimgesucht, der die Gestalt seiner Lieblingskonkubine angenommen hat; ein einfacher Soldat ist es, der den Bann brechen kann …
_Hugh B. Cave_ [1910-2004]: |Stragella| („Stragella“, 1932), S. 265-295: Zwei wahrlich vom Pech verfolgte Schiffbrüchige verschlägt es ausgerechnet auf ein Geisterschiff, das auch noch von Vampiren bevölkert wird …
_Henry Kuttner_ [1914-1958]: |Ich, der Vampir| („I, the Vampire“, 1937), S. 296-319: Irgendwann merkt auch ein Vampir, dass es in der Filmstadt Hollywood die schönsten Frauen gibt …
_Patricia N. Elrod_ [geb. 1945]: |Spätvorstellung| („A Night of the [Horse] Opera“, 1995), S. 320-337: Im Chicago des Jahres 1936 rettet ein Vampir den Schauspieler Chico Marx vor fiesen Gangstern …
_Lester del Rey_ [1915-1993]: |Feuerkreuz| („Cross of Fire“, 1939), S. 338-347: Was wären die Folgen, wenn ein Vampir zurück ins Leben fände …?
_F. Paul Wilson_ [geb. 1946]: |Mitternachtsmesse| („Midnight Mass“, 1990): S. 348-408: Vampire beherrschen die Welt, doch wenigstens in seiner alten Kirche nimmt ein Priester entschlossen den Kampf gegen die blasphemischen Unholde auf …
_Das mögliche Risiko eines bösen Erwachens_
Der Vampir: ein Mythos mit ‚realem‘ Hintergrund, weil er eine – wenn auch negativ besetzte – Veranschaulichung für ein Weiterleben nach dem Tod ist, der ungeachtet aller religiösen Vorsichts- und Beschwichtigungsmaßnahmen überall auf der Welt für Ungewissheit und Schrecken sorgt und die Fantasie beflügelt. Was kommt danach? Ewiger Friede im Warten auf die Auferstehung ist womöglich keineswegs garantiert, wie der Blut saugende „Nachzehrer“, der sich aus dem Grab erhebt und den Lebenden nachstellt, nur zu deutlich macht. Der Vampir-Mythos ist alt und weist weltweit erstaunliche Parallelen auf, wie in dieser Sammlung „Die Vampirkatze von Nabèshima“ (die einzige Geschichte, die den europäischen und nordamerikanischen Kulturkreis verlässt) deutlich macht.
Bram Stoker war 1897 nicht der erste Autor, der sich des Vampirs als Figur bediente. In diesem Sammelband ist Théophile Gautier mit „Die verliebte Tote“ aus dem Jahre 1836 vertreten – eine Erzählung ganz im Stil des „gotischen“ Horrors des 18. und frühen 19. Jahrhunderts, der knalligen Horror mit moralisierendem Unterton kombinierte; in unserem Fall hat sich ein Priester gefälligst seinem freudlosen Dasein als Diener Gottes zu unterwerfen. Wenn ihm ein Mensch, explizit eine Frau, eine Alternative aufzeigt, kann sie nur ‚böse‘ sein und muss vernichtet werden. Da der weibliche Vampir hier eher als Liebende denn als Blutsaugerin auftritt, ist im Grunde sie das Opfer, wie auch der Priester – freilich zu spät – erkennt.
Die stilisierte Künstlichkeit ließ der literarische Vampir bald hinter sich. „Varney, der Vampir“ von Thomas Peckett Prest (1810-1857) war ein ruppiger Geselle, der sich seiner Blutgier und seiner Geilheit gleichermaßen gewissenlos unterwarf. Bram Stoker gestaltete seinen Dracula wesentlich eleganter und gab ihm einen adligen Hintergrund, aber auch er schrieb ihm menschliche Bedürfnisse zu, wodurch er ihn noch stärker dämonisierte: Graf Dracula ignoriert das ‚Verbot‘ der züchtigen, durch Tabus und Regeln gezähmten Liebe. Seine Attacken auf weibliche Opfer sind eindeutig erotisch gefärbt und stoßen buchstäblich auf Gegenliebe. So stark ist seine Präsenz, dass er in [„Draculas Gast“ 3489 nicht einmal persönlich auftreten muss, um für Schauder & Grusel zu sorgen.
_Von Blutsaugern und Beutelschneidern_
„Dracula“ setzte Maßstäbe und lockte eine eigene Art von Blutsaugern: ein Heer von weniger inspirierten Schriftstellern, die Stokers Roman als literarischen Steinbruch betrachteten, aus dem sie sich an Ideen holten, was sie für ihre eigenen, meist für den schnellen, anspruchslosen Lesegenuss gedachten Geschichten benötigten. „Denn das Blut ist Leben“ sammelt eine ganze Anzahl von Storys aus der Ära der US-Pulps, jener Magazine, die vor allem zwischen den beiden Weltkriegen kostengünstig Genre-Unterhaltung für ein Massenpublikum lieferten. Edmond Hamilton, J. Wesley Rosenquist, Henry Kuttner, Hugh B. Cave und Lester del Rey zeigen, dass sich auch aus der Nachahmung Funken schlagen lassen, während Alice Olson und Raymond Whetstone lähmende Langeweile verbreiten.
Dass der Grusel auf Pulp-Niveau auch heute noch lebt, beweisen uns Graham Masterton („Der Laird von Dunain“), Patricia N. Elrod und F. Paul Wilson mit ideen- und überraschungsarmen Geschichten. Masterton treibt den Grobgrusel wie immer auf die Spitze, nimmt ihn aber wenigstens nicht ernst und kann damit punkten, während Wilson bleischwer sein Garn aus Klischee und Gruselkitsch spinnt. (Wenigstens ist er konsequent in der Frage, ob nur das Kruzifix und damit die katholische Kirche Macht über den Vampir besitzt – ein Faktor mit gewaltigen Konsequenzen für die übrigen Weltreligionen.) Elrod bastelt aus bewährten Elementen routiniert eine Story, die in ihrer Endlos-Serie um den Vampirdetektiv [Jack Fleming 1946 spielt.
_Der Tod kann sexy sein_
Der Vampir und der Sex: Heute sind beide Begriffe beinahe Synonyme, und der Zusammenhang war ebenfalls schon lange vor 1897 bekannt. Dennoch musste sich Stoker noch viktorianische Zurückhaltung auferlegen. Erst in den folgenden Jahrzehnten wich die zurückhaltende, quasi ‚verschlüsselte‘ Darstellung mehr und mehr einer offenen, die Elemente Gewalt und Sex in den Vordergrund stellenden Schilderung. Im 21. Jahrhundert sind die alten Waffen wie Holzpfahl, Knoblauch oder Kruzifix ziemlich stumpf geworden; der Vampir hat sich als alltagstauglich erwiesen. Er (und natürlich auch sie, denn die sexuell befreite Vampirfrau ist eine Figur, die schon früh Eingang ins Genre fand) trägt keinen Frack und keinen rotseiden gefütterten Umhang mehr, sondern passt sich (wie von Simon Clark in „Midnight Hotel“ ebenso kurz wie eindrucksvoll beschrieben) der Gegenwart an, was ihm in einer modernen Menschengesellschaft, die mehr und mehr die Nacht zum Tag macht, erst recht leicht gemacht wird.
_Langes Leben bringt viel Verdruss_
Ist der Vampir mit seinem Dasein zufrieden oder gar glücklich? Schon Dracula ließ den Überdruss durchblicken, den eine einsame Existenz in Nacht und Tod mit sich bringt. Der Hunger bindet den Vampir an den lebenden Menschen, von dem aber noch genug in ihm ist, um zu erfassen, was er verloren hat. Henry Kuttner und Simon Clark bringen es in „Vampir-Abschaum“ auf den Punkt. Ihre Vampire sind in jeder Beziehung Außenseiter. Das untote Leben ist zwar ewig, aber ohne echte Gefühle. Darunter leidet der Vampir, doch seine Versuche, die Isolation zu durchbrechen, bringen nur noch mehr Leid und neuen Tod – entweder über die Menschen (F. Marion Crawford, „Denn das Blut ist Leben“) oder über den Vampir selbst (Brian Hodge, „Die Alchemie der Stimme“). Lester del Rey macht deutlich, dass es eine Heilung nicht gibt. Selbst die Rückkehr ins Leben bringt sie nicht, denn auf dem plötzlich wieder zum Menschen gewordenen Vampir lastet nunmehr die Hypothek seiner Jahre als Blutsauger.
_Wie ‚funktioniert‘ der Vampir?_
H. P. Lovecraft gehört zu den Autoren, die sich Gedanken über eine ‚wissenschaftliche‘ Erklärung für das Vampir-Phänomen machen. Freilich gibt Lovecraft seiner Theorie in „Das gemiedene Haus“ – einer seiner besten Arbeiten, die er quasi dokumentarisch gestaltet und deren Schrecken deshalb umso intensiver wirkt – kein biologisches Fundament. Er geht im Grunde mit Edgar Allan Poe konform, nach dem die menschliche Willenskraft den Vampir ins ‚Leben‘ ruft: eine Kreatur, die den Tod nicht akzeptiert, gegen ihn aufbegehrt, dabei erfolgreich ist und sich doch von der Welt trennt, die sie als Untote erkennt und fürchtet; eine Kluft, die durch die besondere Art der Ernährung verständlicherweise vertieft wird. Poe benötigt keine ‚Erklärung‘; Ligeia kehrt zurück, weil sie es will. Lovecraft zollt dem rationalen 20. Jahrhundert Tribut, auch wenn seine Kombination des vampirischen Scheinlebens mit der Einsteinschen Relativitätstheorie reiner Technobabbel bleibt; manchmal bringt ein Weniger an Information ein Mehr an Faszination. Dem Unterhaltungswert beider Storys tut das freilich keinen Abbruch.
_Vampire sind auch nur (tote) Menschen_
Kann man über Untote lachen? Selbstverständlich, denn Furcht und Witz sind enge Verwandte. Für das Komische ist der Vampir sogar besonders anfällig, gibt er doch eine sehr pathetische Gestalt. Schon ihn in denselben Fallstricken des Alltags zu sehen, von denen auch wir sterblichen Menschen gefesselt werden, nimmt ihm viel von seiner Allmacht. Wie Dracula sich in ein unfreiwilliges Exil begibt, weil er ein amtliches Schreiben zu viel ignoriert, ist zwar kein geistreicher, aber ein gelungener Scherz (Graham Masterton, „Verkehrstote“). Humor auf ungleich höherem Niveau zelebriert Karl Heinz Strobl in seiner gleichermaßen grotesken wie phantastischen Spukgeschichte vom „Aderlassmännchen“, dessen Übeltaten recht oberflächlich fromme Nonnen treffen, sodass sich des Lesers Mitleid in Grenzen hält. Diesen Vampir können übrigens weder Kruzifix noch Sonnenlicht in Schach halten, womit er in dieser Sammlung recht einzigartig dasteht.
_Storysammlung mit Vorbildcharakter_
Gut zusammengestellte Kollektionen mit Kurzgeschichten, die eine Lektüre verdienen, sind heute nicht gerade zahlreich. Obwohl der Horror auch auf den deutschen Buchmarkt zurückgekehrt ist, muss man viel Spreu vom Weizen trennen. Chick-Lit-Horror – glutvoll-brünstiger Vampir verzaubert sexuell und auch sonst frustrierte Menschenfrau – wuchert wie Pestwurz aus der Nische des trivialen Liebesromans, in der er gut aufgehoben war. „Denn das Blut ist Leben“ kommt gänzlich ohne ihn aus, wofür man dem Herausgeber dankbar ist.
Wie für Bücher aus dem |Festa|-Verlag üblich, kommt auch dieses optisch sehr ansprechend daher. Paperback-Format und saubere, stabile Bindung lassen „Denn das Blut ist Leben“ angenehm in der Hand liegen, und selbstverständlich gibt’s als Cover kein liebloses Bildstock-Foto, sondern eine auf das Thema abgestimmte Zeichnung. Die Übersetzungen lesen sich angenehm, und mit diesem Adjektiv lässt sich auch der Kaufpreis umschreiben: So ein Werk verleibt man seiner Sammlung gern ein!
|Originalausgabe
Großformat Paperback 13,5 x 21 cm
416 Seiten|
http://www.FESTA-Verlag.de
Joseph Wambaugh – Hollywood Station
Alltag im Los Angeles Police Department. Auf den Straßen regiert das Chaos, das nur noch verwaltet aber nicht mehr bekämpft werden kann: Seit das LAPD aufgrund einer Serie dokumentierter Polizeibrutalitäten unter staatliche Aufsicht gestellt wurde und die Medien auf weitere Verstöße förmlich lauern, sind den Beamten nicht nur die Schlagstöcke, sondern auch die Hände weitgehend gebunden. Generell herrscht aufgrund permanenter Unterbesetzung und Überlastung Frustration. Der ständige Druck fordert seine Opfer. Dienstmoral und Arbeitsleistung leiden erheblich. Viele Beamte haben quasi innerlich gekündigt. Auf den Straßen wissen die Kriminellen von den Beschränkungen und nutzen die Gelegenheit weidlich aus.
Die drogensüchtigen Kleinkriminellen Farley und Olive Ramsdale haben dem Nachwuchs-Gangster Cosmo Betrossian Informationen über ein anstehendes Diamantengeschäft verkauft. Cosmo überfiel den Händler und will die Beute dem Bandenboss Dmitri verkaufen, was gleichzeitig sein Einstieg ins organisierte Verbrechen von Los Angeles werden soll. Kein Wunder, dass er heftig reagiert, als Farley und Olive ihn plötzlich mit ihrem Wissen erpressen. Zu allem Überfluss geht kurz darauf der Überfall auf einen Geldtransporter zwar erfolgreich aber blutig aus. Panisch versteckt Cosmo die Beute ausgerechnet im Haus von Farley und Olive, deren Ermordung er gleichzeitig plant. Doch die Drogen haben das Paar so paranoid werden lassen, dass sie sich nicht in die Falle locken lassen. Joseph Wambaugh – Hollywood Station weiterlesen
Richard S. Prather – Blaue Bohnen zum Frühstück

Broughton, Rhoda – Geistergeschichten
_Inhalt_
– |“Mrs. Smith von Longmains“| (Mrs. Smith of Lingmains, 1886), S. 7-44: Ein düsterer Traum von kaltblütigem Mord treibt Mrs. Smith trotz eisigen Winterwetters zu einer ungeliebten Nachbarin, doch es wird schwieriger als gedacht, dem Schicksal in den Arm zu fallen …
– |“Bettys Visionen“| (Betty’s Visions, 1886), S. 45-81: Viermal wird Betty in ihrem Leben von Todesahnungen überfallen, die sich als schrecklich zutreffend erweisen; als sie denkt, dass es schlimmer nicht kommen kann, belehrt sie Vision Nr. 5 eines Schlechteren …
– |“Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit“| (The Truth, the Whole Truth and Nothing But the Truth, 1868), S. 82-95: Eine bemerkenswert günstige Mietwohnung in London erweist sich als Wohnstatt eines Wesens, dem man besser nicht begegnet …
– |“Der arme, hübsche Bobby“| (Poor Pretty Bobby, 1872), S. 96-122: Falls etwas schiefgehen sollte auf See, werde er seiner Verlobten auf jeden Fall eine letzte Botschaft übermitteln, verspricht der junge Seemann – und als Mann von Ehre hält er sein Wort …
– |“Sind Träume Schäume?“| (Behold, It Was a Dream, 1873), S. 123-138: Leidlich beruhigt reist Dinah heim, denn sie hat ihre Freunde, die Watsons, erfolgreich vor einem Mörder gewarnt, von dem ihr träumte. Leider ist das Schicksal ebenso einfallsreich wie boshaft und lässt sich gern von voreiligen Menschen die Drecksarbeit abnehmen …
– |Nachwort von S. M. Ellis: „Rhoda Broughton“| (Rhoda Broughton, 1920), S. 139-143
_Einige Anmerkungen zu dieser Sammlung_
Das 19. Jahrhundert ist für die phantastische Literatur eine wichtige Epoche. Die ‚Geburt‘ der Kurzgeschichte bietet ungeahnte Möglichkeiten, Geschichten auf den Punkt zu bringen. Gleichzeitig lässt der Fortschritt von Wissenschaft und Technik das Stellen nie gekannter Fragen zu, deren Beantwortung nur eine Frage der Zeit zu sein scheint. Dazu gehört das uralte Rätsel, ob es ein Jenseits gibt, das bewohnt wird von den Geistern der Verstorbenen, aber auch von fremden oder bösartigen Kreaturen, die in die diesseitige Welt vordringen und den Lebenden Botschaften übermitteln oder Böses antun können. Gibt es eine Verbindung zwischen den Sphären, lässt sich Kontakt aufnehmen, ist es möglich, die Motive von Geistern zu entschlüsseln?
In der bürgerlichen Mittelklassewelt der Rhoda Broughton haben Geister einen festen Platz. Die vergleichsweise forschen Heldinnen glauben entweder bereits an ihre Existenz oder werden nachdrücklich davon überzeugt. Da gibt es etwas, das fremd, aber näher ist, als wir es uns vorstellen können, und es verstört oder schadet uns. Wir erleben womöglich das Wirken von Geistern, doch verstehen können wir sie nicht. Wieso erhalten „Mrs. Smith von Longmains“, Betty („Bettys Visionen“) und Dinah („Sind Träume Schäume?“) Einblicke in die Zukunft? Warnungen sind es nicht, denn unweigerlich trifft ein, was geträumt wurde. Wer steckt dahinter? Es bleibt offen, und für diese Entscheidung ist die Verfasserin zu loben, denn die daraus resultierende Ungewissheit teilt sich dem Leser mit.
Manchmal lassen sich Geister tatsächlich blicken. Auch dann fragt man sich nach dem Sinn ihres Spukens. Seemann Bobby ist seiner Braut kein Trost, als er sie aus seinem nassen Grab zum Abschied besuchen kommt („Der arme, hübsche Bobby“). Sein Geist vermag sich nicht verständlich zu machen und sät nur Schrecken. Völlig ratlos bleibt man über die Natur des Wesens, dass in „Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit“ umgeht. Eine Begegnung raubt den Verstand oder tötet. Die Unbarmherzigkeit dieses Spuks hinterlässt seinen Eindruck beim Leser.
_Eine Fußnote der phantastischen Literatur_
Solche Höhepunkte sind wichtig, denn leider bleiben sie recht rar. Das hier vorgestellte Bändchen sammelt Geschichten, die in Deutschland noch nie veröffentlicht wurden oder längst vergessen sind. Solche Wiederentdeckungen können äußerst reizvoll sein. Oft stellt sich freilich heraus, dass der Staub der Zeit ruhig weiter über ihnen hätte ruhen können. Broughtons Geistergeschichten können heute nur sehr bedingt fesseln. Zu stark sind sie ihrer zeitgenössischen Umgebung verhaftet. Inhalt und Stil sind veraltet, Schrecken sieht heute nicht nur anders aus, sondern wird auch anders entfesselt. Gar zu ruhig geht Broughton ans Werk. Jene andeutungsreiche Zurückhaltung, die Literaturkritiker gerade in der Phantastik so schätzen, ist ein Job für richtig gute Schriftsteller, und zu denen gehört die Verfasserin aus heutiger Sicht nicht. Böse Visionen in Serie oder spukende Liebhaber gab es zudem in den letzten 150 Jahren mehr als genug. Wie der Plot aussehen wird, weiß der Leser des 21. Jahrhunderts sicherlich früher als Broughtons zeitgenössische Leserschaft. Dafür kann sie nichts, aber es sorgt für gewaltige Längen, was einer Kurzgeschichte schlecht bekommt.
Was ihren Unterhaltungsfaktor angeht, kann selbst der an der Historie des Genres interessierte Gruselfan auf die Neuveröffentlichung (oder Exhumierung) von Broughtons Geistergeschichten leider – es muss so deutlich gesagt werden – verzichten. Die Verfasserin mag ein Baustein im Gefüge der Literatur des 19. Jahrhunderts sein, doch zumindest in der Phantastik weist dieser höchstens die Größe eines Kiesels auf.
_Figuren einer viktorianischen Welt_
Eine wirklich interessante Fassette der „Geistergeschichten“ wird die meisten Leser kaum interessieren, da sie mit dem eigentlichen Thema – der Heimsuchung aus dem Jenseits – nichts zu tun hat. Dagegen findet der (Literatur-)Historiker die fremde Welt faszinierend, in der sich Broughtons Figuren bewegen. Auch Unterhaltungsliteratur ist eine Art Spiegel der realen Welt, hier die der ‚besseren Leute‘ der englischen Gesellschaft in der Hochzeit der viktorianischen Ära. Diese wird heute gern als bigotte, prüde, chauvinistische Hölle verdammt, was jedoch ein Pauschalurteil ist. Diejenigen, die sich in die zeitgenössische Gesellschaftsordnung einfügten (und über ein geregeltes Einkommen verfügten), fühlten sich hier durchaus wohl. Broughton macht darüber hinaus deutlich, dass sich die Frauen trotz des in der Rückschau restriktiven Klimas ihre Freiräume schufen und sich nicht auf die Rolle der demütigen Dame des Hauses und Mutter einschränken ließen. Die Autorin lässt sie aus eigenem Willen denken, reden und handeln – und die männlichen Figuren nehmen daran keinen Anstoß, da sie es als selbstverständlich kennen.
Die ältere Rhoda Broughton – wir können es ihrem diesem Band angefügten Nachruf entnehmen – urteilte in dieser Hinsicht deutlich schärfer. Mit dem Fortschreiten des viktorianischen Zeitalters wurde die Schicht der sozialen Verkrustungen dicker; es blieb ihr weder verborgen noch unkommentiert. Die junge Nachwuchsautorin beschränkte sich darauf, ihren eigenen Status in die Charakterisierungen ihrer weiblichen Figuren einfließen zu lassen: Broughton war eine Frau, die unter ihrem eigenen Namen zahlreiche erfolgreiche Romane und Kurzgeschichten veröffentlichte. Das verschaffte ihr eine privilegierte Stellung, denn sie stand auf eigenen Beinen.
_Die Autorin_
Rhoda Broughton wurde am 29. November 1840 in die Familie eines Geistlichen geboren. Schon früh widmete sie sich der in der viktorianischen Epoche für Frauen gerade noch tolerierten Tätigkeit der Schriftstellerei, wobei sie einen gewichtigen Starthelfer an ihrer Seite wusste: Joseph Sheridan Le Fanu (1814-1873), der zu den größten Romanciers des 19. Jahrhunderts gehört – er schuf u. a. die klassische Novelle [„Carmilla“, 993 in der ein weiblicher(!) Vampir im Mittelpunkt steht -, war nicht nur ihr Onkel, sondern wurde auch ihr Förderer. Ersten Kurzgeschichten folgte 1872 der Roman „Red as a Rose is She“, der ihr sogleich literarische Ehren und gute Verkaufszahlen bescherte. 20 weitere folgten, dazu weitere Storys, die Broughton vor allem in den 1880er Jahren zu einer Bestsellerautorin werden ließen. Ihre weiblichen Helden waren gerade das Quäntchen selbstständiger als die üblichen Frauenfiguren, das die zeitgenössischen Leser/innen dulden mochten.
Broughton ließ sich in den 80er Jahren in Oxford nieder, wo sie – mit einer kurzem Zwischenspiel in Surrey – bis zu ihrem Tod am 5. Juni 1920 immer noch aktiv, wenn auch allmählich in Vergessenheit geratend blieb. (Diese biografische Skizze stützt sich auf das Nachwort von S. M. Ellis, welches dem vorgestellten Buch angehängt wurde.)
_Anmerkung_
Als Buch gibt die deutsche Sammlung „Geistergeschichten“ übrigens keinen Anlass zu echter negativer Kritik. Das Paperback ist schön gestaltet und angenehm stabil gebunden; vor allem Letzteres ist leider hierzulande keine Selbstverständlichkeit, gerade im Bereich der Kleinverlage! Die Übersetzer haben sehr gute Arbeit geleistet; ihnen gelang es, die Altertümlichkeit des Stils zu bewahren, ohne die Leserschaft des 21. Jahrhunderts zu überfordern oder abzuschrecken. Auf den Seiten 83/84 blieb ein Steuerzeichen unkorrigiert, das eine längere Textpassage im hellen Graudruck erscheinen lässt – eine Nichtigkeit angesichts der erfreulichen Tatsache, dass insgesamt kaum Druckfehler auftauchen.
http://www.verlag-lindenstruth.de
Zygmunt Miloszewski – Domofon
Brodno ist ein Viertel der polnischen Hauptstadt Warschau, das für seine vielen Plattenbauten bekannt ist. In sozialistischer Vergangenheit rasch und kostengünstig hochgezogen, beginnen sie zu bröckeln und sind im „neuen“ Polen recht unbeliebt, weshalb viele Wohnungen leerstehen. Für das junge Paar Agnieszka und Robert ist das von Vorteil, denn Wohnraum ist billig in diesen Mietshäusern.
Die Freude an der ersten gemeinsamen Wohnung verfliegt indes rasch, denn just beim Einzug wird in einem der Fahrstuhlschächte der Kopf eines Mieters gefunden. Offensichtlich hat der Mann in einem Anfall selbstmörderischer Angst durch das Türfenster kriechen wollen und wurde durch den anfahrenden Fahrstuhl enthauptet.
Agnieszka ist folgerichtig in den nächsten Tagen recht nervös. Das verstärkt sich, als sie Stimmen zu hören beginnt und ein grässlich entstelltes Kinderphantom zu sehen glaubt. Etwas Schreckliches ist offensichtlich in diesem Gebäude geschehen. Leider merkt Robert überhaupt nichts und ist deshalb keine Unterstützung. Zwar erleben auch andere Mieter inzwischen Seltsames, doch es ist ein anonymes Wohnen in diesen Mauern.
Die Erscheinungen nehmen an Intensität und Bedrohlichkeit zu. Schließlich wird es unmöglich, das Haus zu verlassen. Für die Außenwelt scheint es nicht mehr zu existieren. Innen steigt die Spannung. Man ist dem Fremden jetzt ausgeliefert, aber es bleibt mehr als genug Raum für Eifersüchteleien und Zank. Erst allmählich wird deutlich, dass auch dies von der unbekannten Macht geschürt wird. Das Haus verwandelt sich in einen brodelnden Kessel ungezügelter Emotionen, der mit der Zunahme bizarrer Manifestationen überkocht. Die Ursache des Grauens muss gefunden und entschärft werden, doch nur ein alkoholkranker Journalist, ein pubertierender Jungmann und die verängstigte Agnieszka finden die Kraft, sich dieser Herausforderung zu stellen …
Ein „Domofon“ ist eine Wechselsprechanlage. Man findet sie an den Eingängen großer Mietshäuser, wo sie den Mieter im zehnten Stock mit dem Hausgast verbindet, der weit außer Sicht und gesichtslos Einlass fordert. Schon in der Realität ist so ein Gerät also eine fragwürdige Errungenschaft. Zygmunt Miloszewski geht einen Schritt weiter und verwandelt ein ganzes Mietshaus in eine gigantische Relaisstation zwischen der Realität und dem Jenseits. Die Realität vermischt sich mit der Vergangenheit, und Menschen lassen sich von Gespenstern nicht mehr unterscheiden; kein Wunder, ist doch in diesem Haus die Existenz für beide so traurig, dass sie ohne echtes Leben zu vegetieren scheinen.
Miloszewski wollte keinen ’normalen‘ Gruselroman schreiben. Schon die Struktur soll dies deutlich machen. „Domofon“ erzählt keine fortlaufende Handlung, sondern setzt sich aus Fragmenten zusammen. Die Geschichten der Hausbewohner bleiben zunächst so isoliert, wie die Mieter in diesem Plattenbau leben. Hinzu kommen unkommentierte Tonbandaufnahmen, die ein schon abgeschlossenes Geschehen dokumentieren. Erst allmählich setzt sich das Gesamtbild zusammen – eine Möglichkeit, die diffuse Grenzlinie zwischen der Realität und dem Übernatürlichen zu betonen und den Leser in Unsicherheit zu versetzen: Was geht da wirklich vor?
„Domofon“ ist also Horror mit Anspruch, was angesichts der ermüdenden, nie versiegenden Flut flachgründiger Genre-Machwerke vor allem aus dem Angelsächsischen, aber auch aus dem Deutschen zunächst eine erfreuliche Abwechslung verspricht. Allerdings wirkt Miloszewski zumindest übersetzt recht angestrengt und hölzern. Außerdem soll „Domofon“ um jeden Preis Originalität an den Tag legen. Hier ist der Verfasser gescheitert, denn hinter seinen Verfremdungen und stilistischen Experimenten kommen im letzten Drittel, wenn die Auflösung naht, die bekannten Elemente – und Klischees – zum Vorschein.
Besessen vom Bösen; schwarzer Schleim, der durch die Wände schwitzt; Visionen und Erscheinungen; Flüche aus düsterer Vergangenheit – in dieser Hinsicht trifft das auf dem Cover wiedergegebene Zitat zu: „Domofon“ ist eine „klassische“ Horrorgeschichte, und blutig ist sie auch. Wenn der sich schier endlos ziehende, statische Mittelteil endlich überwunden ist, kommt sie sogar in Schwung. Die finale Konfrontation mit dem Bösen ist nicht ohne Reiz, weil es die Erwartungen – im positiven Sinn – enttäuscht. Originell ist es im Kern leider nicht. Das Böse verabschiedet sich zu beiläufig. Warum es einen ganzen Wohnblock terrorisiert hat, um letztlich auf die Erfüllung seiner Rache zu verzichten, bleibt unklar bzw. kann nicht überzeugen.
Die zentralen Figuren eines modernen Unterhaltungsromans zeichnen sich durch Brüche und Schwächen aus. Miloszewski berücksichtigt das nicht nur – er übertreibt es. Zumindest sei die Frage gestattet, ob es in seiner Absicht lag, ’sein‘ Haus ausschließlich mit abstoßenden und unsympathischen Zeitgenossen zu bevölkern, an deren Schicksal der Leser keinerlei Anteil nimmt. Falls diese Frage bejaht werden muss, hat der Verfasser viel zu gute Arbeit geleistet. Genauso treffend ist der Vorwurf, dass er reine Pappkameraden mit einer seelischen ‚Tiefgründigkeit‘ beschreibt, die einer Vorabend-Soap-Serie entliehen wurde.
Viel zu ausführlich beschreibt Miloszewski Figuren, deren Schicksal bald besiegelt ist. Wie sich herausstellt, sind ihre Vorgeschichten in der Regel völlig unerheblich für die eigentliche Handlung. Wieso sich also mit ihnen auseinandersetzen? Schlimmer noch: Personen wie die Polizisten Kuzniecow und Niemiec werden aufwändig eingeführt, um irgendwann einfach aus dem Geschehen zu verschwinden. Dafür erscheint im letzten Drittel ein Allwissender, der die Fäden der Handlung endlich rafft und den Weg ins Finale öffnet.
So belegt „Domofon“ in erster Linie den Ehrgeiz eines noch unerfahrenen Schriftstellers, der einer im Grunde sehr einfachen Geschichte zu viel Ballast aufpackt, es am notwendigen Timing fehlen lässt und sie damit ins Straucheln geraten lässt. Denn „Domofon“ entpuppt sich als ganz normale Gespenstergeschichte, die als solche erzählt werden müsste. Dass sie an einem vergleichsweise ‚exotischen‘ Ort – einer polnischen Vorstadt – spielt, verleiht ihr keinen Bonus, zumal Miloszewski kaum Gebrauch davon macht. „Domofon“ könnte in jedem Wohnblock auf der Welt spielen.
Folgerichtig tritt Miloszewski in einen Wettbewerb mit vielen Autoren, und dabei schneidet er (noch) schlecht ab. Stephen King – und jetzt muss dieser Name doch endlich fallen – hätte „Domofon“ eleganter, weil schwungvoll, ökonomisch und damit effizient über die Runden gebracht. Miloszewski verliert mehr als einmal die Aufmerksamkeit seiner Leser. Um das pseudo-literarische Beiwerk gestrafft, könnte „Domofon“ ein kurzer, aber unterhaltsamer Horrorroman sein. Leider soll er auch ‚intellektuell‘ sein, und das merkt man ihm zu seinem Nachteil an.
http://www.dtv.de
Huxley, Robert (Hg.) – großen Naturforscher von Aristoteles bis Darwin, Die
Vor der Interpretation steht das Recherchieren von Fakten; um ein schlüssiges Gesamtbild zu erhalten, muss die Faktenbasis möglichst breit sein. Das Gesamtbild umfasst in diesem Fall nichts Geringeres als die Gesamtheit der Tiere und Pflanzen auf dieser Erde. Jede Art hat ihren Platz in diesem Gefüge, und ihr Standort gibt Aufschluss über ihren evolutionären Status und (mögliche) Verwandtschaften.
Dieses stammbaumähnliche Konzept beruht auf der Jahrtausende währenden Arbeit von Entdeckern und Forschern. Sie wurde von vielen Sackgassen und Irrtümern begleitet, schritt aber voran, bis sie etwa zur Zeit Charles Darwins eine neue Qualität gewann: Bisher wurde sie von Amateurforschern und Universalgelehrten geleistet, die in der Biologie oder Botanik mindestens ebenso beschlagen waren wie in der Medizin, der Astronomie, der Geologie, der Philosophie und anderen Disziplinen.
In „Die großen Naturforscher“ stehen die Entdecker, die Beschreiber, die Klassifizierer im Zentrum der Betrachtung, die jeweils das ganze Tier oder die ganze Pflanze in Augenschein, später unter die Lupe und noch später unter das Mikroskop nahmen.
Forschung wird und wurde vor allem unter dem Gesichtspunkt der Alltagstauglichkeit ihrer Ergebnisse gewertet. Folgerichtig orientierte sich die Naturforschung, deren Anfänge sich bereits im dritten Jahrtausend vor Christus im Reich der Sumerer feststellen lassen, an den beiden Kategorien „nützlich“ und „schädlich“. So blieb es bis in die Zeit der griechischen Antike, die sich der Materie abstrakter näherte, d. h. die Natur und ihre Lebewesen nach ihrer Gestalt zu ordnen begann. Als erster ‚richtiger‘ Naturforscher gilt Aristoteles (384-322 v. Chr.), dem weitere wissensdurstige Männer folgten.
Mit dem Niedergang Roms endete diese Phase der aktiven Forschung. Während des Mittelalters und in der frühen Neuzeit beschränkte man sich auf das Wissen der Vorväter, zumal nur dieses von der allmächtigen Kirche geduldet wurde. Obwohl auch in diesen vielen Jahrhunderten hin und wieder Zweifel laut wurden, brachte erst die Renaissance die Rückkehr zur echten Grundlagenforschung. Spätestens im 16. Jahrhundert setzte sich die Erkenntnis durch, dass die Zeit überreif für eine Überprüfung, Korrektur und Ergänzung des antiken Wissensschatzes war.
Gleichzeitig begann sich der Akt des Forschens selbst zu verändern. Mehr und mehr setzte sich die Erkenntnis durch, dass ‚am Objekt‘ und möglichst vor Ort studiert werden musste. Ergebnisse sollten nachprüfbar sein, sodass die ersten Sammlungen von Tieren und Pflanzen sowie die ersten Museen entstanden. Hier konnten sorgfältig präparierte Lebewesen auch ohne gefährliche Reisen in ferne Länder untersucht werden. In einem dritten Schritt wurde die bisher vor allem ‚künstlerische‘ Wiedergabe von Forschungsobjekten durch die realitätsbezogene, nüchterne und systematische zeichnerische Abbildung ersetzt.
Das 17. Jahrhundert wird im Abendland das „Zeitalter der Aufklärung“ genannt. Sie brachte vor allem die Trennung zwischen Religion und Naturkunde, die eine objektive Forschung bisher erschwert, oft unmöglich oder – man denke an Galileo Galilei – gar lebensgefährlich gemacht hatte. Jetzt wurden sogar Geistliche zu Forschern, nachdem sie Gottes Geist in seinen Werken zu spüren glaubten.
Ebenfalls im 17. Jahrhundert begann die Arbeit an einer Klassifizierung sämtlicher Lebewesen. Carl von Linné (1707-1778) durchschlug den Gordischen Knoten, aber die Natur war komplexer als gedacht. Es blieb mehr als genug Arbeit für weitere Forscher, die Ausnahmen einer weiter gefassten Ordnung einzupassen.
Die Forscher des 19. Jahrhunderts gingen den nächsten Schritt: Sie suchten nach Erklärungen für das Bild, das sie entworfen hatten. Gelehrte wie Alexander von Humboldt (1769-1859) betrachteten Tiere und Pflanzen nicht mehr isoliert, sondern erkannten die Gesetzmäßigkeiten ihres Zusammenlebens sowie ihre Abhängigkeit von Faktoren des Klimas, der Geologie und der Geografie.
Die klassifizierte Natur musste ihren Ursprung und sich entwickelt haben. Das Konzept der Evolution ließ den Kampf mit der Kirche noch einmal aufflammen. Charles Darwin (1809-1882) wurde unfreiwillig zur Leitfigur dieses Streites.
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts ließen Entdeckungsreisen nie gekannten Ausmaßes und moderne Forschungstechniken den Informationsstrom auf ein Maß anschwellen, das kein einzelner Mensch mehr meistern konnte. Der Amateur und Universalgelehrte wurde abgelöst vom Spezialisten, der sich auf ein ganz bestimmtes Fachgebiet konzentrierte.
„Prachtband“ ist ein großes Wort. Hier darf und muss man es verwenden. „Die großen Naturforscher“ ist ein Buch, das man in die Hand nimmt, darin blättert und sogleich gefangen ist. Schwer liegt es in der Hand, obwohl es kein Überformat und einen Umfang von kaum mehr als 300 Seiten aufweist. Dies bestehen freilich aus dickem, feinporigem Papier, das nicht nur ein wunderbar scharfes Schriftbild garantiert, sondern vor allem die zahlreichen Abbildungen zur Geltung bringt.
Wie ein Relikt aus den ersten Jahrhunderten der Buchdruckkunst wurde „Die großen Naturforscher“ gestaltet. Das Layout orientiert sich an Büchern aus dem 18. oder 19. Jahrhundert. Die mit Text bedruckten Seiten sind gelblich eingefärbt wie ein vergilbter Band aus einem alten und selten benutzten Archiv; nicht einmal Verfärbungen und Flecke wurden vergessen.
Das schwere Kunstdruckpapier kommt freilich vor allem den zeitgenössischen Bildern zugute. Sie stammen aus einer Vergangenheit, die in ihrem Ausklang den Fotoapparat zwar schon kannte, ihn aber nicht verwendete. „Die großen Naturforscher“ ist Zeugnis der großen Zeit der gezeichneten Darstellung von Tieren und Pflanzen. Diese besaß eine Prägnanz, die ihre Werke noch nach den Kriterien der gegenwärtigen Forschung bestehen lässt. Nicht künstlerische Interpretation, sondern die klare Wiedergabe des Tatsächlichen war die Forderung an die Zeichner, Maler und Holzschnitzer der hier wiedergegebenen Werke. Sie haben diese Aufgabe glänzend gelöst und dabei dennoch bestaunenswerte Kunstwerke geschaffen, die heute ungeachtet mancher sachlicher Fehler faszinieren.
Wobei ein besonderer Aspekt dazu beiträgt: Was vor zwei oder drei Jahrhunderten gesammelt und untersucht werden konnte, existiert heute womöglich gar nicht mehr. Viele der in diesem Buch gezeigte Pflanzen und Tiere sind heute dort, wo man sie einst fand, längst nicht mehr heimisch, weil sie durch Überbevölkerung und Umweltverschmutzung verdrängt wurden. Manche wie der Carolinasittich (S. 234) sind inzwischen ausgerottet.
Die einzelnen Beiträge künden von dem langen Prozess der Wissensfindung. Die Naturforschung ist selbst zum Gegenstand der Wissenschaft geworden, stellt doch ihre Geschichte ein Spiegelbild der jeweiligen politischen und geistigen Verhältnisse dar. Sie erschöpfte sich deshalb nie in der Beschäftigung mit offenen Fragen, sondern war immer auch Kampf gegen Aberglaube und Religion, gegen die Gleichgültigkeit derer, die Wissen nur dort interessierte, wo es sich in klingende Münze verwandeln ließ, gegen missgünstige Konkurrenten, denn auch Wissenschaftler waren und sind nur Menschen, die um Rang, Ehre und Fördermittel raufen.
Diese Geschichte ist spannend, denn sie bildet nicht nur einen roten Faden durch die Jahrtausende, sondern hat einen Anfang und ein Ende, auch wenn er nicht straff gespannt verläuft, sondern viele Windungen, Schlingen und sogar Knoten aufweist: Vieles wurde erdacht, ausprobiert und verworfen, manches doppelt oder dreifach gemacht. Aus den Fortschritten wurde ebenso gelernt wie aus den Irrtümern. Dieser Prozess ist heute keineswegs abgeschlossen. Das Leben wird heute als Gefüge ungemein komplexer, miteinander verwobener und nie isolierter Vorgänge akzeptiert, aber keineswegs in allen Details verstanden. Die Reihe der großen Naturforscher wird sich also fortsetzen.
Wer sein Wissen über die Wissenschaftler der Vergangenheit vertiefen möchte, kann sich aus einem umfangreichen Literaturverzeichnis weitere Titel aussuchen. Selbstverständlich gibt ein Register, das ein gezieltes Arbeiten mit diesem Buch ermöglicht, das nur empfohlen werden kann.
http://www.frederking-thaler.de
Arimasa Osawa – Der Hai von Shinjuku: Rache auf chinesisch
Die City Shinjuku gilt als das Herz Tokios. Shinjuku ist auch das kommerzielle Zentrum der Stadt. Das größte Vergnügungsviertel und ein gewaltiger Rotlichtbezirk finden sich hier. Das lockt neben Geschäftsleuten und Touristen aus aller Welt das organisierte Verbrechen magisch an. Viele große und noch mehr kleinere Yakuza-Banden haben Shinjuku unter sich aufgeteilt, schöpfen Schutzgelder ab, waschen Schwarzgeld und führen eigene Restaurants, Bordelle und Spielhöllen.
Dies ist das Revier, in dem Oberkommissar Samejima von der Eingreiftruppe der Direktion Shinjuku sich heimisch fühlt. Der unbestechliche Polizist wurde karrieremäßig aufs Abstellgleis geschoben, nachdem er mehrfach gegen den internen Ehrenkodex verstoßen und gegen korrupte Kameraden ermittelt hat. Statt sich in sein Schicksal zu fügen, setzt Samejima seinen Kampf gegen das Verbrechen entschlossen fort. Man nennt ihn, der sich nicht um die angemaßten Privilegien der Yakuza schert, den „Hai von Shinjuku“. Arimasa Osawa – Der Hai von Shinjuku: Rache auf chinesisch weiterlesen
Algernon Blackwood – Rächendes Feuer. Erzählungen
Ein Kurzroman, zwei längere und zwei kurze Geschichten von Algernon Blackwood, Großmeister der klassischen Phantastik:
– Rächendes Feuer (The Nemesis of Fire, 1908), S. 7-77: In einem englischen Landhaus treibt ein feuriger Elementargeist sein Unwesen. Als die Bewohner den Terror nicht mehr ertragen, holen sie Dr. John Silence, einen Spezialisten für das Übernatürliche, der den wahren und sehr exotischen Ursprung des Grauens offen legt.
– Suspekte Schenkung (A Suspicious Gift, 1906), S. 78-89: Dem armen Schreiberling wird eine gewaltige Geldsumme in Aussicht gestellt, doch die scheinbare Bedingungslosigkeit dieser Gabe erweist sich als Teil eines geschickt eingefädelten, grausamen Plans. Algernon Blackwood – Rächendes Feuer. Erzählungen weiterlesen
McGee, James – Totensammler, Die
Die „Bow Street Runners“ sind Anfang des 19. Jahrhunderts die ersten ‚richtigen‘ Polizisten auf den Straßen von London. Zwar steckt die kriminalistische Arbeit noch in ihren Kinderschuhen, doch Männer wie der ehemalige Soldat und nun Sonderermittler Matthew Hawkwood kennen immerhin schon den Wert von Indizien und wissen, wie man sie deutet.
In diesem Winter des Jahres 1811 führt sein aktueller Fall Hawkwood zum alten Friedhof Cripplegate. Gehenkt und gekreuzigt fand man dort den Körper des Fleischträgers Edward Doyle. Der junge Mann verdiente sich offenbar ein Zubrot als Leichendieb und war dabei Konkurrenten in die Hände gefallen, die nicht lange fackelten. Leichen sind eine begehrte und gut bezahlte, weil immer knappe Ware für angehende Ärzte, die sezieren müssen, um den menschlichen Körper zu verstehen. Deshalb werden Londons Friedhöfe des Nachts von „Auferstehungsmännern“ heimgesucht, die möglichst frische Leichen stehlen.
Ein zweiter Fall führt zur Verzögerung der Ermittlungen. Im „Bethlehem Royal Hospital“, genannt „Bedlam“, dem uralten Irrenhaus der Stadt, hat ein Insasse, der ehemalige Feldchirurg Colonel Titus Hyde, einen Gast, den Reverend Tombs, nicht nur getötet, sondern sein Gesicht gehäutet, bevor er die Flucht ergriff. Nach Auskunft des behandelnden Arztes stellt Hyde eine große Gefahr für die Allgemeinheit dar. Der auf den Schlachtfeldern des englisch-französischen Krieges wahnsinnig gewordene, aber überaus intelligente Mann will in Freiheit ein groteskes ‚Projekt‘ verwirklichen, für das er diverse Frauenkörper benötigt.
Die soll ihm der skrupellose Rufus Sawney beschaffen, der zusammen mit seinem Partner Abel Maggett und den beiden Ragg-Brüdern stets liefern kann. Wie der Zufall (gelenkt durch Verfasser McGee) spielt, steckt Sawneys Bande hinter dem Mord an Doyle, was Matthew Hawkwood auf den Plan ruft. Sawneys Schergen kann er leicht abwehren, doch Hydes Attacken sind ungleich hinterlistiger, zumal der irre Schlächter protegiert wird. Als Hyde damit beginnt, noch lebendigen Frauen nachzustellen, ist der Zeitpunkt gekommen, das Gesetz zu vergessen und zur Gegenattacke anzusetzen …
Die Vergangenheit hat in der Unterhaltungsliteratur viele Gesichter. Bei James McGee sind sie gleichermaßen schmutzig wie blutig. Selten gab es einen Historienroman wie diesen, der sich in Moder, Verwesung und Körperflüssigkeiten aller Art förmlich suhlt. McGees Geschichte spielt nicht im Bauch von London, sondern noch mindestens eine Etage tiefer.
Die hygienischen Probleme Londons im frühen 19. Jahrhunderts beruhen auf Tatsachen. Zwar wuchs die Stadt bereits dem Industriellen Zeitalter entgegen, doch die Infrastrukturen stammten quasi noch aus dem Mittelalter und waren der anschwellenden Einwohnerzahl nicht gewachsen. Niemand fühlte sich zuständig, was auch damit zusammenhing – McGee führt es uns immer wieder vor Augen -, dass dies eine Zeit ohne soziales Netz war. Wer es nicht schaffte, sich einen Platz an der Sonne zu erobern, hatte Pech gehabt und verdiente ein jämmerliches Dasein in den Slums oder gar ein Ende, das durchaus Tod durch Verhungern bedeuten konnte.
In die Sanierung der Armenviertel oder gar in grundsätzliche Maßnahmen zur Besserung des ungeheuren Elends wollten diejenigen, die sich nicht betroffen fühlten, keinen Penny investieren. Armut, Krankheit, Gewalt und Wahnsinn wurden in Bezirke abgedrängt, die zu gewaltigen Ghettos verkamen, in die sich die ohnehin zahlenschwachen und kaum ausgebildeten Stadtwachen nicht trauten.
In dieser Welt, die McGee anschaulich als Hölle auf Erden schildert, ist ein ‚Beruf‘ wie der des professionellen Leichendiebs normal. Wie Rufus Sawney es in klare Worte fasst, ist dieser Job immer noch besser als Sickergruben zu leeren. Drakonische Strafen schrecken nicht, denn permanente Entbehrung und Gewalt stumpfen ab. Das zu verdeutlichen, ist wichtig, denn nur auf diese Weise gewinnt die Handlung ihre Überzeugungskraft: Die von McGee geschilderten Verbrechen können nur im London von 1811 geschehen.
Außerhalb des historischen Umfelds rollt die Geschichte vom psychopathischen, aber genialen Serienkiller ab. Die kennen wir Krimileser zur Genüge (oder bis zum Überdruss), aber im gewählten Rahmen kann McGee den abgegriffenen Plot plausibel aufpolieren: Das Phänomen des Serienmords liegt jenseits des Verständnisses der Zeitgenossen. Den Wissensstand fasst ein ‚Fachmann‘ aus dem Bedlam-Irrenhaus zusammen, und er ist kärglich und steckt voller Trugschlüsse. So kann sich Colonel Hyde schwungvoll ans grausige Werk machen, denn es fehlt das geistige Rüstzeug, ihm in die Parade zu fahren.
Bei nüchterner Betrachtung fällt „Die Totensammler“ nicht durch inhaltliche Originalität auf. Im Grunde weiß der erfahrene Leser, in welche Richtung die Handlung laufen wird. Auch das Finale ist primär grässlich, aber nicht wirklich überraschend. Irgendwann brechen die Ermittlungsarbeiten ab, Hawkwood ruft wie weiland „El Mariachi“ seine bizarren und hochprofessionellen Kameraden zusammen, und dann bestimmt brutale Gewalt die Szene.
Das Zusammenspiel zwischen Krimi und Historienroman ergibt die eigentliche Faszination, wobei McGee sich atmosphärisch ausgiebig beim Horror-Genre bedient. Dunkelheit, huschende Schatten, stinkende Grüfte, bizarre Unterwelten, Splatter, grandiose Bluttaten – die Liste ist lang, und um sie abzukürzen, sei an Filme wie „From Hell“ (2001) oder „The Elephant Man“ (1980, dt. „Der Elefantenmensch“) erinnert, die diese morbide Stimmung in entsprechende Bilder fassen. (Ist übrigens die auf dem deutschen Cover als Matthew Hawkwood abgebildete Person nicht die halbe Silhouette von Johnny Depp in der Titelrolle des ebenfalls im historischen England spielenden Mord-Musicals „Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street“? Vielleicht fallen ja einige Leser = Käufer darauf herein …)
Wie konstruiere ich eine serientaugliche Figur? James McGee zeigt es uns vielleicht ein wenig zu deutlich. Matthew Hawkwood – schon der Name suggeriert Gewicht oder besser Wichtigkeit – ist wie jeder gute (Serien-)Held vor allem einem persönlichen Kodex unterworfen. Zwar arbeitet er gut als „Bow Street Runner“, ohne sich der Institution wirklich verpflichtet zu fühlen. Dem stehen traumatische Erlebnisse im Krieg (gemeint ist der Feldzug Napoleón Bonapartes auf der iberischen Halbinsel 1807-1814, in dem auch englische Truppen den französischen Kaiser bekämpften) entgegen, die Hawkwood an einem System zweifeln lassen, das seine Soldaten auf den Schlachtfeldern verbluten ließ. Auch an der ‚Heimatfront‘ muss er Ungerechtigkeiten schlucken. Definitiv schuldige Männer schlüpfen dem Gesetz durch die Finger, weil sie von hoher Stellung sind. Nur den einfachen Mann und die einfache Frau trifft die Härte der Justiz.
Hinzu kommt eine mysteriöse Vergangenheit, die nur Stück für Stück enthüllt wird und die noch für einige Bände gut sein dürfte. Der wahre Held ist stets auch Außenseiter. So geht Hawkwood immer wieder auf Konfrontationskurs und schont die Reichen und Privilegierten nicht. Glücklicherweise kann er sich auf die Fürsprache seines Vorgesetzten, des Richters James Reed, verlassen, der auf geheimnisvolle Weise das System manchmal unterlaufen kann und seine schützende Hand über Hawkwood hält, der bei aller Ernüchterung ein guter Polizist ist.
Realität ist James McGees Sache nur bedingt. In einem Nachwort klärt er über die realen Hintergründe seiner grotesken Schauermär auf. Leichendiebe, die nicht nur Tote stahlen, sondern sie sogar zu Seife verkochten, wenn sie allzu ‚reif‘ wurden, sind demnach nicht auf seinem geistigen Mist gewachsen. Dennoch ist die Häufung absonderlicher Persönlichkeiten natürlich dem Faktor Unterhaltung geschuldet. Im Grunde tritt kein ’normaler‘ Mensch auf. Alle haben sie – gelinde ausgedrückt – ihre Macken. ‚Frankenstein‘ Hyde ist nicht einmal ihr König. Mit Rufus Sawney und seinen Kumpanen ist McGee ein wahres Höllengezücht gelungen. Die Schauerlichkeit ihrer Taten wird geschickt durch die gemütliche Selbstverständlichkeit konterkariert, mit der sie ihrer Tätigkeit nachgehen. Maggett klagt über arbeitsbedingte Rückenschmerzen, und den armen Sawney möchte man manchmal bedauern, wenn er mit tropfigen Leichen durch London irrt und unter der ausgeprägten Dämlichkeit seiner Spießgesellen leiden muss.
Überhaupt schreibt McGee den Humor größer, als man meinen möchte. Das Schwelgen im Unappetitlichen ist dermaßen übertrieben, dass es nur bedingt ernst genommen werden kann. Zwar kippt die Stimmung gern ins wirklich Bitterböse, doch zwischenzeitlich geht es vor allem derb zu. Geistliche sind garantiert Betrüger und noch geiler als der übelste Leichendieb; an Dünkel und Heuchlerei werden sie nur von Politikern und anderen selbst ernannten Stützen der Gesellschaft übertroffen, und Adel verpflichtet zu rein gar nichts.
So bereiten „Die Totensammler“ viel politisch unkorrekten Lesespaß, was immer für ein Sonderlob gut ist. McGee schreibt flott und trotzdem dicht, die deutsche Übersetzung kann Schritt halten, auch wenn die Zahl der durch die Endredaktion – falls es so etwas heute noch gibt – gerutschten Flüchtigkeits- und Rechtschreibfehler unerquicklich hoch ist. Auf ein Neues also – die Reihe wird fortgesetzt, was zur Abwechslung einmal eine gute Nachricht ist.
James McGee wurde als Glen Moy 1950 in eine Soldatenfamilie geboren. Sein Vater war u. a. in Gibraltar, Deutschland und Nordirland stationiert, sodass ständige Umzüge zur Glens Kindheit und Jugend gehörten und eine lebenslange Reiselust weckten. Unstet war auch McGees beruflicher Werdegang. Er arbeitete als Bänker, Journalist und 13 Jahre in der Luftfahrtindustrie. Außerdem schrieb er Buchrezensionen für verschiedene Radiosender.
In den 1980er Jahren schrieb McGee drei Romane, die dem Genre Militär-Thriller zuzuordnen sind. Nach längerer Pause entschied er sich dann für eine Geschichte, die in der Zeit der Napoleonischen Kriege spielte; für diese Epoche hatte er sich seit jeher interessiert. 2006 erschien „Ratcatcher“ (dt. „Der Rattenfänger“), der erste Band einer Serie um den „Bow Street Runner“ Matthew Hawkwood, die Geschichte, Krimi und Horror geschickt mischt.
McGee, über dessen Privatleben wenig bekannt ist, lebt und arbeit in Tenterden in der englischen Grafschaft Kent, wo er einen Buchladen, aber keine Website besitzt.
Die Matthew-Hawkwood-Reihe erscheint in Deutschland im |Wilhelm Heyne Verlag|:
(2006) Ratcatcher (dt. „Der Rattenfänger“) – TB Nr. 47026
(2007) Resurrectionist (dt. „Die Totensammler“)
(2008) Rapscallion (noch kein dt. Titel)
http://www.heyne.de
Matheson, Richard – Ich bin Legende (I Am Legend)
Vor knapp einem halben Jahr wurde die Zivilisation ausgelöscht. Eine weltweit wütende Epidemie hat die Menschen in geistlose, blutgierige Vampire verwandelt, die im Schutz der Nacht durch die leeren Städte streifen. In New York scheint nur Robert Neville überlebt zu haben. Er hat sich in seinem Haus verbarrikadiert, denn die Vampire wissen von seiner Existenz. Allabendlich versammeln sie sich um Nevilles Festung und versuchen einzudringen, denn sie gieren nach seinem Blut. Außerdem wollen sie Rache, denn tagsüber, wenn sie hilflos in düsteren Verstecken liegen, macht Neville Jagd auf sie, um sie zu pfählen und zu töten.
Obwohl er sich seiner Haut zu wehren weiß, beginnt Neville unter dem Stress und der Einsamkeit zusammenzubrechen. In seiner Verzweiflung beginnt er sich abzulenken, indem er die Seuche zu entschlüsseln versucht. Viele Rückschläge machen ihm zu schaffen, aber allmählich erkennt er die Natur seiner Gegner. Kann er womöglich ein Gegenmittel entwickeln und die Vampire in Menschen zurückverwandeln?
Als seine Forschungen das theoretische Stadium verlassen, muss Neville sich unter den Vampiren nach geeigneten ‚Versuchskaninchen‘ umschauen. Seine Aktivitäten bleiben keineswegs unbemerkt, denn nicht alle Untoten haben ihre Intelligenz verloren, und sie sind es leid, sich jagen und töten zu lassen …
Gestalt und Wesen des Vampirs waren seit 1897 quasi in Stein gemeißelt. Bram Stoker hatte in [„Dracula“ 3489 das ‚Wissen‘ um die blutrünstigen Wiedergänger aus Jahrhunderten zusammengetragen und scheinbar das letzte Wort gesprochen. An seiner Darstellung orientierten sich die Autoren, die nach ihm Vampirgeschichten schrieben. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts wurde die Erscheinung eines untoten transsilvanischen Edelmanns im Frack und samtrot gefütterten Umhang zunehmend anachronistisch. Zwei Weltkriege stellten nicht nur für Vampire eine Zäsur dar: Vor allem nach 1945 wurde auch das literarische Grauen ungeschminkt und schmutzig.
Richard Matheson versuchte Anfang der 1950er Jahre den Vampir-Mythos zu aktualisieren. Er war damit weder der erste noch der einzige Autor, aber er war so erfolgreich, dass „Ich bin Legende“ zu einem Klassiker wurde, dessen Rang mit „Dracula“ vergleichbar ist. Es mag blasphemisch klingen, doch Matheson ist womöglich der bessere Schriftsteller. Während Stokers Roman sich bei aller Unterhaltsamkeit als strukturschwach erweist, ist „Ich bin Legende“ ein ökonomisch durchkomponiertes Werk ohne Abschweifungen und Ballast. 200 Seiten genügen Matheson, das gesteckte Ziel zu erreichen. Sogar Stephen King, der dem Mythos 1978 mit „Salem’s Lot“ (dt. [„Brennen muss Salem“) 3831 erneut neues Leben einhauchtet, benötigte mehr als den doppelten Seitenumfang.
Die Handlung ist spannend, obwohl Matheson anders als in den Verfilmungen von „Ich bin Legende“ (s. u.) kein besonderes Gewicht auf die Darstellung einer verödeten, menschenleeren Welt legt. Das Geschehen spielt sich vor allem in und um Nevilles zur Festung umgebautem Haus ab. Geschickt bringt Matheson den Untergang der Menschheit in eingeschobenen Rückblicken zur Sprache. Diese bleiben Fragmente, aus denen sich der Leser sein eigenes Bild von den Ereignissen schaffen muss.
Große Mühe macht sich Matheson damit, den Vampir-Mythos ‚wissenschaftlich‘ zu begründen. Er verhehlt dabei nicht die Schwierigkeit, möglicherweise biologische Aspekte – Blutdurst, Sonnenlicht-Phobie, relative Unverwundbarkeit – mit eher psychologischen Elementen – Angst vor dem Kreuz und vor Spiegeln, Tod durch Pfählen, Schlaf in Graberde – in Einklang zu bringen. Mit einigen Tricks gelingt es, doch stellt sich – typisch für Matheson – heraus, dass Neville seine Kenntnisse rein gar nichts nützen.
„Ich bin Legende“ bleibt vor allem auch deshalb im Gedächtnis haften, weil die Vampire die meiste Zeit nur eine Nebenrolle spielen. Im Mittelpunkt steht die Geschichte des letzten Menschen auf Erden. Auch das ist kein Sujet, das Matheson erfunden hätte; schon Mary W. Shelley, die den [„Frankenstein“ 2960 schuf, schrieb 1826 den Roman „The Last Man“ (dt. „Verney, der letzte Mensch“). Die Leiden und Erlebnisse des Robert Neville wurden durch die ernüchternden Erfahrungen des II. Weltkriegs geprägt. Er droht nicht nur an der Einsamkeit zu zerbrechen: Ihn bedrückt auch die ‚Schuld‘ des Überlebenden, der sich fragt, wieso gerade er verschont blieb.
Deutlich angesprochen wird auch der sexuelle Notstand. Er bringt Neville mehrfach in Situationen, die ihn ganz und gar nicht wie einen klassischen Helden wirken lassen; nicht umsonst betont der Verfasser seine seltsame Vorliebe für das Pfählen. Auch fragt sich sogar Neville selbst, wieso er für seine Untersuchungen und Versuche stets weibliche Vampire wählt.
Generell scheut Matheson nie davor zurück, die inneren Nöte Nevilles deutlich werden zu lassen. Er ist ein Mensch mit Schwächen, der sich der Herausforderung stellt, wenn und weil ihm keine Alternative bleibt. Das gelingt nur allmählich. Zunächst benimmt sich Neville zunehmend irrationaler, verfällt zeitweise dem Alkohol, zeigt selbstmörderische Tendenzen. Eine der anrührendsten Szenen zeigt ihn im unermüdlichen Versuch, die Freundschaft eines streunenden Hundes zu gewinnen. Sein Überlebenswille ist letztlich siegreich, aber Neville zahlt einen hohen Preis.
Mathesons Roman umfasst einen Zeitraum von drei Jahren. In dieser Spanne entwickelt sich Neville deutlich weiter. Er überwindet seine Trauer, seine Ängste und seine Einsamkeit, lernt sich mit seinen Seelennöten zu arrangieren. Scheinbar findet er seinen Frieden und seine Nische in der veränderten Welt. Tatsächlich ist dies seine größte Täuschung. Die Natur heilt sich selbst, was den Menschen einschließt. Neville verfügt nicht über das intellektuelle Potenzial, um zu erkennen, dass die Vampire die Zukunft der Menschheit darstellen, weil sie sich ebenfalls verändern, sich anpassen und den Grundstein einer neuen Zivilisation legen. Plötzlich ist Neville der Anachronismus – der ‚Mensch‘, hat die Rolle des „Vampirs‘ eingenommen, der die Gemeinschaft heimsucht. Neville wird zur gefürchteten Legende, die dem Neubeginn im Weg steht: Dies ist das starke, weil konsequente, das übliche Happy-End aussparende Finale.
|“Ich bin Legende“ im Film|
Obwohl Richard Matheson zu den Großmeistern der Phantastik gehört, wird sein Werk in Deutschland schmählich vernachlässigt; ein Schicksal, das er mit viel zu vielen anderen Autoren teilt. Seine klassischen Titel werden manchmal aufgelegt, wenn eine Neuverfilmung ansteht. Glücklicherweise ist das oft der Fall, da zumindest in den USA Mathesons Qualitäten als Erzähler spannender Geschichten mit Niveau gewürdigt werden.
„I am Legend“ wurde bereits dreimal verfilmt. „The Last Man on Earth“ war 1964 ein eher trashiger Streifen, inszeniert vom nicht weiter bekannt gewordenen italienischen Regisseur Ubaldo Ragona. Dieser Film kann durch die Besetzung der Hauptrolle mit dem wie üblich hervorragend aufspielenden Vincent Price einen gewissen Unterhaltungswert beanspruchen.
Das Remake von 1971 gehört zu den Klassikern des phantastischen Films: Charlton Heston spielte unter der Regie des Routiniers Boris Sagal den „Omega Man“. Vor allem die grandiosen Szenen in einem menschenleeren New York blieben im Gedächtnis. Sie inspirierten sichtlich die [Neuverfilmung]http://www.powermetal.de/video/review-1376.html von 2007, die einen in seiner Rolle nicht unbedingt bemerkenswerten Will Smith präsentierte und Tragik mit Pathos gleichsetzte, was beides offenkundig den Geschmack des aktuellen Publikums traf; „I Am Legend“ gehörte zu den Blockbustern des Jahres und führte – hier schließt sich der Kreis auf erfreuliche Weise – zur Neuausgabe der gedruckten Vorlage.
|Das Buch mit dem Bonus|
„Ich bin Legende“ ist nicht das übliche „Buch zum Film“. Erfreulicherweise griff man für die Übersetzung auf die Fassung von 1995 zurück, die nicht nur den Roman, sondern zehn Kurzgeschichten enthält:
– Verborgene Talente („Buried Talents“, 1987), S. 208-217: Sein Leben lang hat der alte Mann auf dem Rummelplatz seine Kunden betrogen – jetzt legt er sich mit dem Falschen an …
– Der unlängst Verschiedene („The Near Departed“), 1987), S. 218-220: Ein umsichtiger Mörder regelt die Bestattung des Opfers, bevor er zur Tat schreitet …
– Beute („Prey“, 1969), S. 221-239: Die dämonisch beseelte Puppe eines afrikanischen Jägers bringt erst Schrecken und dann Tod in eine amerikanische Durchschnittsfamilie …
– Hexenkrieg („Witch War“, 1951/1979), S. 240-247: In einem zukünftigen Krieg werden die Schlachten unter Einsatz magischer Kräfte geschlagen …
– Totentanz („Dance of the Dead“, 1954/1982), S. 248-269: Manche Zombies können tanzen, aber gewisse unschöne Angewohnheiten legen sie deshalb keineswegs ab …
– Ein weißes Seidenkleid („Dress of White Silk“, 1951/1979), S. 270-276: Mama ist nicht ganz von dieser Welt, und ihre Tochter kommt sehr nach ihr …
– Irrenhaus („Mad House“, 1952/1980), S. 277-323: Dieses Haus ist eine Batterie des Bösen, und sein Bewohner, ein Wüterich, lädt es auf – bis zum Bersten …
– Die Bestattungsfeier („The Funeral“, 1955/1983), S. 324-336: Geschäft ist Geschäft, und so arbeitet Bestatter Silkline auch für Vampire und andere Kreaturen der Nacht …
– Aus dem Schatten („From Shadowed Places“, 1960/1988), S. 337-368: Wer den Fluch eines bösartigen Zauberers zu brechen versucht, riskiert mehr als das eigene Leben …
– Von Mensch zu Mensch („Person to Person“, 1989), S. 369-398: Ist es klug, ein Gespräch entgegenzunehmen, wenn das Telefon nur in deinem Kopf existiert …?
Diese Storys zeigen Matheson als professionellen Geschichtenerzähler, der sich wenig um Genregrenzen kümmert und dessen kurze Werke erstaunlich oft ein erstaunliches Niveau erreichen. „Der unlängst Verschiedene“ und „Die Bestattungsfeier“ sind strikt auf die Schlusspointe ausgerichtet – gelungene Späße, die auch heute noch ankommen. „Beute“ und „Aus dem Schatten“ bieten klassische Action voller Spannung und Tempo. Diese Storys sind zeitlos und werden immer ihre Leser finden, auch wenn sich über Mathesons Interpretation der weiblichen Psyche inzwischen eine ordentliche Staubschicht gelegt hat …
Die verbleibenden sechs Geschichten sind kleine Meisterwerke des Mysteriösen. Sie lassen auch dem Laien deutlich werden, dass es ohne Richard Matheson womöglich keinen Stephen King geben würde. „Ein weißes Seidenkleid“ oder „Von Mensch zu Mensch“ klingen wie von King verfasst und sind doch schon vor vielen Jahrzehnten entstanden. Tatsächlich prägte Matheson ganze Generationen junger Schriftsteller, die genau erfassten, was sein Werk auszeichnet: Bemerkenswerte Ideen werden nicht von Figuren durchgespielt, sondern von Menschen aus Fleisch und Blut durchlebt und durchlitten.
Matheson beeindruckt durch seine Fähigkeit, Gefühle wie Angst, Zorn oder Verzweiflung förmlich greifbar werden zu lassen. „Irrenhaus“ ist ein einziger Parforceritt durch Seele und Hirn eines haltlosen Cholerikers, der den eigenen Launen ebenso hilflos ausgeliefert ist wie seine Mitmenschen. Ähnlich genial ist „Von Mensch zu Mensch“, wenn Matheson uns über die gesamte Distanz in derselben Angst und Unsicherheit schweben lässt wie seinen unglücklichen Protagonisten. „Hexenkrieg“ lebt von dem Kontrast zwischen detailliert geschilderten Gräueln und den ‚unschuldigen‘ Mädchen, die diese mit der unbekümmerten Grausamkeit ihrer Jugend entfesseln.
„Verborgene Talente“ gehört zu denjenigen Geschichten, die ihre Leser ratlos zurücklassen und langes Nachdenken erfordern, um den Subtext zu entschlüsseln. Die endgültige Interpretation bleibt ihm überlassen. In „Totentanz“ setzt Matheson trügerisch vordergründige Gruseleffekte ein und lässt den eigentlichen Schrecken fast zwischen den Zeilen verschwinden.
Klappt man dieses Buch nach der Lektüre zu, weiß man genau, wieso Richard Matheson in der Phantastik einen Spitzen- und Ehrenplatz einnimmt: als Schriftsteller und als Quelle der Inspiration für viele andere Autoren, die sein Werk studiert und verinnerlicht haben, um es fortzusetzen und weiterzuentwickeln.
Richard Burton Matheson wurde am 20. Februar 1926 in Allendale (US-Staat New Jersey) geboren. Er studierte Journalismus an der University of Missouri, arbeitete jedoch hauptberuflich als Schriftsteller. Die nach dem II. Weltkrieg erneut boomende Magazin-Szene bot einem schnellen und professionellen Autoren kein üppiges, aber ein ausreichendes Auskommen. Matheson lernte rasch, sich diesem Markt anzupassen. Schon 1950 gelang ihm mit der Story „Born of Man and Woman“ (dt. „Menschenkind“), veröffentlicht im „Magazine of Fantasy & Science Fiction“, der Durchbruch. Matheson machte sich einen Namen durch das Geschick, mit dem er die Genres SF und Horror miteinander kombinierte. Sein Romanerstling wurde 1953 jedoch ein Krimi („Fury on Friday“). Auch diverse Western-Storys hat Matheson veröffentlicht.
1954 erschien „I Am Legend“ (dt. „Ich, der letzte Mensch“ bzw. „Ich bin Legende“), 1956 „The Shrinking Man“ (dt. „Die unglaubliche Geschichte des Mr. C.“), 1958 „A Stir of Echoes“ (dt. „Echos“). Mit diesen drei Romanen zementierte Matheson seinen Ruf. Sie wurden sämtlich verfilmt. Zu „The Shrinking Man“ schrieb er selbst das Drehbuch und fasste auf diese Weise auch in Hollywood Fuß. In den nächsten Jahrzehnten bereicherte er die Kino- und Fernsehwelt mit innovativen Drehbüchern, für die er zahlreichen Preise einheimsen konnte. In den 1990er Jahren konzentrierte sich Matheson wieder stärker auf seine schriftstellerische Arbeit und legt seither wieder regelmäßig neue Romane vor. Seit 1951 lebt er in Kalifornien.
http://www.heyne.de
http://wwws.warnerbros.de/iamlegend/
|Richard Matheson auf Buchwurm.info:|
[„Echoes – Stimmen aus der Zwischenwelt“ 505
[„Die seltsame Geschichte des Mr. C“ 1203
[„Das Höllenhaus“ 2504
[„Der letzte Tag“ 3386
Hill, Joe – Black Box
In 15 Kurzgeschichten plus einer Novelle präsentiert Joe Hill, der neue Stern am Horror-Himmel, ein breites Themenspektrum:
Vorwort (von Christopher Golden): S. 7-11
Danksagung: S. 12-20
– _Best New Horror_ („Best New Horror“), S. 21-55: Man sollte meinen, niemand könne die Tücken psychopathischer Irrer besser erkennen als Herausgeber harter Horrorstorys, doch auch sie sind vor Betriebsblindheit keineswegs gefeit …
– _20th Century Ghosts_ („20th Century Ghosts“), S. 45-84: Das schöne Mädchen liebte Filme über alles; es mag selbst im Tod nicht von diesem Hobby lassen, hätte aber schrecklich gern einen Partner, der ihre Einsamkeit teilt …
– _Pop Art_ („Pop Art“), S. 85-118: Freundschaft ist ein seltenes und oft vergängliches Gut; du lernst diese Lektion besser schnell, wenn dein bester Kumpel eine lebendige Gummipuppe ist …
– _Der Gesang der Heuschrecken_ („You Will Hear The Locust Sing“), S. 119-147: Ein von der Gesellschaft geächteter junger Mann verwandelt sich in ein riesiges Insekt und kann es seinen Peinigern endlich heimzahlen …
– _Abrahams Söhne_ („Abraham’s Boys“), S. 148-177: Dies ist die wahre Geschichte des Abraham van Helsing, der sich für einen großen Vampirjäger hält und doch nur ein Psychopath ist, der seine Familie terrorisiert …
– _Besser als zu Hause_ („Better Than Home“), S. 178-205: Auf dieser Welt haben Außenseiter wenig zu lachen, und so sollte man einen Ort haben, an den man vor den ‚Normalen‘ flüchten kann …
– _Das schwarze Telefon_ („The Black Phone“), S. 206-240: Serienkiller Albert entführt ein Kind zu viel – nämlich eines, das mit dem „zweiten Gesicht“ begabt ist und sich von den früheren Opfern des Kidnappers zwecks Gegenattacke beraten lassen kann …
– _Endspurt_ („In The Rundown“), S. 241-262: Kein Geld, den Job verloren und auch privat in der Sackgasse gelandet, aber Prolet Wyatt muss lernen, dass es immer noch schlimmer kommen kann …
– _Das Cape_ („The Cape“), S. 263-293: Verlierer Eric entdeckt ein Talent bei sich, das ihn zu etwas Besonderem macht – die ideale Gelegenheit, es allen zu zeigen, die ihn als Trottel behandelt haben …
– _Ein letzter Atemzug_ („Last Breath“), S. 294-307: Der alte Arzt sammelt die letzten Atemzüge von Menschen, und er hält seinen Aufzeichnungsapparat stets bereit …
– _Totholz_ („Dead-Wood“), S. 308-309: Bäume sind Lebewesen, und deshalb kommen auch sie manchmal als Geister zurück …
– _Witwenfrühstück_ („The Widow’s Breakfast“), S. 310-324: Im Jahre 1935 bringt der Tod einem Landstreicher endlich auch einmal ein wenig Glück …
– _Bobby Conroy kehrt von den Toten zurück_ („Bobby Conroy Comes Back From The Dead“), S, 325-357: Bei den Dreharbeiten zu einem Zombie-Film entdeckt Bobby die verschollene Liebe seines Lebens und ergreift die Initiative …
– _Die Maske meines Vaters_ („My Father’s Mask“), 358-392: Im Blockhaus findet ein teuflischer Handel statt, aber worum es genau geht, wird Jack nie genau erfahren …
– _Die Geretteten_ („The Saved“), S. 393-420: Der Versuch eines geschiedenen Vaters, seine Tochter zu besuchen, endet als Familiendrama …
– _Black Box_ („Voluntary Committal“), S. 421-498: Morris baut Pappkisten-Burgen, in die man hineinschlüpfen, aus denen man aber manchmal keinen Ausgang finden kann …
Anmerkungen („Story Notes“), S. 499-510
Das Leben ist ein gefährliches Abenteuer, und gleich um die Ecke kann stets das Verhängnis auf dich lauern. Eine bittere Erkenntnis ist dies, aber realistisch, wenn man Joe Hill Glauben schenken möchte, was abzulehnen schwerfällt, da er sie so überzeugend in Worte zu fassen versteht.
Die hier gesammelten 15 Storys und eine Novelle stellen einen Überblick zum noch schmalen Gesamtwerk von Joe Hill dar, der längst nicht ’nur‘ moderne Horrorgeschichten schreibt. Die „Black-Box“-Geschichten lassen sich in drei Kategorien gliedern.
„Besser als zu Hause“, „Endspurt“, „Witwenfrühstück“, „Bobby Conroy kehrt von den Toten zurück“, „Die Geretteten“ kommen ohne Elemente der Phantastik aus. Sie stellen Momentaufnahmen aus den Leben von Menschen dar, die in einer Krise stecken. Außenseiter sind Hills ‚Helden‘, die entweder gänzlich ins gesellschaftliche Aus geraten, oder die wir dabei beobachten dürfen, wie sich am Ende des Tunnels ein Licht auftut. Hill verarbeitet hier unter anderem Teile eines Romans, der in der Depressionszeit der 1930er Jahre spielen sollte, jedoch unvollendet blieb.
Diese Storys werden dem Liebhaber ‚echter‘ Literatur womöglich besser gefallen als dem Horrorfreund. Hier sind die Ereignisse emotionaler und nicht jenseitiger Natur, ohne dass sie dadurch weniger dramatisch wirken. Wie sein Vater Stephen King hat Hill ein Gespür dafür, wie der Durchschnittsmensch denkt, fühlt und handelt. Vor allem sind es keine simpel gestrickten Naturen, die er uns vorstellt, sondern komplexe Charaktere, die durch innere Spannungen und persönliche Probleme quasi vorgezeichnet sind. Ohnehin in einer Ausnahmesituation lebend, geraten sie erst recht vom Regen in die Traufe. Für das allzu Menschliche muss man sich allerdings interessieren, sonst werden diese Geschichten wohl langweilen, zumal Hill sie – es muss gesagt werden – hin und wieder mit Hilfe nur zu bekannter Klischees über die Distanz bringt.
„Pop Art“, „Der Gesang der Heuschrecken“ und „Die Maske meines Vaters“ sind eher groteske als gruselige Geschichten. Vor allem „Pop Art“ ist im doppelten Sinn fabelhaft: Dass Art im wahrsten Sinn des Wortes eine Gummipuppe ist, wird von Hill als absolut normal dargestellt. Niemand fühlt sich in seiner kleinen, aber gar nicht heilen Kleinstadtwelt durch diese Tatsache irritiert. Art, die Puppe, ist der perfekte Außenseiter. Hill projiziert bekannte Formen menschlicher Diskriminierungen auf ihn. Letztlich erteilt er eine Lektion in Toleranz, aber wenigstens ohne erhobenen Zeigefinger auf Gutmenschen-Art.
„Der Gesang der Heuschrecken“ ist eine eigenwillige, man ist geneigt zu sagen ‚amerikanische‘ Interpretation von Franz Kafkas Kurzgeschichte [„Die Verwandlung“. 2395 Wieso sollte die Tatsache, dass man sich in ein menschengroßes Insekt verwandelt, zwangsläufig als entsetzlich empfunden werden? Der Held dieser Geschichte lernt die Vorteile zu schätzen. Er weiß um die Chancenlosigkeit seines Lebens und setzt – ebenfalls sehr amerikanisch – zu einem Amoklauf an, um es erstens seinen Peinigern und zweitens der ganzen Welt heimzuzahlen. Große Macht mag nach Spider-Man große Verantwortung mit sich bringen, aber wer sagt, dass dem automatisch entsprochen wird?
„Die Maske meines Vaters“ ist ein Story ohne nachvollziehbaren Plot. Hill ist stolz darauf, dass ihm genau das gelungen ist, wie er in seinen „Story Notes“ erläutert. Wie so oft teilt sich die Begeisterung eines Verfassers den Lesern nur bedingt oder gar nicht mit. „Was soll das?“ ist eine Frage, die angeblich nur der literarische Prolet stellt, der zu dumm ist, das Gelesene zu ‚hinterfragen‘ und zu ‚entschlüsseln‘. Was ist aber, wenn da zwischen den Zeilen gar nichts steht, sondern einfach nur eine möglichst bizarre und unterhaltsame Geschichte erzählt werden soll? Deshalb ist in diesem Fall eine Anklage wegen forcierten Mythentümeltums und Effekthascherei ebenfalls möglich …
Die verbleibenden Storys der „Black-Box“-Kollektion fallen eindeutiger in die Gattung Horror. Sie erfinden das Genre niemals neu, bringen jedoch einigen frischen Wind durch interessante Ideen sowie eine täuschend kunstlose Umsetzung hinein. Erneut wirken jene Geschichten besonders stark, in denen das ‚Monster‘ nicht aus einem Grab steigt, sondern im Menschenhirn beheimatet ist. „Abrahams Söhne“ nicht nur eine folgerichtige Deutung der Figur des besessenen Vampirhetzers Abraham Van Helsing, sondern noch mehr eine schauerliche Studie des Wahnsinns, der vom Vater auf die Söhne übergeht. Auch in „Best New Horror“ oder „Das schwarze Telefon“ sind die ‚Geister‘ menschlich: Psychopathen und Kindermörder, die wahren Schrecken der Gegenwart!
Weil inzwischen bekannt ist, dass Joe Hill der Sohn von Stephen King ist, kann die Frage nicht ausbleiben, ob sich zwischen Vater und Sohn Verbindungen finden lassen. Die Antwort ist ja – allerdings im positiven Sinn. Hill kann sich wie schon gesagt hervorragend in den durchschnittlichen Zeitgenossen versetzen – in Menschen ohne besondere Eigenschaften, die in der Masse, die sie selbst bilden, normalerweise untergehen, und die im Roman wie im Film über sich hinauswachsen müssen, um ‚interessant‘ zu wirken. Die Fähigkeit zu vermitteln, dass das Schicksal von Joe und Jane Doe auch ohne derartige ‚Nachhilfe‘ faszinieren kann, ist eine seltene Gabe. Für Schriftsteller, die darüber verfügen, ist auf dieser Welt Platz genug, selbst wenn sie verwandt sind.
Wenn es in „Black Box“ eine Geschichte gibt, die auch Stephen King hätte schreiben können, so ist es sicherlich die Titelnovelle. Die seltsame Magie, die sich mit Grausamkeit mischt und „Kindheit“ genannt wird, ist sogar noch schwieriger zu beschwören als ein durchschnittliches Erwachsenenleben. Hier konnte Stephen King seit jeher punkten; ’seine‘ Kinder waren und sind keine Disney-Nervensägen aus der Klischee-Stanze. Hill hat auch diese Fähigkeit geerbt. Deshalb kann er sich ohne Probleme ins Revier seines Vaters wagen, mit dem er doppelt mithalten kann, denn „Black Box“ ist auch vom Plot eine faszinierende Geschichte, die spannend umgesetzt wurde.
Leider hegen Hill und King einen Hang zum Sentimentalen. Das Tragisch-Schreckliche der jeweiligen Handlung wird oft auf den Effekt hin getrimmt. Solche „Oh-je!“-Attitüde wird vor allem dem Zyniker aufstoßen. Zumindest in Hills vom Horror befreiten Storys lässt sie sich auch vom gewogenen Leser nicht durchweg ignorieren. „Black Box“ ist eben doch nicht „die Zukunft der phantastischen Literatur“, wie es auf dem Backcover zu lesen ist, sondern ihre prosaische Gegenwart. Damit kann er sich in einer Szene, die zunehmend von trivialem Reißbrett-Horror und Grusel-Erotik für pubertierende Mädchen bestimmt wird, allerdings leicht und prächtig behaupten.
Joe Hill (eigentlich: Joseph Hillstrom King) wurde 1972 als zweiter Sohn der Schriftsteller Stephen und Tabitha King in Bangor (US-Staat Maine) geboren. Ende der 1990 Jahre begann er selbst zu schreiben. Sein ‚Pseudonym‘ wurde spätestens dann publicitywirksam enthüllt, als er 2007 mit „Heart-Shaped Box“ [(dt. „Blind“) 3842 seinen ersten Roman veröffentlichte, der solche flankierende Werbung durchaus gebrauchen konnte.
Dass Hill über eine eigene Stimme verfügen und ideenreich plotten kann, wenn er möchte, belegte er schon zwei Jahre früher mit der Storysammlung „20th Century Ghosts“ (dt. „Black Box“), für die er diverse Preise gewann (die allerdings im Literaturbetrieb nicht nur in der Phantastik recht inflationär ins Leben gerufen werden).
Über sein Werk berichtet Joe Hill, der mit seiner Familie in New Hamphire lebt, auf seiner Website: http://joehillfiction.com. Dort findet man unter anderem ein neckisches Online-Game namens „The Museum of Silence“, das auf der „Black Box“-Story „Ein letzter Atemzug“ basiert und zur Zuordnung terminaler Schnaufer prominenter Persönlichkeiten auffordert.
http://www.heyne.de
Ellery Queen – Der verschwundene Revolver

Ellery Queen – Der verschwundene Revolver weiterlesen
Child, Lee – Abschussliste, Die
Im Stützpunkt Fort Bird, North Carolina, hat Jack Reacher, Ermittler der Militärpolizei, in der Silvesternacht des Jahres 1989 Bereitschaftsdienst, als ihn sein Chef in ein nahe gelegenes Motel schickt. Dort liegt auf einem schäbigen Bett Zwei-Sterne-General Kenneth Kramer, den beim außerehelichen Sex ein Herzschlag fällte. Da Kramer als Kommandeur der US-Panzertruppe in Europa ein prominenter Mann und außerdem verheiratet war, gilt es, sein peinliche Ende zu vertuschen.
Reacher ist durchaus dazu bereit, doch ihn stört das offensichtliche Fehlen von Kramers Aktentasche. Der General war unterwegs zu einer Tagung und machte offenbar wegen seines Tête-à-têtes eigens einen Zwischenstopp: Er traf sich mit einer in Fort Bird stationierten Offizierin!
Was war in der Aktentasche? Kramers Stabsoffiziere Vassell und Coomer streiten ab, dass womöglich geheime Dokumente verschwunden sind. Als Reacher und seine Kollegin Summer die Witwe des Generals informieren wollen, finden sie diese erschlagen in ihrem Haus vor – ein Einbrecher hat sie getötet, aber nichts gestohlen.
Reacher und Summer halten den beinahe zeitgleichen Tod der Ehefrau nicht für einen Zufall. Vor allem Reacher nimmt an, dass der Inhalt der Aktentasche Anlass dieses Verbrechens war. Sein Verdacht wächst, als ihm der Fall nicht nur entzogen wird, sondern ein plötzlich neu eingesetzter Vorgesetzter offen mit Haft und Schande droht, sollte Reacher nicht Ruhe geben, was diesen freilich erst recht anstachelt.
Ein Komplott beginnt sich abzuzeichnen, und die Spur führt in die obersten Ränge der Militärhierarchie. Das nahe Ende des Kalten Kriegs und der damit einhergehende Truppenabbau werden viele Soldaten und Offiziere ihren Job kosten. Damit wollen sich offensichtlich einige Karrieristen nicht abfinden und die Weichen für eine Militärstruktur stellen, die auf sie nicht verzichten kann.
Für Reacher und Summer beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Ihr ‚Ungehorsam‘ bleibt den Verschwörern nicht verborgen. Sie missbrauchen ihre Macht, um die lästigen Militärpolizisten auszuschalten, haben die Rechnung aber ohne Reacher gemacht, der die Mechanismen des Militärs genau kennt. Immer in Bewegung bleiben, lautet die Devise, und so beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel, das Jäger und Gejagte kreuz und quer durch die USA, nach Deutschland und wieder zurück führt, bis es in der Einsamkeit der Mojavewüste zur bizarren Finalabrechnung kommt …
Wenn eine Serie sieben Bände umfasst, fällt es ihrem Verfasser zunehmend schwieriger, sie nicht nur am Leben zu erhalten, sondern ihr neue Impulse zu geben. Vertrackterweise verlangen dies die Leser zwar, während sie es gleichzeitig hassen, wenn lieb gewonnene Gewohnheiten über Bord geworfen werden.
Sieben Romane füllte Lee Child mit den Abenteuern des Ex-Soldaten Jack Reacher, der ruhelos durch die Vereinigten Staaten reist und dabei immer wieder in die Rolle des einsamen Retters schlüpfen muss. Über seine Vergangenheit erfuhren wir dabei nur wenig, was aber in Ordnung ging, da uns sein Privatleben – seien wir ehrlich – weniger interessierte als Reachers bemerkenswerter Einfallsreichtum im nie zimperlichen Kampf gegen finstere Gestalten.
Nun zeigt uns Child, dass er die ausgefahrenen Geleise verlassen kann, ohne dieses Vergnügen zu schmälern. „Die Abschussliste“ ist ein ‚Prequel‘, das einige Jahre vor „Größenwahn“ (1997), dem ersten Band der Reacher-Reihe, spielt. Reacher ist noch Militärpolizist; wir erleben ihn also zum ersten Mal als ‚ordentlichen‘ Ermittler, was natürlich als relative Einschätzung zu betrachten ist, da der wahre Held zumindest in der Fiktion stets ein Querdenker im Dienst der wirklich guten Sache ist.
Die Abweichung von der üblichen Storyline bekommt Reacher gut. Child versetzt ihn in eine ungewohnte Umgebung, ohne dabei die eigentlichen Meriten der Serie zu vernachlässigen. „Die Abschussliste“ verfügt über einen ausgezeichneten Plot, der sich nur langsam zu erkennen gibt, während die Story sich krümmt und windet, immer neue Richtungen einschlägt und stets für Überraschungen gut ist.
Child beweist, wie erstaunlich gut der Action-Thriller mit dem „Whodunit?“ harmoniert. „Die Abschussliste“ ist eine intensive Lektion in Deduktion. Der Verfasser arbeitet ohne Tricks und doppelten Boden. Immer wieder halten Reacher und Summer ein und listen den Stand der Dinge auf: Der Leser teilt jederzeit ihren Wissensstand. Genau dann, wenn die Theorie zu langweilen droht, geht es in den Außeneinsatz.
Immer in Bewegung bleiben – das ist Reachers Motto. Sein Status als Soldat lässt ihn die ganze Welt wie selbstverständlich als Spielfeld betrachten. „Die Abschussliste“ macht glänzenden Gebrauch von seiner Kulisse. Das Militär der USA stellt einen separaten, buchstäblich uniformen Kosmos dar, der parallel zur ‚zivilen‘ Welt existiert. Eigene Gesetze, Regeln, Traditionen und Eigentümlichkeiten bestimmen ihn, die Child uns nicht nur nahebringt, sondern in den Dienst seiner Geschichte stellt, die nur innerhalb des US-Militärs spielen kann.
Einen wichtigen Aspekt des Plots bildet der Zeitpunkt der Ereignisse. Sie benötigen das Jahr 1990, um der Ungeheuerlichkeit der Verschwörung die richtige Dimension zu verleihen. Child versteht es, das an sich erfreuliche Ende des Kalten Kriegs zwischen den Supermächten USA und UdSSR als Schock darzustellen – für jene nämlich, die den drohenden Krieg nicht als Gefahr für die Welt, sondern als Motor ihrer Karrieren betrachten. Entfällt die Drohung, gibt es keinen Grund mehr für ihre kostspielige Existenz. Das muss sich in unserer globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts zwar jeder Arbeitnehmer gefallen lassen – Child selbst spricht (s. u.) aus eigener Erfahrung -, doch gilt das auch für diejenigen, die an den Schalthebeln der echten Macht sitzen? Der Verfasser entwirft ein Szenario, in dem sich die ‚Verlierer‘ der Geschichte nicht mit ihrem Schicksal abfinden, sondern es abzuwenden suchen. Dass sie sich dabei krimineller Methoden bedienen, ist ihnen einerlei, denn so wie sie es sehen, verdienen sie ihre Privilegien.
Jack Reachers Vergangenheit als Militärpolizist spielt eine große Rolle für die Serie, denn sie erklärt seine kämpferischen Fähigkeiten und die Selbstverständlichkeit, mit der er sie einsetzt. Als Begründung für sein Ausscheiden aus dem Militärdienst wurde bisher die Umstrukturierung der Streitkräfte nach dem Kalten Krieg genannt – Reacher gehörte zu denen, die auf die Straße gesetzt wurden. Dank der „Abschussliste“ wissen wir jetzt, dass er wohl auch deshalb gegangen ist, weil er den Glauben an das Militär verlor, das bis zu den Ereignissen vom Januar 1990 nicht nur sein Arbeitsplatz, sondern seine Welt gewesen war.
Denn Reacher ist nur in seiner Dreifaltigkeit als zur Gewalt bereiter, intelligenter und idealistischer Mann zu begreifen. Die Erfahrung hat ihn zum Realisten gemacht, aber nicht zum Zyniker werden lassen. Sein Sinn für Gerechtigkeit ist stärker als die Angst vor dem Ärger, den wir ’normalen‘ Menschen allzu oft schlucken. Reacher lässt sich nicht beirren. Dafür schätzen wir ihn, und deshalb akzeptieren wir seine dunklen Seiten, denn er trifft diejenigen, die es ‚verdienen‘; so viel Bauchfreude gönnt sich auch der Kopfmensch, der sein schlechtes Gewissen über solche politisch unkorrekten Anwandlungen erstaunlich leicht in Schach halten kann, wenn er so gut unterhalten wird wie von Lee Child.
Wie viel ‚Menschlichkeit‘ verträgt die Figur? Child zeigt es uns unfreiwillig, indem er in diesem Punkt den Bogen überspannt. Während die quasi beiläufige Liebesaffäre zwischen Reacher und Summer ausgezeichnet zu seinem Wesen passt, wirkt der Nebenstrang, der Reachers Abschied von seiner Mutter und das Verhältnis zu seinem Bruder beschreibt, auffällig überflüssig. Jack Reacher benötigt keine Heldenmutter, um als Figur glaubhaft zu sein. Ein Zuviel an privater Information ist wie schon gesagt eher schädlich.
Hätte Child auf die Beziehung zwischen Reacher und Summer verzichten sollen? Sie scheint vor allem ein Klischee zu sein, das ein ‚gemischtes‘ Hauptdarstellerduo erfüllen muss. Bei näherer Betrachtung weicht Child geschickt vom Schema F ab. Reacher und Summer sind ‚Kinder‘ der Armee. Sie kennen nur diese Welt und wurden von ihr geprägt. Beide sind sie unsentimental oder – auch diese Interpretation ist möglich – seelisch abgestumpft. Ihre Affäre ist beiläufig, die Gefühle sind nicht intensiv genug, um das Ende dieses Abenteuers überleben zu können. Das sagt viel über Reacher aus, ohne dass Child es in Worte fassen müsste. Für den weitgehenden Verzicht auf seifenoperliches Beiwerk, das heute allzu viele Thriller wie durch Blähungen anschwellen lässt, ist man ihm unendlich dankbar.
Bis Major Jack Reacher 1997 ausgemustert wird, bleiben nach 1990 noch einige Jahre, in denen er als Militärpolizist ermitteln könnte. „Die Abschussliste“ beweist das Potenzial für eine ‚Sub-Serie‘. Mit „One Shot“ (dt. „Sniper“) kehrt Child aber erst einmal in die Gegenwart zurück.
Lee Child wurde 1954 im englischen Coventry geboren. Nach zwanzig Jahren Fernseh-Fron (in denen er u. a. hochklassige Thrillerserien wie „Prime Suspect“/“Heißer Verdacht“ oder „Cracker“/“Ein Fall für Fitz“) betreute, wurde er 1995 wie sein späterer Serienheld Reacher ‚freigestellt‘.
Seine Erfahrungen im Thriller-Gewerbe gedachte Child nun selbstständig zu nutzen. Die angestrebte Karriere als Schriftsteller ging er generalstabsmäßig an. Schreiben wollte er für ein möglichst großes Publikum, und das sitzt in den USA. Ausgedehnte Reisen hatten ihn mit Land und Leuten bekannt gemacht, sodass die Rechnung schon mit dem Erstling „Killing Floor“ (1997, dt. „Größenwahn“) aufging. 1998 ließ sich Child in seiner neuen Wahlheimat nieder und legt seither mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks in jedem Jahr ein neues Reacher-Abenteuer vor; zehn sollten es ursprünglich werden, doch zur Freude seiner Leser ließ der anhaltende Erfolg Child von diesem Plan Abstand nehmen.
Man muss die Serie übrigens nicht unbedingt in der Reihenfolge des Erscheinens lesen. Zwar gibt es einen chronologischen Faden, doch der ist von Child so konzipiert, dass er sich problemlos ignorieren lässt. Jack Reacher beginnt in jedem Roman der Serie praktisch wieder bei Null.
Aktuell und informativ präsentiert sich Childs Website: http://www.leechild.com.
Die Jack-Reacher-Romane erscheinen in Deutschland im |Heyne|- und im |Blanvalet|-Verlag:
1. Killing Floor (1997, dt. „Größenwahn“)
2. Die Trying (1998, dt. [„Ausgeliefert“) 905
3. Tripwire (1999; dt. [„Sein wahres Gesicht“) 2984
4. Running Blind (aka „The Visitor“, 2000; dt. [„Zeit der Rache“) 906
5. Echo Burning (2001; dt. [„In letzter Sekunde“) 830
6. Without Fail (2002, dt. „Tödliche Absicht“)
7. Persuader (2003, dt. [„Der Janusmann“) 3496
8. The Enemy (2004, dt. „Die Abschussliste“)
9. One Shot (2005; dt. „Sniper“)
10. The Hard Way (2006; noch kein dt. Titel)
11. Bad Luck and Trouble (2007; noch kein dt. Titel)
12. Nothing to Lose (2008; noch kein dt. Titel)
|Anmerkung:|
Eine lobende Erwähnung verdient das Layout der Taschenbuchausgabe. Anscheinend nähert sich die Ära der billigen, lieblos aus Bildstöcken gekramten ‚Titelbilder‘ endlich ihrem längst überfälligen Ende. Der Kartoneinband des Covers weist ein rund ausgestanzter Loch auf, durch das der Blick auf eine separate Fotoseite fällt. Das daraus entstehende Motivensemble ist keineswegs originell, doch es steckt eine Idee dahinter, deren Umsetzung einigen Aufwand erforderte. Er wurde geleistet, was „Die Abschlussliste“ zu einem Buch macht, das man nicht nur gern liest, sondern auch anschaut.
http://www.blanvalet-verlag.de
Marcus Sakey – Der Blutzeuge
Danny Carter und Evan McGann sind im irischen Viertel der US-Stadt Chicago in Armut aufgewachsen. Dort wurden sie die besten Freunde, dort haben sie gemeinsam manches krumme Ding gedreht. Als sie ein Pfandhaus überfielen und vom Eigentümer überrascht wurden, schoss Evan diesen zum Krüppel. Danny floh entsetzt und entkam, Evan wurde geschnappt und zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Dass Danny sein Partner war, verschwieg er vor Gericht.
Während Evan im Gefängnis endgültig verrohte und jegliches Gefühl für Gesetz und Moral verlor, begann Danny mit seiner Lebenspartnerin Karen, ein neues Leben und schuf sich eine Existenz als Leiter eines kleinen Bauunternehmens. Richard O’Donnell, sein Chef, verlässt sich auf Danny, die Arbeiter achten ihn. Danny und Karen denken an die Gründung einer Familie. Marcus Sakey – Der Blutzeuge weiterlesen