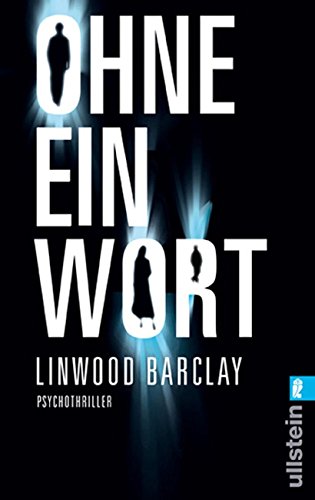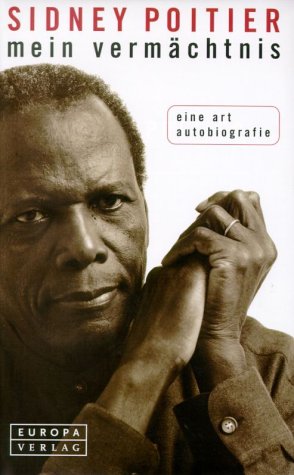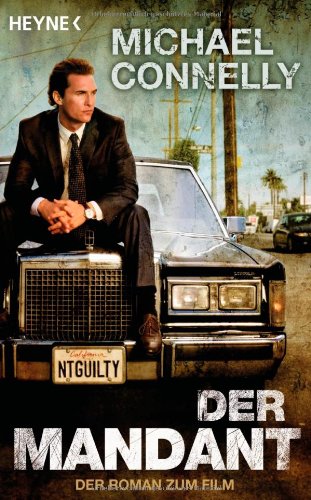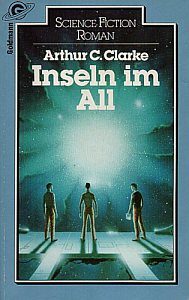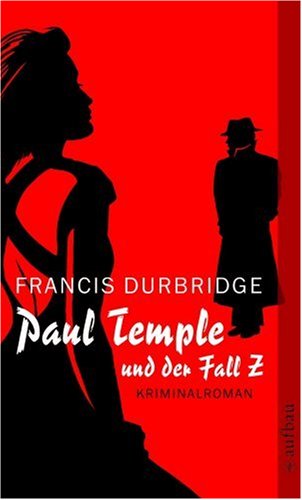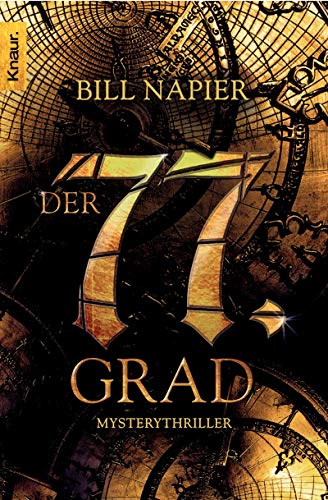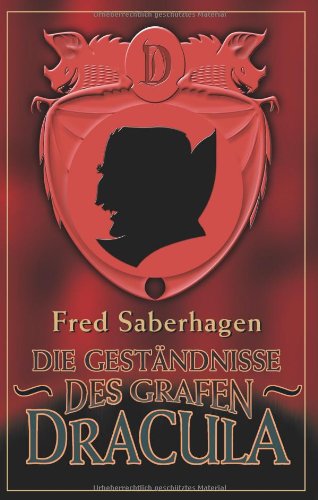Im Mai 1982 endet für die 14-jährige Cynthia die Kindheit. Als sie nach einem verbotenen Partybesuch ins Elternhaus schleicht, findet sie es verlassen. Nichts wurde gestohlen oder verwüstet, nur die Eltern und der ältere Bruder Todd sind spurlos und ohne Gepäck verschwunden. Die Polizei steht vor einem Rätsel, das nie gelöst werden kann. Die Akten werden geschlossen, Cynthia wächst bei Tess Berman, der Schwester ihrer Mutter auf.
25 Jahre später hat Cynthia das Trauma nicht überwunden, obwohl sie inzwischen selbst verheiratet und Mutter einer Tochter ist. Zum Jahrestag des Verschwindens möchte ein TV-Sender den alten Fall aufgreifen. Cynthia ist einverstanden, denn sie hofft auf Hinweise aus dem Zuschauerkreis. Als diese zunächst ausbleiben, engagiert sie den Privatdetektiv Denton Abagnale.
Zunehmend besorgt verfolgt Gatte Terrence Archer, ein Highschool-Lehrer, die Aktivitäten seiner Frau. Ohnehin psychisch labil und in entsprechender Behandlung, wirkt sie zunehmend nervöser. Angeblich verfolgt ein unbekannter Mann sie und Tochter Grace mit einem braunen Auto. Die Präsenz der Eltern will sie ’spüren‘. Doch Terrence unterstützt Cynthia, denn inzwischen hat ihm Tante Tess gestanden, dass ihr einst anonym große Geldsummen zugingen, die sie für Cynthias Studium verwenden sollte.
Woher kam das Geld? Terrence muss erleben, dass sich die mysteriösen Geschehnisse in der Gegenwart fortsetzen. Ein fremder Mann beschattet das Haus der Archers. Auf dem Küchentisch liegt plötzlich der alte Hut von Cynthias Vater. Die Polizei, die zunächst abwiegelt, wird sehr aktiv, als Terrence und Cynthia Tess Berman erstochen in deren Küche finden. Dann verschwindet Detektiv Abagnale.
Eine anonyme Nachricht verspricht die Lösung aller Rätsel auf dem Grund eines aufgelassenen Baggersees. Cynthia verspricht sich viel davon, doch Terrence erkennt, dass der Brief auf seiner eigenen alten Schreibmaschine getippt wurde. Hat seine Frau dies selbst getan? Das würde bedeuten, dass sie sehr wohl weiß, was 1982 geschah, und womöglich selbst dafür verantwortlich ist …
Kein in der Thriller-Geschichte neuer und doch ein starker Auftakt: Eine Familie verschwindet und lässt die Tochter allein zurück, die zu diesem Zeitpunkt sogar im Haus ist. Wie konnte dies geschehen, und was war der Grund? Um genau diese beiden Fragen geht es in den ersten beiden Dritteln von „Ohne ein Wort“. Das eindrucksvolle Prolog-Kapitel sorgt dafür, dass wir nach Antworten gieren und deshalb bei der Stange bleiben.
Das ist wichtig, denn zwischenzeitlich wird der rote Faden verflixt dünn bzw. gerät außer Sicht. Die wichtigen Elemente sind natürlich da: Nach 25-jähriger Rätselei mehren sich die Hinweise auf die Geschehnisse von einst, was selbstverständlich mit ungeahnten Gefahren verbunden ist. Menschen sterben, die Polizei ist misstrauisch, aber nicht besonders helle und verdächtigt prompt die Falschen usw. usf. Trotzdem hat der Verfasser seinen Stoff im Griff.
Der lockert sich, wenn ihn literarischer Ehrgeiz zu reiten beginnt. Weit holt Barcley immer wieder aus, schildert Ereignisse und charakterisiert Figuren, die für das eigentliche Geschehen nebensächlich oder gar unwichtig sind. Die Archers und ihr Leben sollen plastisch wirken, nur sind sie bei nüchterner Betrachtung ziemlich langweilige Gesellen, die sich entweder genau so verhalten, wie wir es uns dachten, oder unseren Langmut durch höchst unlogische Entscheidungen traktieren. (Verzweifelter Ehemann & Vater tut sich mit gutherzigem Mafioso zusammen – also bitte!)
Irgendwann muss die Katze aus dem Sack – für Mystery-Krimis stets ein kniffliger Moment. Die Auflösung ist dem Rätsel nie gewachsen – kann sie auch gar nicht, denn bleibt die Geschichte auf dem Boden der Tatsachen (und vermeidet den Einsatz von Außerirdischen oder Gespenstern), ist die Palette möglicher Erklärungen ziemlich schmal. Barclay weiß das selbstverständlich und versucht dies zu überspielen, indem er das letzte Drittel der Geschichte in ein Action-Drama verwandelt. In dieser Beziehung ist er hoffentlich noch lernfähig, denn was er uns an Deus-ex-Machina-Effekten präsentiert, ist des Schlechten eindeutig zu viel und reizt eher zum Grinsen als zum Mitfiebern.
Eine üble Sünde der Thriller-Gegenwart verdanken wir Jeffery Deaver, dem Erfinder des Doppel- & Dreifach-Twists: Die Geschichte ist eigentlich schon beendet, da springt wie ein Kastenteufel der wahre Unhold aus dem Off und konfrontiert uns mit dem Ätsch-Effekt: Alles war ganz anders! Ob dabei die Logik zum Teufel geht, ist offenkundig unwichtig. Auch in „Ohne ein Wort“ ist der Twist so an den Haaren herbeigezogen, dass es ärgert.
Kleine Ursachen können eine große Wirkung haben. Die Entscheidung, ob dieses Sprichwort greift, muss aktuell getroffen werden, was manchmal nicht leichtfällt. Cynthia hat mit 14 Jahren nicht nur ihre Familie verloren. Viel stärker macht ihr viele Jahre später zu schaffen, dass ihre letzten Worte zu den Eltern „Ich wollte, ihr wärt tot!“ waren. Sie fielen in einem Moment des Zorns, weil besagte Eltern ihr nach allzu exzessiven Partygängen weitere nächtliche Ausgänge gestrichen hatten. So etwas geschieht in diesem Alter fast zwangsläufig und wird deshalb auch von beiden Seiten wieder vergeben und vergessen.
Doch dieses Mal scheint es, als sei Cynthias Wunsch in Erfüllung gegangen. Diese Überzeugung wird prägender für ihr Wesen als das mysteriöse Verschwinden: Cynthia fühlt sich verantwortlich – und das ist der Schlüssel zu ihrem Denken und Handeln. Dass sie nichts mit dem Vorgefallenen zu tun hat und natürlich unschuldig ist, weiß die ‚rationale‘ Cynthia. Doch die Cynthia von 1982 ist quasi lebendig geblieben und zum imaginären Alter Ego geworden, das weiterhin Vorwürfe äußert.
Cynthia ist deshalb psychisch labil und besonders leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen, als sich die Zeichen mehren, dass ihre Familie noch irgendwo existiert. Autor Barclay wärmt dazu leider nur Bekanntes auf: Der eigene Gatte, der ihr doch Stütze sein sollte, zweifelt an ihr, und dann steht Cynthia mit dem Töchterlein allein den Schurken gegenüber, denen sie nur Muttertiergebrüll entgegenschleudern kann, bis endlich Terrence und der verlorene Vater auf der Bildfläche erscheinen und im Bund mit dem Schicksal die Sache klären.
Was Barclay wollte, war die Konfrontation von Durchschnittsmenschen mit einer Krise, die sie zunächst überfordert, um sie dann zu innerer Stärke (und äußerlicher Gewalt) finden zu lassen. Vielleicht sind ihm die Archers allzu ’normal‘ geraten, denn sie nimmt man als Leser bloß in Kauf, während man auf die Lösung des Rätsels wartet.
Auch den Lumpen dieser Geschichte sollte man mit Nachsicht begegnen. Hier liefern sich Bosheit, Dämlichkeit und Lächerlichkeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das unentschieden ausgeht. Die Verschwörung, die Barclay konstruiert, kann zudem nur funktionieren, wenn ihre Opfer in entscheidenden Momenten Bretter vor den Köpfen haben, denn eigentlich müsste sie platzen wie Sommerfliegen auf einer Windschutzscheibe.
Nein, das Beste ist wohl, dieses Buch zu lesen, es spannend zu finden und schleunigst zu vergessen, denn Nachdenken lässt nicht nur den wackeligen Unterbau, sondern auch das Flickwerk erkennen, das den Plot zusammenhält. Wie schon gesagt, schade, aber solche Erfahrungen gehören zum harten Alltag des erfahrenen Krimi-Fans …
Linwood Barclay wurde (in einem sorgfältig geheim gehaltenen Jahr) in den USA geboren. Der Vater, ein Werbegrafiker, ging mit der Familie nach Kanada, als Linwood vier Jahre alt war. In diesem Land, genauer an der Trent University in Peterborough (Provinz Ontario), studierte er Englisch. Hier arbeitete er nach dem Abschluss als Journalist für den „Peterborough Examiner“. 1981 wechselte er zum „Toronto Star“, der auflagenstärksten Zeitung Kanadas und besetzte verschiedene Stellen, bis er 1993 eine Kolumne übernahm, die dreimal pro Woche erschien (und weiterhin erscheint) & in welcher er sich über die seltsamen Seiten des menschlichen Alltags äußert.
1996 veröffentlichte Barclay ein erstes Buch („Father Knows Zilch: A Guide for Dumbfounded Dads“), das auf seinen Kolumnen basierte. In den nächsten Jahren erschienen weitere harmlos-satirische Bücher, bis Barclay 2004 einen ersten (Mystery-)Roman („Bad Move“) um den überdrehten Über-Vater Zack Walker schrieb, dem weitere folgten. „No Time for Goodbye“ (dt. „Ohne ein Wort“) ist sein erstes ‚ernsthaftes‘ Buch.
Humor ist auch auf der Bühne Barclays Geschäft. Er wird gern und oft engagiert, um seine Alltagsgeschichten selbst zu erzählen. Er lebt mit seiner Familie in Burlington, Ontario. Womit er gerade wo auftritt oder worüber er schreibt, meldet Barclay auf seiner Website: http://www.linwoodbarcley.com.
http://www.ohne-ein-wort.de
http://www.ullstein-taschenbuch.de