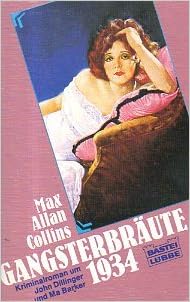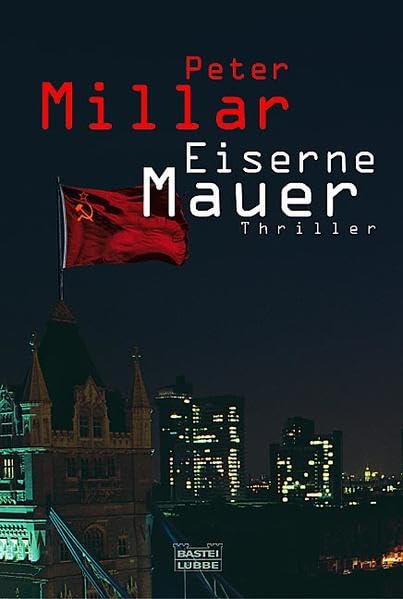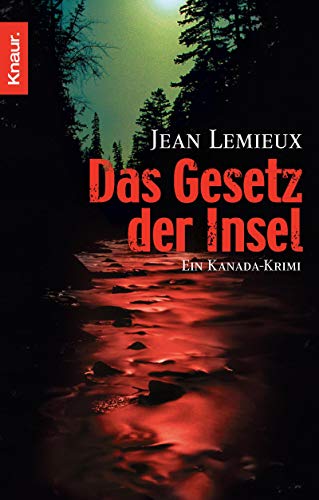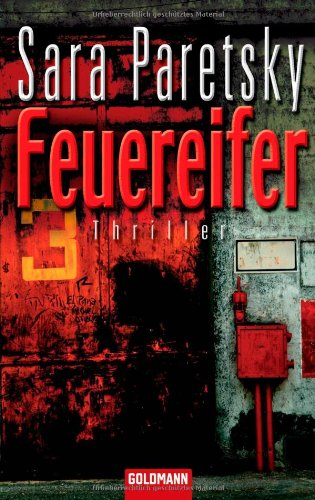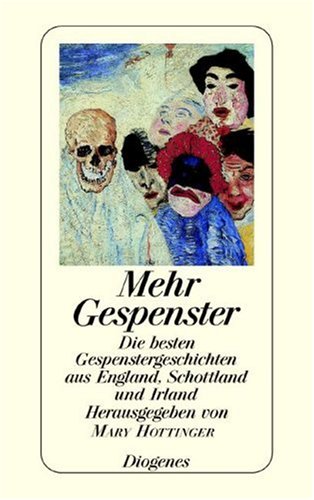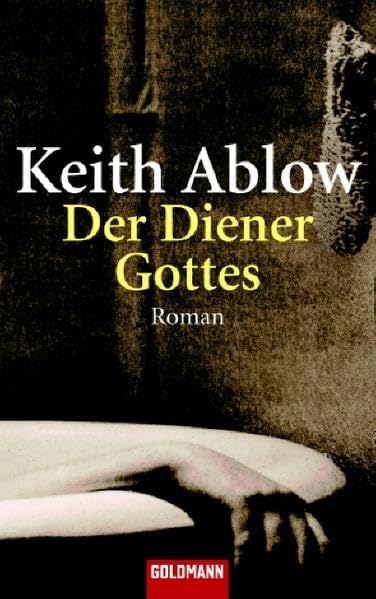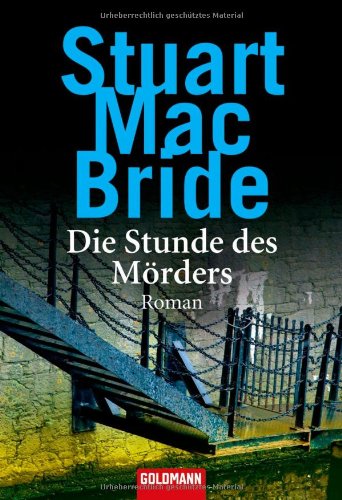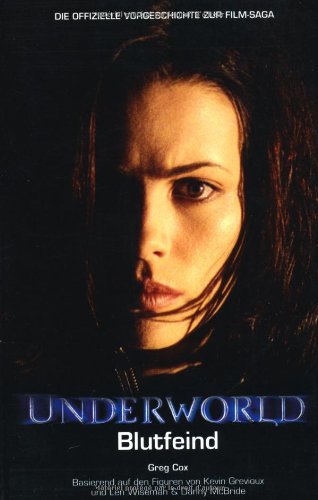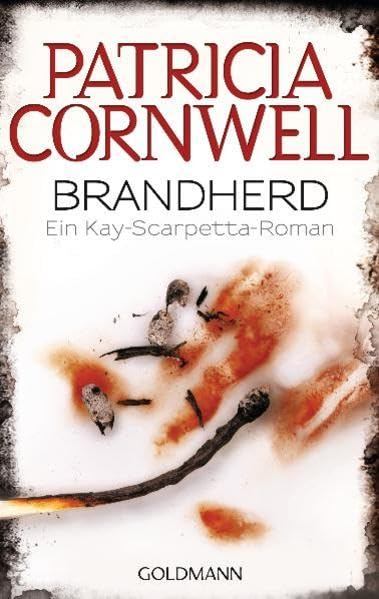
Alle Beiträge von Michael Drewniok
Nick Yapp – True Crime. Die spektakulärsten Verbrechen der Geschichte
– „Banditen und Anarchisten“ (S. 8-35): Die Geschichte des Verbrechens beginnt für Verfasser Yapp offensichtlich erst im 19. Jahrhundert und beschränkt sich auf den Wilden Westen der USA, das revolutionäre Mexiko Emilio Zapatas und Pancho Villas, springt kurz nach Großbritannien, dann zu den US-Desperados John Dillinger und Bonnie & Clyde, um dann im späteren 20. Jahrhundert mit der Baader-Meinhof-Gruppe (!) und der Terrorattacke auf die israelischen Sportler bei den Olympischen Spielen von 1972 auszuklingen.
– „Unrechtmäßiges Geld“ (S. 36-53) in möglichst hohen Summen zu ergaunern, ist das Ziel aller Berufskriminellen, was hier am Beispiel von Schwarzbrennern, Hochstaplern, Trickbetrügern, Finanzjongleuren, Schiebern, Räubern und Aktienschwindlern dargestellt wird. Nick Yapp – True Crime. Die spektakulärsten Verbrechen der Geschichte weiterlesen
Max Allan Collins – Gangsterbräute 1934
Chicago im Sommer des Jahres 1934: Die USA befinden sich weiterhin im Würgegriff der Weltwirtschaftskrise. Auch die Geschäfte von Nate Heller, einem ehemaligen Polizeibeamten, der sich vor einiger Zeit als Privatdetektiv selbstständig gemacht hat, gehen schlecht. Deshalb übernimmt er gern den an sich reizlosen Auftrag, eine des Ehebruchs verdächtige junge Frau zu beschatten – und gerät erneut in eine faule Sache, der das FBI und Chicagos korrupte Polizei ebenso einschließt wie Frank Nitti, der in der Nachfolge Al Capones über das organisierte Verbrechen der Stadt herrscht.
Der Mann, mit dem besagte Dame ihren Gatten tatsächlich betrügt, könnte John Dillinger sein, ein berüchtigter Bankräuber, der sehr erfolgreich der Polizei und dem FBI nicht nur mehrfach entkam, sondern manches saure Schnippchen geschlagen hat. J. Edgar Hoover, Chef des FBI, hat deshalb die Parole ausgegeben: Stellt Dillinger – und legt ihn um! Der „Staatsfeind Nr. 1“ ist damit zum Abschuss freigegeben. Heller will sich an dieser Treibjagd nicht beteiligen, obwohl ihn Nitti, dem er im Vorjahr das Leben gerettet hat, wissen lässt, dass auch er ein gewaltsames Ende Dillingers forciert; der Gangster lässt das Gesetz nervös und übereifrig agieren und stört dadurch Nittis Geschäfte, die keine öffentliche Aufmerksamkeit vertragen. Max Allan Collins – Gangsterbräute 1934 weiterlesen
Millar, Peter – Eiserne Mauer
Was wäre, wenn … die Sowjets 1945 ihren Siegeszug nicht in Berlin abgebrochen, sondern ihn gen West- und Südwesteuropa fortgesetzt hätten? Nicht einmal der Kanal hielt sie auf; der Süden Englands wurde besetzt und 1949 als „Englische Demokratische Republik“ in einen Satellitenstaat der UdSSR verwandelt. 1989 ist London weiterhin eine geteilte Stadt. Der „Antikapitalistische Schutzwall“ trennt den sozialistischen Süden vom kapitalistischen Norden, wo die Gesetze der Demokratie und der freien Marktwirtschaft gelten. In der EDR herrscht dagegen das Elend kommunistischer Planwirtschaft. Groß ist deshalb die Zahl der unzufriedenen „Genossen“, die über den Wall in den Norden flüchten, obwohl sie bei befürchten müssen, dabei den allgegenwärtigen Schergen des „Department of State Security“ (DoSS) – dem Amt für Staatssicherheit – in die Hände zu fallen, das mit Gestapo-Methoden nach „Dissidenten“ fahndet, die dabei spurlos zu verschwinden pflegen, ohne dass jemand nachzufragen wagt.
Harry Stark, Detective Inspector bei der Metropolitan People’s Police, ist ein kleines Rädchen im Getriebe. Normalerweise verfolgt er Straßenräuber, Schläger und andere kleine Fische. Nun fand man unter Blackfriars Bridge hängend die Leiche eines durch den Kopf geschossenen Mannes, dem sämtliche Papiere fehlen. Stark, ein kritischer aber linientreuer Bürger seines Landes, übernimmt den Fall. Sorge bereitet ihm dabei das auffällige Interesse, das DoSS-Colonel Charles Marchmain diesem Fall entgegenbringt; die Aufmerksamkeit des „Großen Bruders“ versucht auch er tunlichst zu vermeiden.
Seine kleine Welt bricht zusammen, als ihn heimlich ein Journalist aus den USA kontaktiert und den Toten als „inoffiziellen Botschafter“ identifiziert, der durchaus mit Billigung des Kremls Stimmung gegen die englische Regierung machen sollte. In Moskau ist eine jüngere Generation an die Macht gekommen, die angesichts des maroden Systems zu einer Lockerung der sozialistischen Zwangsherrschaft bereit ist. Die EDR verweigert allerdings die Gefolgschaft. Auch Stark würde seinen „Gast“ normalerweise festnehmen, aber dieser enthüllt ihm, dass der Vater, angeblich als Held für sein Land gestorben, tatsächlich als „Staatsfeind“ hingerichtet wurde. Für Stark bricht eine Welt zusammen. Nun will er mit denen reden, die angeblich die Wahrheit kennen, doch er weiß nicht, dass Marchmain ihn bespitzeln lässt, um über ihn endlich an den „Englischen Widerstand“ heranzukommen …
Manchmal ist die Geschichte hinter einem Roman wesentlich interessanter als die Geschichte selbst. „Eiserne Mauer“ ist ein Werk, dessen englischsprachiges Original bisher nur übersetzt und in Deutschland veröffentlicht wurde. In England selbst scheint bisher niemand interessiert zu sein. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren. „Eiserne Mauer“ basiert auf einem Plot, der objektiv betrachtet zwar nicht neu, aber dennoch reizvoll ist. Die Rekonstruktion einer „alternativen“ Geschichte auf der Basis historischer Fakten ist ein bekanntes literarisches Genre, dem sich viele Schriftsteller und natürlich Historiker gewidmet haben. „Was wäre geschehen, wenn …“ ist eine Frage, die sich auch der Laie durchaus stellt. Wie sähe Deutschland im 21. Jahrhundert aus, hätte es keinen Hitler gegeben? Oder wäre er 1945 nicht zur Hölle gefahren? Die Variationsbreite entsprechender Spekulationen ist enorm. Entsprechend einfallsreich fallen viele „alternative“ Geschichten aus.
Diese allerdings nicht. Es liegt weniger an der Grundidee, die von einem Europafeldzug der Sowjets Anno 1945 ausgeht. Entsprechende Planspiele gab es im Westen wie im Osten tatsächlich, aber in der Realität haben sich die Sowjets an die Vereinbarungen mit ihren Alliierten gehalten. Der „Eiserne Vorhang“ ging deshalb später in Mitteleuropa nieder und zerschnitt nicht England, sondern Deutschland.
Die spezielle/n Geschichte/n der Bundesrepublik und der DDR dürfte/n der Grund für die deutsche Originalausgabe von „Eiserne Mauer“ sein. In England haben angesprochene Verlage womöglich deshalb abgelehnt, weil Millar gar zu dreist von der Historie abkupferte: Der Verfasser geht von der Prämisse aus, dass die Geschichte des geteilten England bis ins Detail der Geschichte der beiden Deutschland entspricht. Reduziert man „Eiserne Mauer“ auf seine „historischen Fakten“, gewinnt man den Eindruck, Millar habe einfach das Wort „Deutschland“ gegen „England“ ausgetauscht.
Millar findet für die alternative Welt von 1989 keine eigenen Einfälle. EDR („Englische Demokratische Republik“) = DDR (gegründet beide 1949), London/Westminster = Berlin-Ost/Berlin-West, Admirality Arch = Brandenburger Tor, Hardness = Honnecker, DoSS = Stasi/KGB (und Gestapo – für die in England stets publikumswirksame und meist platte Beschwörung der Nazis ist sich auch Millar keineswegs zu fein) – solche „Parallelen“ wirken nicht gerade überzeugend. Von einer echten „Alternativwelt“ mag man kaum reden. „Löwenherz“ Winston Churchill durfte freilich nicht kläglich wie Hitler in seinem vom Feind eingekreisten Bunker enden, sondern durfte jenem schmählichen Komplott zum Opfer fallen, mit dem Millar das weder spektakuläre noch spannende Finale einläutet, dem zu allem Überfluss eine schauerlich missglückte, ironisch und aufmunternd gemeinte Schlusspointe angeklebt wird.
Schade, denn die eigentliche Story vom wackeren Polizisten, der mit einem Fall konfrontiert wird, der nicht nur spannend ist, sondern ihn auch mit der verdrängten Realität eines Unrechtsstaates konfrontiert, lässt sich zunächst gut an. Die sozialistische Tristesse wird vor allem in Klischee dargestellt, doch ihre Inszenierung vor den Kulissen einer Metropole wie London, die ganz und gar nicht in ein sowjetsozialistisches System einpassbar erscheint, ist gelungen. Leider gerät besagter Polizist bald in die Mühlen der SoSS, dann munkeln diverse Geheimbünde in Londons tunnelreicher Unterwelt, und die Geschichte mündet in eine Verfolgungsjagd mit den üblichen vordergründigen Spannungselementen.
Angesichts der bisher (leise) beklagten Flatline des Plots wundert es kaum, dass die Figuren arg geduckt daherkommen. Das liegt nach Millar zum einen an der Diktatur der EDR, in der die Bürger anscheinend stets mit gesenkten Köpfen herumlaufen. Die Hauruck-Dramaturgie von „Eiserne Mauer“ lässt Harry Stark – der Name ist Programm, einprägsam und außerdem filmtauglich – zunächst als linientreuen aber ehrsamen Kommunisten auftreten. Das ist eine wichtige Dopplung, denn es unterscheidet Stark von den nur Linientreuen – unterwürfige Spitzel, grobe Apparatschiks oder teuflisch schlaue, skrupellose Machtmenschen – und den nur Ehrsamen, die stets die Freiheit im Munde führen, dem betonköpfigen Gegner mutig die Stirn bieten und einen schlimmen, aber zur Erschütterung (oder zum Wecken) der Leser notwendigen Tod sterben müssen.
Stark ist dagegen klug, Teil des Systems und dort so gut angesehen, wie das in einem krankhaft misstrauischen Kommunistenstaat möglich ist, wo jede/r jede/n bespitzelt und dem (So)SS Bericht erstattet. Gleichzeitig weiß er nur zu gut, dass viel faul ist in der EDR und dafür nicht die bösen Kapitalistenteufel des Auslands verantwortlich zu machen sind, sondern die eigene Regierung bzw. das besagte System, das einfach nicht funktioniert. 36 Jahre war Stark ein vorbildlicher Bürger. Dann kam Peter Millar ins Spiel, und eine geheimnisvolle Leiche und ein dem Inspector völlig unbekannter Amerikaner reichen aus, um Stark in einen (ziemlich tölpelhaften) Dissidenten zu verwandeln, der seine Odyssee durch eine operettenhafte Unterwelt standhafter Systemkritiker antritt.
Auftritt Colonel Marchmain, der stets tadellos gekleidet Spione jagt. Das Bemerkenswerte an dieser Figur soll offensichtlich aus dem Widerspruch erwachsen, dass dieser Marchmain, den der Verfasser als typischen Fuchs des englischen Geheimdienstes zeichnet, ein Musterkommunist ist, der völlig von sich und seinem Tun überzeugt ist. Anders als Stark kennt Marchmain kein Hinterfragen des Systems. Er gibt nicht einmal vor sich selbst zu, dass dies vor allem deshalb so ist, weil er in seiner Position den planwirtschaftlichen Engpässen enthoben ist und zu denen gehört, die Anweisungen geben, statt sie zu befolgen. Millar lässt für Marchmain nicht den Hauch von Selbstzweifeln zu, was diese Figur in eine Bösewicht-Knallcharge verwandelt, die auch Himmlers SS angehören könnte.
Chargen gibt es viele hinter der „Eisernen Mauer“. Da ist zum Beispiel Kathy, Starks rebellische Schwester, die den unzufriedenen Teenager mimen muss und einfach nicht die Klappe halten will, wie es der besorgte große Bruder rät. Selbstverständlich gerät sie deshalb in Gefahr, was eine völlig überflüssige, weil furchtbar platt aufgelöste Nebenhandlung in Gang setzt. Der „Englische Widerstand“ beschäftigt sich primär mit sich selbst und scheint sich in der Rolle im antiken Rom verfolgten Christen zu sehen; sie verbergen sich im englischen Gegenstück zu den Katakomben, schwärmen durch aufgelassen U-Bahn-Schächte und tagen in uralten Unterwelt-Bunkern. Ihr „Plan“, der die Betonköpfe in der Regierung zum Einschwenken auf Moskaus Tauwetter-Kurs bringen soll, ist von bemerkenswerter Blödheit, was sogar der böse Marchmain merkt, der sie deshalb einfach gewähren lässt.
Viel Aufwand (den Verfasser Millar in einem Nachwort schildert) also, der im Ergebnis nur bedingt zum Tragen kommt. Die banale Alltäglichkeit eines Überwachungsstaates, die viel furchterregender ist als die hier entworfene Scharade, kann und will Millar nicht in Worte fassen. Dazu passt das „offene“ Ende, dem sich eine Fortsetzung problemlos anhängen ließe; wollen wir hoffen, dass uns diese erspart bleibt.
Peter Millar gehört zur Gruppe jener Journalisten, die eines Tages beschließen, die Früchte ihres aufregenden Berufsalltags zu ernten bzw. in blanke Münze zu verwandeln. Wer zu den Brennpunkten der Weltgeschichte reist, ist doch wohl prädestiniert, ein spannendes und glaubhaftes Garn zu spinnen! Millar ist im Auftrag der |Sunday Times| oder des |Evening Standard| durchaus herumgekommen: Berlin, Moskau, Paris, Brüssel listet die Kurzvita des |Bastei|-Verlags als Wirkungsstätten auf. Auch in Osteuropa ist er journalistisch aktiv gewesen. 1992 fasste er seine Erlebnisse während des Mauerfalls in einem Buch mit dem verheißungsvollen Titel „Tomorrow belongs to me: Life in Germany revealed as Soap Opera“ zusammen.
Im Spionagemilieu ließ Millar 2000 auch seinen ersten Thriller spielen. „Stealing Thunder“ (dt. „Gottes Feuer“, |Bastei-Lübbe|-Taschenbuch Nr. 15175) erzählt die übliche Holterdipolter-Hetzjagd zu Wasser, zu Lande und in der Luft, während ein historisch brisantes Rätsel – hier im Umfeld der ersten Atombombe – gelöst werden muss. 2001 folgte der vom Plot ähnlich strukturierte „Bleak Midwinter“ (dt. [„Schwarzer Winter“, 722 |Bastei-Lübbe|-Taschenbuch Nr. 14972); das Buch gehört zweifellos zu den schlechtesten Thrillern, die in diesem Jahrhundert erschienen sind – ein Spitzenplatz, den es noch lange halten dürfte.
Mit seiner Familie lebt Millar in London sowie Oxfordshire. Dort ist er – übrigens ein geborener Nordire – auch aufgewachsen. Sein schriftstellerischer Erfolg scheint sich in Grenzen zu halten – in deutschen Grenzen, wo seine (freundlich ausgedrückt) ökonomisch geplotteten Romane besser anzukommen scheinen als daheim.
http://www.bastei-luebbe.de
Lemieux, Jean – Gesetz der Insel, Das
Im Herbst des Jahres 2001 möchte André Surprenant, Sergent-Détective der Polizei auf Cap-aux-Meules, einer der Madeleine-Inseln vor der Ostküste der kanadischen Provinz Quebec, endlich mit seiner Gattin den längst überfälligen Urlaub antreten. In letzter Sekunde verhindert dies ein Anruf von Roméo Richard, dem reichen Krabbenfischer und Bürgermeister des Nachbarorts Havre-aux-Maisons, der seine Tochter Rosalie vermisst. Die lebenslustige, dem Trunk, dem Hasch und den Männern ein wenig zu sehr zugetane 19-Jährige wurde zuletzt in der Inselkneipe „Caverne“ gesehen. Auf Cap-aux-Meules gibt es keine schweren Verbrechen, so dass Surprenant die Suche ohne Hilfe „vom Festland“ aufnimmt; auf der Insel regelt man die Dinge gern unter sich.
Dann wird Rosalie gefunden – geschändet, erwürgt und mit gebrochenem Genick hat sie ihr Mörder zurückgelassen, den nackten Körper „verziert“ mit Muschelschalen. Das Bundeskriminalamt setzt dem Sergent-Détective einen „Spezialisten“ vor die Nase. Denis Gingras ist ebenso berühmt für seine Erfolge als Ermittler wie berüchtigt für seine Arroganz. Auf Cap-aux-Meules lässt er Surprenant und dessen Beamte spüren, dass er sie für inkompetent hält. Als er den geistig verwirrten Damien Lapierre aufstöbert, der vor Jahren für einen Mädchenmord verurteilt wurde, hält er den Fall für gelöst. Dass Lapierre hartnäckig leugnet und die Indizien getürkt wirken, ignoriert Gingras.
Surprenant kennt „seine“ Insel und ihre Bewohner. Er spürt, dass Lapierre nicht der Mörder ist. Vom argwöhnischen Gingras hart gedeckelt, beginnt Sergent mit eigenen Nachforschungen. Er stößt hinter den Kulissen der scheinbar verschlafenen Gemeinde auf ein kriminelles Wespennest. Das organisierte Verbrechen nistet sich auf den Madeleine-Inseln ein. Schmuggel und Rauschgifthandel werden im großen Stil betrieben. Schon früher sind andere Mitglieder der Familie Richard auf verdächtige Weise gestorben. Rosalie hatte deshalb private Nachforschungen angestellt und ist dabei womöglich zu unvorsichtig gewesen. Die wahre Geschichte überrascht und erschüttert Surprenant dann allerdings doch bis ins Mark, zumal er sich in der Gewalt des Mörders befindet, als er sie endlich erfährt …
Der immer noch anhaltende Erfolg des Kriminalromans führt in Deutschland dazu, dass auch Werke aus bisher kaum oder gar nicht bekannten Regionen den Weg in die hiesigen Buchläden finden. Neben Skandinavien, Afrika oder Asien gehört auch Kanada zu diesen „Entwicklungsländern“. Das riesige Land auf dem nordamerikanischen Kontinent bietet eine fabelhafte Kulisse für Krimis. Es gibt quasi menschenleere, von der Zivilisation unberührte Wälder und Tundren, aber auch moderne Großstädte mit ihren typisch urbanen Verbrechen.
Längst ist Kanada für das organisierte Verbrechen kein weißer Fleck auf der Karte mehr. Das erstaunt nicht, wenn es um Städte wie Vancouver, Montréal oder Toronto geht. Doch auch das scheinbar idyllische Hinterland blieb keinesfalls ausgespart. Auf den Madeleine-Inseln vermutet der ahnungslose Tourist eventuell Wilddiebe, Schwarzbrenner oder Schmuggler. Aber das 21. Jahrhundert bzw. das längst globalisierte Verbrechen hat selbst hier fest Fuß gefasst: Nachdem die Fischer die örtlichen Bestände an Fischen und Krabben vernichtet haben, gehen sie dazu über, ihre Schiffe als Transporter für die Rauschgiftmafia einzusetzen, die auf hoher See ihren „Stoff“ wassert, der dann geborgen und an Land transportiert wird.
Auch sonst wird mit harten Bandagen gekämpft. Von Gemeinschaftsgeist ist wenig zu spüren in Cap-aux-Meules oder Havre-aux-Maisons. Die Einheimischen kapseln sich gegen die „Fremden“ ab, ohne deren Geld sie noch wesentlich schlechter dastünden. Die alte Ordnung ist dahin, „Das Gesetz der Insel“ kein Instrument für die Verbrechen der Gegenwart mehr. Dass eine menschliche Tragödie für Rosalies Verantwortung ist, ändert daran auch nichts. Selbst wenn sich die Insulaner schließlich wieder in Sicherheit wiegen, weiß André Surprenant es besser.
„Das Gesetz der Insel“ erzählt sowohl von einem Kriminalfall als auch vom grundsätzlichen Konflikt zwischen zwei Polizisten, die unterschiedliche Auffassungen von ihrem Beruf haben. Sergent-Détective Surprenant ist der altmodische Ermittler, der auf seinen Bauch ebenso hört wie auf seinen Kopf. Er kennt die Inseln und ihre Bewohner und ist – obwohl Polizist – in ihre Gemeinschaft integriert. Auf einer Insel müssen die Menschen miteinander auskommen. Da braucht es einen Polizisten mit Fingerspitzengefühl. Ermittler zu sein, ist für Surprenant ebenso Beruf wie Berufung. Er nimmt zu viel Anteil am Geschehen, projiziert unwillkürlich seine Tochter an die Stelle von Rosalie und wird von dem leicht naiven Willen getrieben, das Böse von den Inseln zu vertreiben.
Denis Gingras übernimmt die Rolle des „Auswärtigen“. Er ist ein Polizist der Großstadt, der sich der Möglichkeiten moderner Hightech ebenso selbstverständlich bedient, wie er sich auf seine Erfahrungen mit „richtigen“ Verbrechen verlässt, von deren Verfolgung man auf den nach seiner Ansicht „rückständigen“ Madeleine-Inseln keine Ahnung hat. Gingras hat kein Gespür für die ungeschriebenen Gesetze einer abgeschlossenen Inselgemeinde. Er ignoriert diese oder hält sie für altmodische Relikte einer vergessenen Vergangenheit. Für ihn zählen nur harte Fakten, die er jedoch nicht hinterfragt oder interpretiert. Hingegen weiß Surprenant, dass auf den Madeleines Alt und Neu nebeneinander existieren und die Dinge längst nicht immer so sind, wie es scheinen.
Gingras vermag sich nicht vorzustellen, dass er auf einen Kriminellen treffen könnte, der „klüger“ ist als er. Das macht ihn voreingenommen und blind – aber nicht blöd: Der Polizist des 21. Jahrhunderts ist stets auch auf seinen Ruf bedacht. Deshalb kontrolliert Gingras den auf eigenen Spuren wandelnden Surprenant vorsichtshalber scharf, damit ihn dieser nicht mit Indizien konfrontiert, die seine (vor den Medien vertretenen) Theorien als falsch entlarven.
Genretypisch steht dieser Surprenant natürlich nicht nur dienstlich unter Druck, sondern schlägt sich auch mit privaten Problemen herum. Mit seiner langjährigen Ehe steht es nicht zum Besten; der Sergent flüchtet sich in die Arbeit, um sich den Konsequenzen zu entziehen. Gleichzeitig hat er ein Auge auf eine attraktive Kollegin geworfen. Surprenant steckt in einer Midlife-Crisis, die ihn deprimiert die Gegenwart mit den hochfliegenden Plänen seiner Vergangenheit vergleichen lässt.
Charaktere wie dieser sind zahlreich auf den Madeleines – vom Leben niedergeschlagen, beruflich oder privat gescheitert, erfüllt vom nagenden Gefühl, etwas verpasst zu haben auf ihrer schönen Insel, die Autor Limeaux wie ein Gefängnis darzustellen weiß. Jeder Mann, jede Frau, mit der es Surprenant im Verlauf seiner Ermittlungen zu tun bekommt, hütet hinter einer oft glänzenden Fassade diverse Skelette im Schrank, die freilich nicht immer mit dem eigentlichen Kriminalfall zu tun haben: „Das Geheimnis der Insel“ ist kein auf den „Whodunit“-Plot fixierter Krimi, sondern beschreibt den Einbruch des Bösen in eine Welt, deren Darstellung dem Verfasser genauso wichtig ist wie der „Fall“. Dem Puristen mag das Ergebnis weder Fleisch noch Fisch sein, aber diejenigen, die um das literarische Potenzial des Genres „Kriminalroman“ wissen und seine Grenzen weiter stecken, wird „Das Geheimnis der Insel“ als nie sensationelles aber angenehmes Lektüreerlebnis im Gedächtnis haften.
Jean Lemieux wurde am 21. Januar 1954 in Iberville geboren. Er ist als Schriftsteller mit französisch-kanadischer Stimme bekannt geworden, arbeitet jedoch hauptberuflich als Mediziner. Zwischen 1980 und 1982 führte er eine Praxis auf den Madeleine-Inseln vor den ostkanadischen Küste. Ab 1983 kam er auf mehreren ausgedehnten Reisen nach Kalifornien, Australien, Asien und Europa, bevor er auf die Inseln zurückkehrte und verstärkt als Schriftsteller aktiv wurde. Seit 1994 lebt und arbeitet Lemieux – weiterhin auch als Arzt – in Québec.
http://www.droemer-knaur.de
Sara Paretsky – Feuereifer
Die South Side gehört zu jenen Vierteln der Stadt Chicago, in die sich der brave Mittelstandsbürger ungern verirrt. Armut, familiäre Gewalt, Massenarbeitslosigkeit und Kriminalität gehören zum Alltag der Bewohner, die vom Establishment als Verlierer und Faulpelze abgestempelt werden.
Eine, die es geschafft hat, der South Side zu entfliehen, ist Victoria Iphigenia Warshawski, die eine kleine Detektei besitzt und selten an die Vergangenheit denkt, bis diese sie eines Tages einholt: Eine Lehrerin ihrer alten Schule bittet sie, als Trainerin des weiblichen Basketball-Teams einzuspringen. Vic übernimmt sogar einen Fall ohne Bezahlung: Eine der unterbezahlten Arbeiterinnen der Hinterhoffirma „Fly the Flag“ berichtet von diversen Sabotageakten. Frank Zamar, der Eigentümer, leugnet dies freilich und fordert Vic auf, ihre Arbeit einzustellen; seine deutlich erkennbare Angst lässt die erfahrene Detektivin erkennen, dass hier etwas faul ist. Sara Paretsky – Feuereifer weiterlesen
Neal Asher – Das Tor der Zeit (Agent Cormac 4)
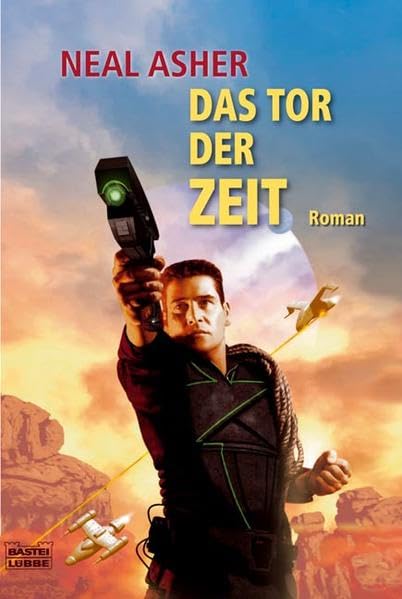
Eines Tages wird die KI „Celedon“, die in einem vergessenen Winkel der Polis eine Raumstation steuert, zu einer unbekannten Sonne beordert. Dort steht die Öffnung eines „Runcibles“ an: Zwei Punkte im All werden durch ein künstliches Wurmloch verbunden, durch das sich gewaltige Strecken in Nullzeit überbrücken lassen. Diese Technik ist kompliziert und nicht ungefährlich, so dass weiterhin die „normale“ Raumfahrt dominiert. „Earth Central“ hält zudem geheim, dass die Runcibles auch Zeitreisen ermöglichen. Die „Celedon“ steuert ein Portal an, durch das eine Reihe von Menschen 830 Jahre in die Vergangenheit reisen.
Hottinger, Mary (Hg.) – Mehr Gespenster
16 Kurzgeschichten aus drei angelsächsischen „Hochburgen“ der Phantastik zeichnen die Entwicklung der Gruselgeschichte anhand klassischer und weniger bekannter Beispiele nach. Diese Sammlung markiert historische Meilensteine des Genres und ist trotzdem zeitlos, da sie ihren Unterhaltungswert bewahren konnte und ein Muss für den Horrorfan geblieben ist, der auch die alten und älteren Meister zu schätzen weiß.
_George Mackay Brown (1921-1996): Die Vernehmung_ („The Interrogator“), S. 7-37 – Für den Tod der jungen Frau sind viele Menschen verantwortlich, deren Lügen und Ausflüchte ein Ermittler erst entwirren kann, als er die Verstorbene selbst verhört …
_Herbert George Wells (1866-1946): Das unerfahrene Gespenst_ („The Story of the Inexperienced Ghost“, 1902), S. 38-59 – Unkenntnis schützt vor Strafe nicht, wie ein wackerer Englishman drastisch erfahren muss, den ein tumbes Gespenst mehr lehrt, als er verkraften kann …
_Rudyard Kipling (1865-1936): Die gespenstische Rikscha_ („The Phantom Rickshaw“, 1888), S. 60-98 – Eine Frau kann an gebrochenem Herzen sterben, doch das muss sie nicht unbedingt davon abhalten, ihren treulosen Geliebten weiterhin ihrer Liebe zu versichern …
_William Fryer Harvey (1885-1937): Das Werkzeug_ („The Tool“, 1928), S. 99-121 – Ein urlaubender Pfarrer leidet unter seltsamen Gedächtnislücken, während er gleichzeitig einen Mord entdeckt …
_(Joseph) Sheridan Le Fanu (1814-1873): Der böse Captain Walshawe_ („Wicked Captain Walshawe of Wauling“, 1864), S. 122-140 – Er war zeit seines Lotterlebens ein Wüstling; im Tod muss er endlich für seine Übeltaten zahlen, aber noch jetzt piesackt er die Lebenden …
_Ambrose Bierce (1842-1914?): Der Fremde_ („The Stranger“, 1909), S. 141-148 – Auch im Wilden Westen kann es spuken, zumal ein Leben dort oft drastisch endet …
_Saki (d. i. Hector Hugh Munro, 1870-1916): Die offene Tür_ („The Open Window“, 1911), S. 149-155 – Im Sumpf sind der Onkel und seine Brüder versunken, erzählt das kleine Mädchen, aber die verwirrte Tante rechne fest damit, dass sie eines Abends wieder auftauchen und heimkehren …
_Andrew Lang (1844-1912): Glams Geist_ („The Ghost of Glam“), S. 156-172 – Auf einem isländischen Gehöft geht in mittelalterlichen Tagen ein mörderisches Gespenst um, das nur ein wahrer Held bezwingen kann …
_Forbes Bramble (geb. 1939): Ferien_ („Holiday“, 1976), S. 173-196 – An diesem idyllischen See solltest du dein Zelt nicht aufschlagen, denn er beherbergt Bewohner, die ungeduldig auf die Dunkelheit warten …
_James Allan Ford (geb. 1920): Eine Art Besitz_ („A Kind of Possession“, 1976), S. 197-217 – Alle Welt bedauert den im Krieg verrückt gewordenen Helden; nur ein kleiner Junge weiß, dass es nicht nur böse Erinnerungen sind, die ihn jagen …
_Angus Wolfe Murray: Der Fluch_ („The Curse of Mathair Nan Uisgeachan“, 1976), S. 218-251 – Eine grausame Bluttat brachte ihn vor Jahrhunderten über die Familie, und er ist heute noch so gültig wie einst …
_Iain Crichton Smith (1928-1998): Die Brüder_ („The Brothers“, 1976), S. 252-268 – Er glaubt seine „rückständigen“ schottischen Wurzeln abgeschnitten zu haben, aber die zornigen Geister seiner Heimat dulden diesen „Verrat“ nicht …
_Fred Urquhart (1930-1994): Stolze Dame im Käfig_ („Proud Lady in a Cage“, 1976), S. 269-292 – Der Fluch einer Hexe erfüllt sich in der Gegenwart und quält eine junge Frau, indem er ihren Geist in eine grässliche Vergangenheit verbannt …
_John McGahern (1934-2006): Hauch des Weins_ („The Wine Breath“, 1977), S. 293-308 – Ein alternder Priester wird von seltsamen Visionen verfolgt, die ihn auf sein baldiges Ende vorbereiten sollen …
_Brian Moore (1921-1999): Das zweite Gesicht_ („The Sight“, 1977), S. 309-337 – Ein stolzer Menschenfeind lernt Demut und Angst, als eine hellsichtige Frau ihm den Zeitpunkt seines Todes nennen könnte …
_Terence de Vere White (1912-1994): Einer aus der Familie_ („One of the Family“, 1977), S. 338-358 – Wer ist Mr. Richard, der sich selbst als Geist verfolgt, und was ist der Grund für diese Heimsuchung?
Nachweis, S. 359-361
Zum zweiten Mal (nach „Gespenster“) sammelt Mary Hottinger (1893-1978) klassische Gruselgeschichten. Dieses Mal erweitert sie den Kreis und bezieht außer englischen auch schottische und irische Autoren ein; darüber hinaus gibt es je eine Story aus Island und – seltsamerweise – aus den USA. Die Kollektion zerfällt dieses Mal in zwei deutlich erkennbare Teile. Die Seiten 1-155 spiegeln die englische Gespenstergeschichte chronologisch wider. Berühmte Autoren sind mit genreprägenden Storys aus der zweiten Hälfte des 19. und dem frühen 20. Jahrhundert vertreten.
Anschließend gibt es einen Sprung: Die schottischen und irischen Geschichten (ab S. 173) stammen sämtlich aus den Jahren 1976 und 1977. Damit können sie nicht als repräsentativ gelten – kein Wunder, sind sie doch sämtlich zwei Storysammlungen der genannten Jahre entnommen. Hier hat es sich Hottinger sehr einfach gemacht – oder einfach machen müssen? „Bloody Mary“, die vom |Diogenes|-Verlag gekrönte Fachfrau für die Auswahl hochrangiger Krimi- und Gruselgeschichten, war stolze 85 Jahre alt, als „Mehr Gespenster“ erschien. Noch 1978 ist sie gestorben, was die Frage aufwirft, wie groß ihr Anteil an diesem Band eigentlich ist. Hat sie wirklich als Herausgeberin gearbeitet – arbeiten können? Oder bediente man sich einfach ihres werbeträchtigen Namens und stellte zusammen, was gerade greifbar war?
Glücklicherweise griffen Hottinger oder der Verlag auf zwei Sammlungen zurück, die inzwischen selbst als Klassiker gelten. „Mehr Gespenster“ ist deshalb zwar kein Standardwerk wie „Gespenster“ von 1956, aber der Leser muss in Sachen Unterhaltungswert kaum Abstriche machen.
Die Klassiker Kipling, Wells, Harvey, Bierce, Le Fanu und Saki sind mit Beiträge vertreten, die nicht grundlos immer wieder in einschlägige Storysammlungen aufgenommen wurden und werden, belegen sie doch mit bestechender Eleganz, was „Gruseln“ bedeutet, wenn ein Schriftsteller sein Handwerk beherrscht. Das literarische Niveau ist hoch, die Wege zur Erzeugung einer unheimlichen Stimmung sind unterschiedlich doch generell wirkungsvoll. Die hier auftretenden Gespenster sind manchmal grausam aber nie brutal; obwohl sich die Zeiten geändert haben, bleibt ihr Auftreten effektvoll. Die genannten Meister machen außerdem deutlich, dass der Schrecken mit wohl dosiertem Humor nicht nur harmoniert, sondern diesen sogar verstärkt. H. G. Wells und Saki balancieren mit traumhafter Sicherheit auf diesem schmalen Grat, doch auch Sheridan Le Fanu beweist (auch dank sorgfältiger Übersetzung, die übrigens den gesamten Band kennzeichnet), dass eine anderthalb Jahrhunderte alte Story witzig sein kann.
Keine „richtige“ Gespenstergeschichte ist „Glams Geist“, die der „Saga of Grettir the Strong“ (= „Grettir’s Saga“) entnommen wurde, welche wahrscheinlich im frühen 14. Jh. auf Island entstand und die Abenteuer des (fiktiven?) Kriegers Grettir Ásmundarson beschreibt. Diese Saga wurde mehrfach übersetzt, da sie immer wieder viele Leser fand: Grettir ist ein Anti-Held – er sinkt zum Geächteten ab, wird von Glams Geist verflucht, verfällt einem depressiven Wahnsinn und endet tragisch. Sie interessiert darüber hinaus den Historiker, da der unbekannte Autor detailliert das Leben auf Island zwischen dem 9. und 11. Jh. beschreibt und „Grettir’s Saga“ somit als zeitgeschichtliche Quelle gilt.
Die (inoffizielle) zweite Hälfte von „Mehr Gespenster“ enthält Geschichten von Autoren, deren Namen dem Phantastik-Fachmann zumindest hierzulande wenig sagen. Recherchiert man ein wenig, findet man Bramble, Ford, Murray & Co unter den lokalen Schriftstellergrößen Schottlands und Irlands. Sie haben sich literarischen Ruhm mit historischen Epen, Dramen oder Gedichten verdient, mit denen sie ihrer Heimat ein Denkmal setzten. Die hier aufgenommenen Geschichten greifen einerseits auf das klassische „Motiv“ des Spukens zurück: Gespenster sind die Seelen von Menschen, die ihr Leben nicht „ordnungsgemäß“ zu Ende bringen konnten, weil sie einen tödlichen Unfall erlitten haben oder ermordet wurden. Möglicherweise haben sie sich eines schlimmen Verbrechens schuldig gemacht, das ihnen im Jenseits keine Ruhe lässt. In jedem Fall kehren sie als Geister zurück, suchen nach Hilfe oder Rache.
Doch die Zeiten ändern sich: Zwischen dem Gespenst von Heute und seinem Opfer muss es keine direkte Bindung mehr geben. Die Natur des Spuks hat sich gewandelt bzw. erweitert. So wurzeln die jüngeren Geschichten dieser Sammlung in der bewegten, oft grausamen Historie der Schotten und Iren, die ein ständiges Ringen mit der unwirtlichen Natur, das oft genug einem Kampf auf Leben und Tod gleichkam, gleichzeitig bodenständig, egoistisch und hart werden ließ. Immer wieder thematisieren die Autoren den Konflikt der von Naturgeistern beseelten heimgesuchten, archaischen Wildnis, in die unwissende Besucher aus der „modernen“ Außenwelt eindringen. Sie scheren sich nicht um die ungeschriebenen Regeln, die jeder Einheimische kennt und zu achten gelernt hat. Die Folgen sind schrecklich, denn diese Geister kennen keine Gnade. Unkenntnis ist für sie nicht Entschuldigung, sondern Grund für Strafe und Chance zur Befriedigung eigener, düsterer Bedürfnisse. Hier gibt es keine erkennbare Gerechtigkeit mehr, der Fluch trifft nicht mehr jene, die ihn „verdienen“, sondern Pechvögel, die sich zur falschen Zeit am falschen Ort aufhalten.
Immer wieder spielt darüber hinaus der ewige Konflikt zwischen den „angelsächsischen“ Engländern, den „gälischen“ Schotten und den „keltischen“ Iren eine wichtige Rolle. Ihre gemeinsame Geschichte wird durch brutale Kriege, Unterdrückung und grausame Not markiert. Die Geister dieser Vergangenheit ruhen verständlicherweise nicht, die übel geendeten Ahnen schreien nach Rache und verhalten sich entsprechend. Dabei kann ihr Zorn auch die eigenen Nachfahren treffen, die ihre Herkunft verleugnet haben. Die Konsequenzen solchen „Verrats“ hat Iain Crichton Smith in seiner Erzählung „Die Brüder“ eindringlich literarisch verarbeitet.
So darf und muss abschließend noch einmal festgestellt werden, dass „Mehr Gespenster“ als Sammlung „anders“ als „Gespenster“ ist. Das verbindende Zauberwort lautet „Qualität“ – und die prägt eindeutig beide Bücher. Der zweite Band der „Gespenster“-Trilogie wird deshalb seine Leser/innen ebenso unterhalten und begeistern wie sein Vorgänger.
Die „Gespenster“-Trilogie des |Diogenes|-Verlags:
(1956) „Gespenster: Die besten Gespenstergeschichten aus England“ (hg. von Mary Hottinger)
(1978) „Mehr Gespenster: Gespenstergeschichten aus England, Schottland und Irland“ (hg. von Mary Hottinger)
(1981) „Noch mehr Gespenster: Die besten Gespenstergeschichten aus aller Welt“ (hg. von Dolly Dolittle)
http://www.diogenes.de
Phillips, Scott – Irrgänger, Der
Gunther Fahnstiel war einst ein guter Cop, der allerdings schwach wurde, als sich ihm vor vielen Jahren die Chance bot, „schwarzes“ Geld an sich zu bringen, was er so zu arrangieren wusste, dass niemand ihm auf die Schliche kam. Unauffällig gaben er und seine Gattin Dorothy das Geld aus und machten sich ein schönes Leben, bis Fahnstiel an Alzheimer erkrankte und in ein Heim umsiedeln musste.
Die Kosten fressen das unrechtmäßig erworbene Vermögen auf, was Dorothy ihrem Gunther in einer schwachen Stunde eröffnete. In dessen aufweichendem Hirn blieb nur das Wissen um die drohende Geldnot haften. Deshalb macht sich Fahnstiel aus dem Heim davon. Er will zum Versteck und Nachschub besorgen. Dass dieses Geld längst geborgen wurde, hat er vergessen.
Ebenfalls entfallen sind ihm einige Skandale und Morde, in die Fahnstiel, seine Gattin Dorothy, sein ehemaliger Polizei-Kollege und Freund Ed Dieterle sowie seine alte Flamme Sally verwickelt waren. Fahnstiels Flucht rührt an dieser unschönen Vergangenheit. Gern würde Dorothy im Verborgenen halten, wie sie und Gunther einst zu Geld kamen, während Sohn Sydney darauf brennt, das Geheimnis zu lüften. Ähnlich geht es Dieterle, der schon lange Verdacht geschöpft hat. Sally Ogden wäre es gar nicht recht, dass ihre Familie sie als Puffmutter und Prostituierte identifiziert, die für einen der größten Skandale der 1950er Jahre verantwortlich war. Außerdem ist da noch Ex-Gatte Wayne, der ein üblen Mistkerl war und mit einer Kugel im Schädel endete; ein Fall, der nie geklärt werden konnte, wofür Fahnstiel und Dieterle sorgten …
Während Gunther verwirrt aber hartnäckig immer tiefer in seine Vergangenheit vordringt, machen sich Frau und Sohn, Freund Ed, aber auch Sallys nichtsnutziger Schwiegersohn Eric auf die Suche nach ihm. Man findet sich dort, wo Fahnstiel einst sein Geld vergrub – und dessen Eigentümer. Das Finale gestaltet sich jedoch deutlich anders, als die Beteiligten sich dies dachten …
Wer hätte es gedacht – es gibt ihn doch: den Krimi mit originellem Plot, dem eine Handlung voller Überraschungen entspringt. Die Jagd nach einem Schatz, der längst nicht mehr existiert, setzt eine Kettenreaktion auf zwei Zeitebenen in Gang, sorgt für turbulente Verwicklungen in der Gegenwart und rührt Geschehen auf, die fünf Jahrzehnte in eine Vergangenheit zurückreichen und besser dort geblieben wären.
Was sich damals abgespielt hat, enthüllt Verfasser Phillips seinen Lesern nur Stück für Stück und auch nicht vollständig. Immer wieder springt die Handlung von der Gegenwart zurück ins Jahr 1952. Ein junger und gesunder Gunther Fahnstiel setzt sich auf die Spur eines Kriminellen namens Wayne Ogden, der offensichtlich ein großes Ding plant. Kompliziert wird die Sache, weil der Cop mit Waynes Gattin Sally verbandelt ist, die wiederum einen florierenden Hurenring leitet und sich auf Protektion durch Fahnstiel und seinen Kumpel Ed verlassen kann. Irgendwann fliegt die Sache erst auf und dann in die Luft, was gleich mehrere Pechvögel nicht überleben.
Irritiert wird der Leser durch die zunehmend deutlich werdende Erkenntnis, dass Fahnstiels Geld in diesem Geschehen keine Rolle spielt. Es kam erst 1979 in seinen Besitz. Verbindende Gemeinsamkeit ist allein der Ort des Geschehens – die alte Kiesgrube, an deren Ufer Sally ein Vierteljahrhundert zuvor ihre Orgien inszenierte.
An die wiederum dramatischen Ereignisse von 1979 erinnert ein Prolog-Kapitel, mit dem freilich primär diejenigen Leser etwas anzufangen wissen, die Scott Phillips‘ Roman „The Ice Harvest” (2000; dt. „Alles in einer Nacht“; 2005 mit John Cusack, Billy Bob Thornton & Connie Nielsen verfilmt) gelesen haben: „Der Irrgänger“ ist gleichzeitig Fortsetzung und Vorgeschichte der dort geschilderten, ebenfalls höchst kriminellen Abenteuer.
Der ungewöhnlichen Erzählstruktur entspricht ein Plot, der sowohl vorsätzlich als auch vergnüglich mit den Regeln des Genres spielt und sie mehr als einmal bricht. Der „schwarze“ Krimi schert sich seit jeher weder um Gesetz & Moral, ist politisch unkorrekt und dadurch vergleichsweise realistisch. Die Protagonisten wirken wie Marionetten eines Schicksals, dessen Ziel von Anfang an festzustehen scheint: Das Leben kennt keine Gewinner, nur Überlebende, und die sind meist nicht zu beneiden.
„Der Irrgänger“ mildert die Unbarmherzigkeit dieser Prämisse durch einen lakonischen, fast dokumentarischen Stil und einen trockenen Humor, der die eigentlich kaum witzig zu nennende Handlung angenehm konterkariert. Scheitern, Untreue, Verlust, Angst – diese und andere Elemente des „Crime Noir“ sind vorhanden; sie werden ergänzt durch das vergleichsweise moderne Schreckgespenst Alzheimer. Doch im Unglück lässt sich – vor allem dann, wenn man nicht selbst betroffen ist … – in der Regel viel Komisches erkennen, das Phillips ausgezeichnet herauszuarbeiten vermag: Gelächter als befreiende Reaktion auf ein Geschehen, das ansonsten Fassungslosigkeit erzeugt, wirkt selten so „logisch“ wie bei der Lektüre dieses Buches.
Dazu passt die Auflösung des Plots, in deren Verlauf Phillips sämtliche Erwartungen seiner im Genre geschulten Leser aushebelt und durch eine Handlung ersetzt, die gleichermaßen verwirrt wie begeistert: Zumindest der erfahrene und häufig enttäuschte Krimi-Freund freut sich darüber, wie Klischees vermieden werden.
Selbstverständlich könnte man meckern: Phillips ist manchmal ein wenig zu auffällig um „richtige“ Literatur bemüht. Puristen unter den Leser könnten sich fragen, ob sie es hier überhaupt mit einem Krimi zu tun haben oder ob sich ein Schriftsteller nur der Stilelemente des Krimis bedient, um einem ansonsten dem belletristischen Mainstream verpflichteten Roman ein breiteres Publikum zu verschaffen, das ihn sonst mit Missachtung gestraft hätte. Das Urteil mögen die Fachleute sprechen, die für Diskussionen dieser Art leben. Dem „normalen“ Leser sei gesagt, dass „Der Irrgänger“ auch ohne Legitimation seitens der Literaturwissenschaft ein Buch ist, das die Lektüre lohnt – selbst der Laie erkennt, dass er (oder sie) nicht mit dem üblichen Krimi-Seifenoper-Brei abgespeist wird.
Ein großartiger, tragischer, witziger „Held“ ist dieser Gunther Fahnstiel: ein harter Bursche, dessen Hirn sich in Weichkäse verwandelt. Die Alzheimersche Krankheit ist ein Grauen, über das man aus abergläubischer Angst nur ungern spricht, weil dies sie heraufbeschwören könnte. Doch Alzheimer gehört längst zum modernen Alltag, und die Zahl der Betroffenen sowie ihrer traumatisierten Familienmitglieder steigt kontinuierlich.
Ob Scott Phillips korrekt wiedergibt, was einem Mann wie Fahnstiel durch den Kopf gehen könnte, ist nebensächlich. Viel wichtiger ist, dass er deutlich macht, was Alzheimer bedeutet: die Auslöschung des Gedächtnisses, was zunächst die Gegenwart betrifft und sich dann in Richtung Vergangenheit fortsetzt, wobei die Fragmente der Erinnerung sich mischen und neu ordnen, während das absterbende Gehirn versucht, eine gewisse Ordnung aufrechtzuerhalten. Fahnstiel ist der Gefangene seines Hirns, das ihn in eine Art Zeitreisenden verwandelt, für den Jetzt und Einst eine traumähnliche Mischwelt bilden, obwohl er sich manchmal dessen bewusst ist, dass etwas nicht mit ihm stimmt.
Ähnliche Glanzleistungen gelingen Phillips mit den Figuren Wayne Ogden und Eric Gandy. Odgen ist ein Schurke, wie er selten geschildert wird: ein moralisch bis ins Mark verkommener Krimineller, den man wegen der Konsequenz seiner Verbrechen schon wieder schätzt. Für Wayne gibt es kein Gesetz. Er lebt ausschließlich nach eigenen Regeln, die nur seinen Vorteil berücksichtigen. Daraus macht er keinen Hehl und entwaffnet damit manchen potenziellen Gegner – bis er an jemanden gerät, dessen Kodex Wayne falsch einschätzt.
Eric Gandy ist Waynes modernes Gegenstück, dem allerdings das Talent zum Verbrecher völlig abgeht. Geldgierig und verlogen ist er, doch ihm mangelt es am nötigen Geschick. Sogar der senile Gunther schlägt ihm mehrfach peinliche Schnippchen. Eric ist ein Loser, fast tragisch, doch zu seinem Pech vor allem lächerlich, so dass man ihm gönnt, was auf seine geplagtes Haupt niederprasselt.
Ebenso geschickt setzt Phillips die übrigen Figuren seiner Tragikomödie in Szene. Sie haben alle Dreck am Stecken, was sie freilich trotz aller Fehler noch sympathischer wirken lässt. Die Abwesenheit des moralisierend erhobenen Zeigefingers hinterlässt eine Leere, die wunderbarer kaum sein kann und den Lesespaß an einem Roman komplettiert, der es keinesfalls verdient, in der Flut der Taschenbuch-Krimis unterzugehen, die sich Monat für Monat über leider allzu konservative Leser/innen ergießt.
Scott Phillips (geb. 1961 in Wichita, US-Staat Kansas) ist ein Schriftsteller, der sowohl als Literat als auch als Neuerer des Kriminalromans gilt. Sein Werk ist schmal aber qualitativ gewichtig; schon Phillips‘ Debütroman „The Ice Harvest“ (2000; dt. „Alles in einer Nacht“, verfilmt 2005) wurde als „New York Times Notable Book of the Year“ erwähnt und gewann einen „California Book Award“, eine „Silver Medal for Best First Fiction“ und wurde für diverse andere Preise nominiert. Ähnlich erfolgreich wurde die Quasi-Fortsetzung „The Walkaway“ (2002; dt. „Der Irrgänger“). „Cottonwood“ (2003) spielt in der Zeit des „Wilden Westens“.
Scott Phillips lebte viele Jahre in Paris und zog später nach Südkalifornien, wo er sich als Drehbuchschreiber für Hollywood versuchte; unter dem Titel „Crosscut“ wurde 1996 immerhin eines realisiert. Heute lebt Phillips mit seiner Familie in St. Louis. Über seine schriftstellerischen Aktivitäten informiert seine Website http://scottphillipsauthor.com.
http://www.knaur.de
Kurt Singer (Hg.) – Horror 4: Klassische und moderne Geschichten aus dem Reich der Dämonen

Joachim Körber (Hg.) – Das dritte Buch des Horrors
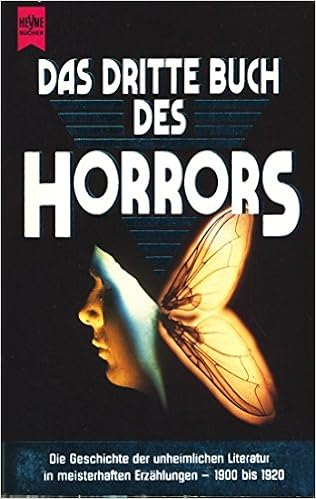
_W. W. Jacobs: „Die Affenpfote“_ (The Monkey’s Paw, 1902), S. 11-24 – Drei Wünsche erfüllt sie dir, die verzauberte Affenpfote aus dem Morgenland, aber bedenke, dass der Teufel noch jeden ausgetrickst hat, der ihn versuchte …
_Hanns Heinz Ewers: „Die Topharbraut“_ (1903), S. 25-58: Ein Schriftsteller lernt einen mysteriösen Privatgelehrten kennen, der sich als waschechter „mad scientist“ mit ausgeprägtem Pharaonenwahn entpuppt …
_William Hope Hodgson: „Tropischer Horror“_ (A Tropical Horror, 1905), S. 59-72: Aus den Tiefen des Meeres schwingt sich der personifizierte Horror an Bord des kleinen Schiffes, um dort ein Tod bringendes Schreckensregiment zu errichten …
_Algernon Blackwood: „Die Weiden“_ (The Willows, 1907), S. 73-144: Zwei Abenteurer verschlägt es auf ihrer Kanufahrt die Donau hinab auf eine einsame Insel, die eine Art Relaisstation zwischen dieser und einer anderen, recht feindseligen Welt darstellt …
_Georg von der Gabelentz: „Der gelbe Schädel“_ (1909), S. 145-200: Aus einer verfallenen Gruft nimmt ein junger Mann das Haupt des Magiers Cagliostro als makaberes Souvenir mit nach Haus, was die zu erwartenden Folgen zeitigt …
_M. R. James: „Das Chorgestühl zu Barchester“_ (The Stalls of Barchester Cathedral, 1911), S. 201-224: Gar nicht fromm hat der Dechant seinen allzu langlebigen Amtsvorgänger aus dem Weg geräumt, doch was in dieser Welt womöglich unbemerkt bleibt, setzt in der nächsten einige unangenehme Rachegeister in Marsch …
_E. F. Benson: „Wie die Angst aus der langen Galerie verschwand“_ (How Fear departed from the Long Gallery, 1912), S. 225-244: Grausam sicherte sich einst ein verschlagener Landjunker das Familienerbe, aber die gemeuchelte Konkurrenz rächte sich noch aus dem Grab und verschont auch die Nachfahren nicht …
_Karl Heinz Strobl: „Das Grabmal auf dem Père Lachaise“_ (1914), S. 245-278: Die exzentrische, vor einiger Zeit verstorbene Gräfin vermacht dem ein Vermögen, der ein Jahr in ihrem Mausoleum haust. Ein armer Gelehrter schlägt ein und hat bald die Gelegenheit, seine Gönnerin persönlich kennen zu lernen …
_Gustav Meyrink: „Meister Leonard“_ (1916): Der Nachfahre eines gotteslästerlichen Geschlechts von Tempelrittern wehrt sich erbittert gegen den Familienfluch, der ihn immer wieder einholt …
_Sax Rohmer: „Die flüsternde Mumie“_ (The Whispering Mummy, 1918): In Kairo lasse die Finger von Frauen, deren Verlobte als mächtige Zaubermeister bekannt und gefürchtet sind …
Teil 3 einer auf vier Bände angelegten „Geschichte der unheimlichen Literatur“, die Anfang der 90er Jahres des vergangenen Jahrhunderts unter der Herausgeberschaft von Joachim Körber erschien. Den ehrgeizigen Obertitel sollte man am besten gleich wieder vergessen, da er den Anschein eines gewissen literaturwissenschaftlichen Anspruches erwecken könnte, der sich – dem Genre wohl angemessen – im hellen Licht der Kritikersonne rasch in Nichts auflöst. Aus den kargen Körberschen Vorworten lernt der Wissbegierige jedenfalls herzlich wenig über das Wesen des geschriebenen Horrors. Aber das sollte man dem Herausgeber nachsehen, denn sein Plan ist es ohnehin, besagte Geschichte „in meisterhaften Erzählungen“ nachzuzeichnen – und das gelingt auf jeden Fall!
Dieser Band versammelt Erzählungen aus dem Zeitraum 1900 bis 1920 – eine scheinbar recht willkürliche Einteilung, die jedoch durch historische Realitäten gestützt werden kann: Der Tod der Königin Victoria 1901 leitete in der Tat das Ende einer Ära ein, und dieser Prozess war mit dem Ende des I. Weltkriegs 1918 quasi abgeschlossen. In Europa verschwanden die seit Jahrhunderten prägenden Monarchien oder verloren ihre reale Macht, die alten Gesellschaftsordnungen zerbrachen. Die Naturwissenschaften feierten Triumphe, die Lösung noch der letzten Rätsel schien zum Greifen nahe. Das menschliche Gehirn wurde entschlüsselt, die Wunder der Psyche wurden gedeutet.
Diese hier nur skizzierten historischen Prozesse lassen sich – mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung – im „Dritten Buch des Horrors“ nachvollziehen. William Wymark Jacobs (1863-1943) markiert mit „Die Affenpfote“ den Auftakt. Die viktorianische Gespenstergeschichte, die wie kaum eine andere Epoche die unheimliche Literatur prägte, zeigt sich mit ihm noch auf ihrem Höhepunkt. Systemkonformität und Schicksalsergebenheit sind das Gebot der Stunde; Verstöße gegen die göttliche Ordnung werden umgehend mit schrecklichen Strafen geahndet. Diese Haltung ist typisch und wird es bleiben; noch heute erscheint es dem Gruselfreund völlig richtig, dass Michael Myers die allzu lebenslustigen Teenies schlachtet und die Langweiler verschont. Ungeachtet dessen ist „Die Affenpfote“ zu Recht ein Klassiker des Genres, der meisterhaft eine Atmosphäre des stetig wachsenden Grauens beschwört.
Montague Rhodes James (1862-1936) scheint mit „Das Chorgestühl zu Barchester“ zunächst in dasselbe Horn zu stoßen. Tatsächlich ist er der Erzähler klassischer englischer Gespenstergeschichten par excellence; vielleicht sogar ihr König. James‘ Gespenster sind immer schlecht gelaunt und bösartig, und ihr Zorn trifft jeden, der ihn herausfordert. Eine persönliche Schuld, wie sie der allzu ehrgeizige Dechant dieser Geschichte auf sich geladen hat, ist dabei nicht zwangsläufig der Auslöser. Das erklärt den Erfolg der James-Geschichten, deren ungeheuerliche Popularität im Heimatland des Verfassers bis heute ungebrochen andauert: Sie sind nicht verankert in ihrer Entstehungszeit, sondern Kunst-Werke im eigentlichen Sinn. James hat sie zum Zeitvertreib und unter Anwendung handwerklicher Regeln und Nutzung seines immensen historischen Fachwissens geschrieben. So spiegeln sie nur bedingt den Zeitgeist wider, sondern sind zeitlos, ohne echtes Herz vielleicht, wie die James-Kritiker schimpfen, aber vergoldet durch Nostalgie und erschreckend unterhaltsam.
Auch Edward Frederic Benson (1867-1940) haut zunächst in dieselbe Kerbe. „Wie die Angst aus der langen Galerie verschwand“ ist viktorianischer Grusel als Maßarbeit. Noch meisterlicher als James präsentiert ihn Benson dabei im Verbund mit knochentrockenem, britischem, schwarzem Humor und erinnert damit daran, dass Schreien und Lachen sich nicht so fremd sind, wie man gemeinhin annimmt. Aber Benson ist auch barmherziger als James: Das Grauen der langen Galerie wird gütlich und ohne weitere Opfer beendet – und siehe da: Es funktioniert!
William Hope Hodgson (1877-1918) ist der (hierzulande kaum bekannte) Meister der Seespuk-Geschichte. Die Amok laufende, vor geiler Fruchtbarkeit berstende, Schleim und Schimmel über ihre unglücklichen oder allzu neugierigen Besucher ergießende, aber nie willentlich bösartige Natur, die den Gentech-Horror des späten 20. Jahrhunderts bereits vorwegnimmt, ist Hodgsons Passion. „Tropischer Horror“ ist keine seiner besten Geschichten, weil zwar sehr effizient, aber ein wenig grobschlächtig und ganz sicher nicht raffiniert.
Ganz anders dagegen Algernon Blackwood (1869-1951) mit „Die Weiden“, einer der besten unheimlichen Novellen aller Zeiten. Bei aller Hingabe an die Moderne war das frühe 20. Jahrhundert auch eine Hochzeit okkulter Moden. Wenn sich die sichtbare Welt durch Naturgesetze erklären und bannen ließ, dann vielleicht auch die bisher unsichtbare, weil jenseitige oder x-dimensionale. Blackwood mag nicht an eine quasi unbelebte, starren Regeln gehorchende Natur glauben. Er bevölkert sie mit Geistwesen, die seit Urzeiten neben der Menschenwelt existieren. Kontakte erfolgen eher zufällig und enden in der Regel katastrophal, aber sie haben ihren Platz in der natürlichen Ordnung der Dinge, die sich eben doch nicht immer rational erfassen lassen. H. P. Lovecraft hat Blackwood aufmerksam gelesen und wird ihn zitieren, wenn er seinen „Cthulhu“-Zyklus schöpft.
Erfreulicherweise nimmt Körber auch vier deutschsprachige Gruselgeschichten auf. Im Zeitalter des Jason-Dark- und Hohlbein-Dumpfhorrors ist es in Vergessenheit geraten, aber bis die Nazis ihr 1933 ein Ende machten, gab es eine deutsche Phantastik, die sich vor der angelsächsischen nicht verstecken musste. Hanns Heinz Ewers (1871-1943) liefert mit „Die Topharbraut“ eine grundsolide Schauermär ab. Georg von der Gabelentz (1868-1940) kann da mit „Der gelbe Schädel“ nicht mithalten – der Horror wird hier eher behauptet als beschworen, und das mit ziemlich angestaubten literarischen Tricks. Karl Heinz Strobl (1877-1946) glänzt mit „Das Grabmal auf dem Père Lachaise“, einer straff komponierten, effektvollen Vampir-Story, und Gustav Meyrink (1868-1932) beeindruckt durch „Meister Leonard“. Obwohl die phantastischen Elemente aufgesetzt wirken, kann die meisterhafte Darstellung der manischen Mutter wirklich erschrecken.
Sax Rohmer (eigentlich Arthur Henry Ward, 1883-1959) ist der geistige Vater des diabolischen Dr. Fu-Manchu. Dieser stellt seinen Schöpfer inzwischen als moderner Mythos längst in den Schatten und lässt dadurch vergessen, dass Rohmer kein wirklich guter Schriftsteller war. „Die flüsternde Mumie“ ist daher nicht nur des Themas wegen ziemlich angestaubt und keine glückliche Wahl als Ausklang dieser Sammlung – es sei denn, Körber wollte eine Überleitung finden zum sich nun schon abzeichnenden Zeitalter der „Pulp“-Magazine, die in den 1920er Jahren ihren Siegeszug antraten.
Broschiert : 348 Seiten
www.heyne.de
Agatha Christie – Tod in den Wolken

Agatha Christie – Tod in den Wolken weiterlesen
Jonathan Rabb – Die Eisenreich-Verschwörung
In Washington wurde vor einiger Zeit eine streng geheime Untersuchung beschlossen. Diverse ultra-reaktionäre und rechtsradikale Gruppen sollen darauf überprüft werden, ob sie dem Staat gefährlich werden könnten und aus dem stets verdächtigen Ausland Unterstützung erfahren. Dahinter steckt der „Aufsichtsausschuss“, eine der Öffentlichkeit nicht bekannte Abteilung des US-Außenministeriums, die einst gegründet wurde, um jenseits der lästigen Knechtschaft durch niedergeschriebene Gesetze die Bösen dieser Welt zu strafen und auszuschalten.
Agentin Janet Trent taucht hinab in den Sumpf selbst ernannter Tugendwächter und fanatischer Seelenretter, in dem es seit einiger Zeit gefährlich brodelt: Eine Welle äußerst brutaler, dabei militärisch präzise organisierter Terroranschläge erschüttert die USA. Der Aufsichtsausschuss rätselt, ob es der fundamentalistische TV-Demagoge Jonas Tieg ist, der Furcht und Schrecken säen lässt, um die USA innenpolitisch zu destabilisieren und so die Herrschaft an sich zu reißen. Jonathan Rabb – Die Eisenreich-Verschwörung weiterlesen
Körber, Joachim (Hg.) – zweite Buch des Horrors, Das
Zehn Kurzgeschichten aus den Jahren zwischen 1920 und 1940, in denen aus der klassischen Gespenstergeschichte das „kosmische Grauen“ des [H. P. Lovecraft 345 und seiner diffusen, aber gemeingefährlichen „anderen Wesen“ aus Zeit und Raum entsprang:
_Stefan Grabinski: Der Blick_ („Spojrzeme“, 1922), S. 11-28 – Wenn gewisse Philosophen Recht haben und diese Welt nur eine Illusion ist – wie sieht dann die Realität aus? Grauenhaft, wie Dr. Odonicz weiß, aber er kann es uns sicher nicht mehr mitteilen …
_Jean Ray: Die weiße Bestie_ („La bete blanche“, 1925), S. 29-38 – Ein Einsiedler entdeckt in den Wäldern der Ardennen eine tiefe Höhle, darin eine Goldader – und einen missgestimmten Überlebenden aus der Urzeit …
_Seabury Quinn: Der Poltergeist_ („The Poltergeist“, 1927), S. 39-72 – Jules de Grandin, französischer Meisterdetektiv des Okkulten, rettet eine schöne Maid aus den Klauen eines geilen Gespenstes …
_Howard Phillips Lovecraft: Cthulhus Ruf_ („The Call of Cthulhu“, 1928), S. 73-120 – Des alten Forschers Großneffe und Erbe entdeckt im Vermächtnis Spuren, die auf die Existenz eines Äonen alten Kultes hinweisen, der sich zum Ziel setzt, recht unangenehme „Gottheiten“ auf die Welt zu bringen …
_Frank Belknap Long: Die Dämonen von Tindalos_ („The Hounds of Tindalos“, 1929), S. 121-144 – Allzu neugierig ist ein Forscher, der mit Hilfe einer Droge in die Zeit zurückreist und herausfindet, wer tatsächlich hinter dem biblischen Sündenfall steckt …
_Lady Cynthia Asquith: Gebe Gott, dass sie in Frieden ruht_ („God Grante That She Lye Still“, 1931), S. 145-196 – Ein Unfall riss die junge Frau einst aus ihrem Leben, das sie mehr liebte als ihr Seelenheil. Nun drängt sie zurück ins Diesseits und liefert sich mit einer Nachfahrin einen Kampf auf Leben und Tod um deren Körper …
_David H. Keller: Das Ding im Keller_ („The Thing in the Cellar“, 1932), S. 197-208 – Der kleine Junge fürchtet sich vor dem dunklen Keller. Die beschämten Eltern beschließen, ihn durch eine Schocktherapie zu „heilen“; die spektakulären Folgen dürften zumindest den Leser nicht überraschen …
_Clark Ashton Smith: Teichlandschaft mit Erlen und Weide_ („Genius Loci“, 1933), S. 209-240 – Ein böser Geist nistet an einem verwunschenen Ort, wo er auf unvorsichtige Besucher lauert, um sie ins Verderben zu locken …
_Robert Bloch: Das Grauen von den Sternen_ („The Shambler from the Stars“, 1935), S. 241-258 – Wissen ist Macht; dieses alte Sprichwort bewahrheitet sich für einen Amateur des Okkulten, dem der Zufallsfund eines Zauberbuches ersehnte Gewissheiten und einen grausigen Besucher bringt …
_August Derleth: Jenseits der Schwelle_ („Beyond the Threshold“, 1941), S. 259-302 – In den finsteren Wäldern Neuenglands öffnet ein fanatischer Forscher das Tor zu einer Welt, die von abgrundtief bösen, nur halb stofflichen, aber übermächtigen Kreaturen aus der Urzeit des Universums bevölkert wird …
Die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts waren eine Zeit des Umbruchs. Der I. Weltkrieg hatte in Europa die politische Landkarte verändert und gewaltige soziale Umbrüche in Gang gesetzt. Gleichzeitig machten die Naturwissenschaften enorme Fortschritte. Besonders die Physiker drangen in Sphären vor, die sich von den meisten Menschen nur noch ansatzweise erfassen ließen.
Kunst und Literatur blieben von diesen Entwicklungen nicht unberührt. Im phantastischen Genre ging die Ära der klassischen Gespenstergeschichte zu Ende. Natürlich verschwand sie weder abrupt noch vollständig. In dieser Sammlung treffen wir sie bei Seabury Quinn (1889-1969), Lady Cynthia Asquith (1887-1960), David Henry Keller (1880-1966) und Clark Ashton Smith (1893-1961), wobei sie das gesamte Spektrum von trivial (Quinn) über psychologisch (Asquith) bis atmosphärisch (Smith) abdeckt.
Eindrucksvoll ragt aus diesem Quartett die Story von Keller heraus. Dieser recht unbekannte, nicht besonders produktive Autor legt hier eine Geschichte vor, die ihrer Zeit weit voraus ist. Fast dokumentarisch und mit knochentrockenem Humor erzählt er eine bitterböse Gespenstergeschichte, deren Gespenst wie kein einziges Mal zu sehen bekommen. Jeder Satz, jedes Wort steht im Dienst der Geschichte – die Wirkung ist beispielhaft für das Genre!
Jean Ray (d. i. Raymond Jean Marie de Kremer, 1887-1964) baut zumindest in dieser Kollektion eine Brücke zwischen dem „alten“ und dem „neuen“ Horror. Seine „Weiße Bestie“ ist kein übernatürlicher Spuk, sondern ein der Forschung bisher fremdes, aber sehr lebendiges Wesen, das dort, wohin der kluge Zeitgenosse seine Nase nicht stecken sollte, auf allzu Neugierige nicht einmal lauert, sondern einfach nur sein Territorium gegen Fremdlinge verteidigt.
Dieses Konzept wurde Ende der 1920er Jahre von Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) weiter entwickelt und zur Vollendung gebracht. „Cthulhus Ruf“ steht am Anfang einer neuen Ära. Lovecrafts böse Geißeln leben in einer Art Parallelwelt, aber auch sie sind und waren durchaus lebendig. Damit verbinden die Cthulhu-Geschichten die Genres Horror und Science-Fiction.
Die SF gab es zwar schon, aber auch sie hatte just einen neuen Entwicklungsschub bekommen: Mitte der 1920er Jahre fand sie einen reichen Nährboden in den „Pulps“, auf billiges, holzhaltiges Papier gedruckte Magazine. Sie wurden gern gekauft und prägten die Szene etwa ein Vierteljahrhundert. Der Bedarf an Geschichten war gewaltig, die Leser jung, der Gegenwart verhaftet und von der Zukunft fasziniert. Grusel aus der guten, alten Zeit stand nicht mehr hoch im Kurs. Schneller und härter – oft genug auch flacher – wurde die Gangart. Bewährte Ideen wurden gern kopiert oder variiert.
Frank Belknap Long (1903-1994), ein Vollprofi der Pulp-Epoche, beweist es mit „Die Dämonen von Tindalos“. Eine spannende, aber routinierte und kaum originelle Geschichte, die Lovecraft indes nicht gefallen haben dürfte, weil Long etwas tut, das der Einsiedler aus Providence stets vermieden hat: Er verquickt den Cthulhu-Kosmos mit der christlichen Mythologie und weist dem tintenfischköpfigen Unhold und seinen nicht minder unfreundlichen Genossen die Rolle schnöder Bibel-Dämonen zu.
Robert Bloch (1917-1994) macht es mit „Das Grauen von den Sternen“ besser. Trotz seiner Jugend – er war 1935 gerade 18 Jahre alt – kopiert er Lovecraft (der den jungen Kollegen schätzte und förderte) nicht einfach, sondern bringt eigene Ideen in den Cthulhu-Mythos ein. Dazu gehört vor allem „De Vermis Mysteriis“, das fiktive Zauberbuch des Erzmagiers Ludvig Prinn, das der Cthulhu-Jünger heute ebenso häufig zitiert wie Lovecrafts „Necronomicon“.
Lovecraft tritt übrigens persönlich in Blochs Geschichte auf. Der Schriftsteller, der ein ereignisarmes Leben führte, wird hier durch ein Ende geadelt, wie es einem Sucher nach der Realität des Grauens zukommt: Er stirbt in den Klauen einer wirklich fiesen Kreatur, was wiederum ein Insider-Gag ist, da es Abdul Alhazred, den Verfasser des „Necronomicons“, genauso erwischt hatte.
August Derleth (1909-1971) gilt als Lovecrafts treuester Jünger, Diener, Nachfolger und Retter. Unermüdlich hat er nach 1937 dessen Werk an die Öffentlichkeit gebracht. Dass Lovecraft den Ruhm der Gegenwart genießt, verdankt er vor allem Derleth. Gleichzeitig hat sich Derleth Freiheiten herausgenommen, die sein Meister kaum gutgeheißen hätte. Dies betrifft Derleths Drang, das kosmische Grauen Lovecrafts zu „ordnen“, d. h. Cthulhu und die Seinen in eine Art dunklen Götterhimmel einzupassen. Doch für Lovecraft gehört das Chaos mit zum Konzept. Verstehen heißt auch: die Furcht verlieren. Das kann kaum im Sinne einer Gruselgeschichte sein.
Fleißig bastelte Derleth an seiner „verbesserten“ Lovecraft-Vision. Lücken im Konzept werden mit eigenen Kreationen gefüllt. Cthulhu wird dabei zu einer Art Elementargeist unter vielen anderen, deren Namen schwierig zu merken sind. Dass man das noch weiter treiben kann, bewies Derleth 1945 mit „The Lurker at the Threshold“, ein Roman, der unzweifelhaft eine Erweiterung von „Jenseits der Schwelle“ darstellt, und in dem sich die bösen Götter aus dem All quasi gegenseitig auf die Füße treten.
Eine hochinteressante Fußnote stellt Stefan Grabinskis (1887-1936) „Der Blick“ dar. Diese Geschichte belegt, dass Lovecraft weder der erste noch der einzige war, der das Konzept des „kosmischen Horrors“ fand. Grabinski bedient sich seiner bereits 1922 völlig unabhängig von der US-amerikanischen Pulp-Szene und mit einer Souveränität, die belegt, dass diese Veränderung offensichtlich in der Luft lag.
Keith Ablow – Der Diener Gottes
In diversen US-Staaten stellt ein Serienmörder seine Opfer aus: Er entführt Menschen, um sie dann zu vergiften und mit dem Skalpell die Muskeln, einzelne Organe oder Knochen wie für ein anatomisches Modell zu präparieren. Da der Täter keine ethnischen Minderheiten, Außenseiter oder andere Bürger zweiter Klasse metzelt, sondern seine ‚Schaustücke‘ unter den Angehörigen prominenter, d. h. politisch und wirtschaftlich einflussreicher Familien auswählt, erregen diese Fälle Aufsehen. Die Presse bläst zur Hetzjagd auf die mächtig unter Druck geratende Polizei.
Nach dem fünften Mord heuert in Washington Dr. Whitney McCormick, Direktorin der FBI-Abteilung für Verhaltensforschung, den Psychiater Frank Clevenger an. Schon oft hat er ihr bzw. dem FBI beratend zur Seite gestanden. Clevengers Spezialität ist die Erstellung psychologischer Profile, die zu verstehen helfen, was in den Köpfen von Gewalttätern vorgeht, damit man sie mit diesem Wissen identifizieren und aufhalten kann. Keith Ablow – Der Diener Gottes weiterlesen
MacBride, Stuart – Stunde des Mörders, Die
Nach einer katastrophal fehlgeschlagenen Razzia ist der ohnehin angeschlagene Ruf von Logan McRae, Detective Sergeant bei der Grampian Police im ostschottischen Aberdeen, endgültig ruiniert. Nur sein Chef Detective Inspector Insch stellt sich vor ihn, kann aber nicht verhindern, dass McRae zum „Versagerclub“ versetzt wird: Für die verschrobene, manieren- und rücksichtsfreie, nikotinsüchtige Detective Inspector Roberta Steel arbeiten jene Beamte, die für den Dienst schlicht zu dämlich sind oder bestraft werden sollen.
McRaes aktueller Fall ist entsprechend. Die alternde Prostituierte Rosie Williams wurde auf offener Straße zu Tode geprügelt. Niemand will sich der Routinesache annehmen, denn ein publicitywirksamer Massenmord beschäftigt die Grampian Police viel stärker: Sechs Menschen – darunter ein neun Monate altes Kind – wurden in ein baufälliges Haus eingeschlossen und lebendig verbrannt.
Auch ein kaltgestellter McRae ist ein guter Polizist, was DI Steel sehr wohl weiß und für sich auszunutzen gedenkt. Ihr neuer Untergebener findet Hinweise auf einen Serientäter, der mehr als eine Prostituierte umgebracht hat. Leider versteift sich Steel auf einen Verdächtigen, den McRae nicht für den Täter hält.
Als der Feuerkiller ein weiteres Mal zuschlägt, gerät McRae vorübergehend aus dem Sichtfeld seiner Vorgesetzten. Das gibt ihm die Gelegenheit, selbstständig zu ermitteln sowie sich in weitere berufliche Schwierigkeiten zu verwickeln. Die Fährte wird heiß – brandheiß, denn plötzlich stört McRae zwei Killer von „Malk the Knife“, dem heimlichen Herrscher von Aberdeens Unterwelt auf. Unklugerweise beschließt der Detective Sergeant mit einigen Kollegen einen „privaten“ Einsatz, der schrecklich schiefgeht und sie in die Gewalt zweier Gangster bringt, die im „Verhör“ für ihr Geschick im Umgang mit der Geflügelschere berüchtigt sind …
Ein Serien-Brandstifter, ein Serien-Totschläger, diverse vertierte Mafia-Killer, Kinderschänder und rachsüchtige Eheleute sind noch längst nicht alle Finsterlinge, mit denen es die Polizei von Grampion und vor allem Logan McRae zu tun bekommen. Wie schon in „Die dunklen Wasser von Aberdeen“, dem Startband der Serie um den unkonventionellen (gibt’s eigentlich auch andere?) Detective Sergeant McRae, ist der Plot auch dieses Mal ausgesprochen verwickelt bzw. zerfällt in verschiedene Subplots, die ein wenig zu zahlreich ausfallen und den Zufall stärker als manchmal glaubhaft bemühen, um zum Beispiel die heute im Krimi so beliebte „Überraschung in letzter Sekunde“ zu ermöglichen, nachdem der Fall (oder hier die Fälle) längst gelöst scheint.
Immerhin bleibt kein Rätsel ungelöst, während gleichzeitig die Weichen neu für die Fortsetzung der Reihe gestellt werden. McRae und die Grampian Police haben einige Strolche von den Straßen Aberdeens geholt, an den Verhältnissen, die sie dorthin brachten, hat sich jedoch nichts geändert. Vor allem „Malk the Knife“ bleibt ungeschoren und verliert viel Geld, was ihn nicht warnen, sondern reizen und zu neuen Schandtaten anstacheln wird.
Man darf gespannt sein, wie weit MacBride in dieser Hinsicht gehen wird. Der Bodycount ist in den McRae-Romanen schon jetzt für einen britischen Krimi der klassischen Schule ungewöhnlich hoch, doch sind die Schotten seit Jahrhunderten als kriegerisches Volk und nicht zimperlich bekannt. Auch die Freunde des explizit Ekelhaften werden erneut reichlich bedient, wenn Autor MacBride McRae über noch rauchende Feuerleichen oder in Auflösung begriffene Hundekadaver stolpern lässt. Gefoltert wird mit ungetrübter Sicht auf Täter und Opfer, und natürlich werden auch im Bereich der Pathologie neue Maßstäbe gesetzt. Selten wurden Sezierszenen so goretauglich in Szene gesetzt wie zur „Stunde des Mörders“. (Ein dummer weil nichtssagender Titel übrigens, der wohl der Verzweiflung über die Ratlosigkeit, eine deutsche Übersetzung für „Dying Light“ zu finden, geschuldet ist.)
Nicht mit Blut und Schmerz allein treibt MacBride seine Geschichte/n voran. Das menschliche Elend im Angesicht des Verbrechens, sondern auch im Zeitalter einer globalisierten Gesellschaft, die sich immer deutlicher in Gewinner (wenige) und Verlierer (die Mehrheit) scheidet, ist ein integraler Bestandteil der McRae-Romane. Schon vor langer Zeit hat der Krimi sein soziales Gewissen entdeckt. Die Beschwörung bzw. Anprangerung von Missständen funktioniert besser, wenn sie im Rahmen einer spannenden Handlung geschieht; bittere Medizin nimmt man lieber mit ein wenig Zucker. Wie sein Kollege Ian Rankin (jedoch nicht nur er) nimmt MacBride die unheilige Dreieinigkeit des 21. Jahrhunderts aufs Korn: Politik, Wirtschaft und (organisiertes) Verbrechen. Serienkiller sind daneben fast nur Belästigung, denn die von ihnen angerichtete Schäden halten sich in Grenzen. Mafiosi wie „Malk the Knife“ zerstören dagegen ganze Stadtteile, in denen sie praktisch die Macht an sich reißen und selbst die „unabhängige“ Presse für sich einspannen. Straßenkriminalität, Drogensucht, Prostitution, Frauenhandel: Endlos ist die Liste des Üblen, das dem folgt. MacBride integriert es immer wieder in die Handlung und entwirft ein Bild der Gegenwart, das die Resignation seines Helden erklärt.
Die brutale Wucht der Wahrheit wird geschickt durch einen Humor gemildert, der in seiner Intensität und Konsequenz ziemlich einmalig ist. Die Welt ist ein Irrenhaus, und man sollte sie deshalb nicht gar zu ernst nehmen, wenn man überleben möchte. Ein wenig Gelächter kann befreiend wirken. MacBride versteht die Kunst, es zu wecken (und der Übersetzer hat sich erfolgreich bemüht, den bekanntlich komplexen angelsächsischen Humor ins Deutsche zu retten). Er sieht die Situationskomik, die auch dem Traurigen und Tragischen innewohnt. Wie er sie in Szene setzt, irritiert manchmal, zumal MacBride ein wenig zu oft auf den Heiterkeitseffekt deftiger Flüche, drastischer Pornografie oder Körperausscheidungen setzt, aber er nimmt dem alltäglichen Grauen, das sonst in der Häufung, in welcher MacBride es auf seine Leser niedergehen lässt, schier unerträglich wäre, seine Schärfe.
Wenn es uns wirklich an Herz und Nieren gehen soll, schaltet der Verfasser den Humor plötzlich ab. Das lässt die Ernüchterung umso stärker wirken, denn jetzt zeigt MacBride, dass er auch Emotionen wie Grauen und Schmerz zu wecken versteht. Selbst gute Witze sind manchmal unangebracht. MacBride versteht dies und hält sich daran. Wenn der unglückselige Reporter Colin Miller Stück für Stück seine Finger unter der Geflügelschere seiner Peiniger verliert, ist das nur grauenhaft und nie komisch.
Wirklich „realistisch“ wirkende Personen treten in „Die Stunde des Mörders“ nicht auf. MacBride setzt auf die (gelungene) Überzeichnung seiner Figuren, die durch markante Marotten im Gedächtnis haften. Vor allem mit der Figur der DI Steel läuft der Verfasser dieses Mal zur Hochform auf. Sie erinnert nicht nur an Reginald Hills unvergleichlichen Andy Dalziel, sondern wirkt wie dessen verschollene Schwester im Geiste (und im Polizeidienst). Nichts und niemand ist vor ihrem drastischen Spott sicher, der dazu mahnt, Regeln und Normen in Frage zu stellen, statt sich ihnen anzupassen. Immer wenn man meint, den Charakter Steels in seiner ganzen Primitivität erfasst zu haben, schlägt uns MacBride ein Schnippchen, indem er plötzlich tiefere menschliche Regungen offenbart: Steel spielt die Rolle des Ungeheuers, die sie tarnt und ihr innerhalb des Systems eine Bewegungsfreiheit garantiert; eine Taktik, die sich besagter Dalziel ebenfalls zu Eigen gemacht hat.
Reginald Hill spielt freilich intellektuell in einer anderen Liga. Er schöpft seine Bosheiten aus einem immensen literaturgeschichtlichen Wissen, so dass manche Anmerkung des nur scheinbar grobschlächtigen Dalziel die Verwendung von Fußnoten erforderlich macht. Das ist bei MacBride überflüssig. DI Steel ist definitiv keine gebildete Person, wenn auch eine Persönlichkeit, und MacBride ficht in Sachen Humor wie bereits erwähnt eine wesentlich breitere Klinge.
Logan McRae drängt der Verfasser zeitweise zu stark in die Peter-Pascoe-Rolle des duldsamen Assistenten, der einerseits die Wand darstellt, an die Steel ihre einfallsreichen Bosheiten schmettert, während er andererseits die eigentliche Detektivarbeit leistet. In „Cold Granite“ wirkte McRae nicht so „vernünftig“. Er ist tatsächlich auch jetzt noch exzentrisch genug, doch er sitzt im Polizeirevier von Grampion, das so ausschließlich mit Witzbolden, Spinnern und Nulpen besetzt ist, dass es mit einem „richtigen“ Krimi schwer vereinbar scheint. Erst im Finale kommt der Querkopf und Querdenker McRae wieder zum Vorschein.
In der Darstellung seiner Mörder und Serienkiller lässt MacBride die notwendige Zurückhaltung walten. Es wäre kontraproduktiv, auch sie in Witzgestalten zu verwandeln. Als „normale“ Menschen kann man sie ebenfalls nicht betrachten. Ihre Seltsamkeiten erschrecken jedoch und stoßen ab. Das Böse ist nicht komisch, und seine Bekämpfung laugt aus. Kein Wunder, dass McRae und Co. sich in skurriles Verhalten flüchten. Sie sind uns in ihrer individuellen Verrücktheit ans Herz gewachsen, was uns – wie vom Verfasser geplant – gespannt auf den dritten Band der McRae-Serie warten lässt.
Stuart MacBride wurde (in einem Jahr, das sich nicht ermitteln ließ) im schottischen Dumbarton geboren. Die Familie zog wenig später nach Aberdeen um, wo Stuart aufwuchs und zur Schule ging. Studiert hat er an der University in Edinburgh, die er indes verließ, um sich in verschiedenen Jobs (Designer, Schauspieler, Sprecher usw.) zu versuchen. Nach seiner Heirat begann MacBride Websites zu erstellen, stieg bis zum Webmanager auf, stieg in die Programmierung ein und betätigte sich in weiteren Bereichen der Neuen Medien.
Stuart MacBride lebt heute wieder in Aberdeen. Über Leben und Werk informiert er auf seiner Website [www.stuartmacbride.com,]http://www.stuartmacbride.com die er um einen Autorenblog sowie eigene Kurzgeschichten erweitert hat.
Die Logan-McRae-Serie erscheint im |Wilhelm Goldmann|-Verlag:
1. [Die dunklen Wasser von Aberdeen 2917 („Cold Granite“, 2005)
2. Die Stunde des Mörders („Dying Light“, 2006)
http://www.goldmann-verlag.de
Cox, Greg – Underworld – Blutfeind
Seit Jahrhunderten tobt ein erbitterter Krieg zwischen Vampiren und Werwölfen. Zwei moderne Episoden dieser Auseinandersetzung schildern die Filme „Underworld“ und „Underworld: Evolution“ (die – s. u. – unter diesen Titeln auch als Filmromane existieren), während „Underworld – Blutfeind“ vom Ursprung des Krieges erzählt: Einst lebten Vampire und Menschen im mühsam gewahrten Frieden miteinander. Die zwar unsterblichen und mit unglaublichen Kräften begabten aber zahlenmäßig unterlegenen Vampire hüteten sich, ihre menschlichen Nachbarn durch die Auferlegung eines allzu großen Blutzolls aufzubringen. Leider hielt sich eine dritte Partei nicht an diese Spielregel: Die Lycaner oder Werwölfe lebten als wilde Tierwesen in den Wäldern, aus deren Schutz sie immer wieder die Siedlungen der Menschen überfielen und für blutigen Terror sorgten.
Die Vampire versuchten solche Übergriffe zu stoppen, indem sie einerseits selbst Jagd auf die Lycaner machten und die Überlebenden andererseits versklavten. Einige konnten „zivilisiert“ werden. Anfang des 13. Jahrhunderts gehört Lucian zu ihnen. Seit zwei Jahrhunderten dient er der Lady Ilona auf Schloss Corvinus in den Karpaten. Sie gehört zum Hochadel der Vampire, ist sie doch mit dem Ältesten Marcus liiert, der in Kürze die Oberherrschaft über sein Volk übernehmen wird. Lucian ist wohlgelitten auf Corvinus, doch er gilt trotzdem als Wesen zweiter Klasse. Deshalb verbirgt er sorgfältig seine Liebe zur schönen Sonja, der Tochter Ilonas.
Wider Erwarten kommen sich die beiden näher, als nach besonders grausamen Übergriffen der Werwölfe der Mönch Ambrosius Ilonas Tross überfallen lässt, der den Schutz des Schlosses verlässt. Lucian und Sonja sind unter den wenigen, die entkommen. Ihre unmögliche Liebe keimt auf, die eines Tages dem erzürnten Marcus offenbart wird. Grausam ist seine Strafe, und der schwer verletzt entkommene Lucian gelobt ihm und allen Vampiren Rache – ein Schwur, den er seit acht Jahrhunderten mit unerbittlicher Konsequenz hält …
Die Existenz des „Underworld“-Franchises ist ein eigenartiges Phänomen, denn es stützt sich auf einen wirren Auftaktfilm und seine noch schlimmere Fortsetzung. „Underworld“ und „Underworld: Evolution“ bieten eindimensionale, inhaltlich aus besseren Filmen zusammengeklaubte, im epileptischen MTV-Stil geschnittene Horror-Action. Der tricktechnische Overkill, die dick aufgetragene „Coolness“ der harthölzernen Darsteller sowie Kate Beckinsale im hautengen Lederdress haben jedoch ihre Fans gefunden, denen mit einer breiten Palette diversen Schnickschnacks noch ein bisschen mehr Geld aus der Tasche gezogen werden soll.
Dazu gehören „tie-ins“, Romane zu den beiden Filmen, die aufgrund der flachen Handlung zwar wenig Inhalt vermuten lassen, aber andererseits ein wenig Sinn in die turbulenten Kloppereien zwischen Vampiren und Werwölfen bringen können. Die Niederschrift übernahm Greg Cox, ein Veteran auf dem Schlachtfeld des Filmromans, dem es tatsächlich gelang, „Underworld“ und „Underworld: Evolution“ zu zwei dicken Buchschwarten aufzuschäumen. Sicherlich wäre auch die Romanfassung des geplanten „Underworld“-Prequels aus seiner Feder geflossen, hätten die vergleichsweise enttäuschenden Kassenerträge des zweiten Teils nicht zu einem Stopp der Serie geführt. Ein Buch zur Vorgeschichte des Krieges zwischen den Untoten hat Cox dennoch geschrieben und es „Underworld: Blutfeind“ genannt.
Wie es sich für einen guten „Tie-in“-Fabrikanten gehört, hält sich Cox dicht an die dem „Underworld“-Fan vertrauten Fakten. Bei näherer Betrachtung verlegt er die bekannte Handlung einfach aus der Gegenwart in die Vergangenheit und verankert sie auf einem Fundament, das bewährt und haltbar ist, wurde es doch ausschließlich aus vielfach geprüften Elementen zusammengesetzt. Irgendwie müssen sich Vampire und Werwölfe einst bitter zerstritten haben. Komplexe Erklärungen widersprechen der Konstruktion des „Underworld“-Universums. Deshalb wählt Cox eine tragische Liebesgeschichte mit viel Dramatik und Verrat, denn das funktioniert auf bescheidenem Niveau immer.
Cox belastet uns nicht mit historischen Fakten; die Geschichte spielt um 1200 „in den Karpaten“. Man könnte die folgenden Jahrhunderte ebenso annehmen wie das Mittelalter, „Vergangenheit“ ist hier nur eine weitere Schablone, aus der Klischees gestanzt werden. Cox ist immerhin Profi genug, sein Garn ohne Knotenbildung abzuspulen. „Underworld: Blutfeind“ läuft ab wie geschmiert. Die simple, mit dicken Strichen weniger gezeichnete als angedeutete Story setzen das Kino im Kopf der „Underworld“-Leser in Gang, die auf einen „richtigen“ Film dieses Mal verzichten müssen. Für diejenigen, die sexy Selene und die Straßenschlachten zwischen Vampiren und Werwölfen im 21. Jahrhundert vermissen, hat Cox einen Handlungsstrang entworfen, der auch sie zufriedenstellt.
Damit hat Greg Cox nüchtern betrachtet seinen Job getan. Die geschäftsmäßige, beinahe zynische Kaltschnäuzigkeit, mit der das Produkt mit möglichst geringem Aufwand auf seine Verbraucher zugeschnitten wird, mag diejenigen, die wirklich „gute“ Horrorromane kennen bzw. zu erkennen vermögen, verblüffen und erschrecken. Für dieses Publikum wurde „Underworld: Blutfeind“ jedoch nicht geschrieben.
Romeo & Julia treten dieses Mal in unorthodoxen Gestalten auf, sind aber trotzdem leicht zu identifizieren: Der schmucke Werwolf liebt das schöne Vampirmädchen, aber ach, es trennen sie buchstäblich Welten: Lucian ist ein Sklave, für den sich seine Herren hin und wieder ein Wort des Lobes abringen, Sonja gehört nicht nur zum vampirischen Hochadel, sondern ist auch die Tochter von Marcus, einem Vampir-Ältesten, der sein untotes Volk als Herrscher leitet.
Lucian steht darüber hinaus zwischen den Stühlen, weil er als Lycaner einen Job ausübt, der ihm zunehmend zu schaffen macht: Er führt die Vampire in die Lager der „wilden“ Werwölfe, die anschließend ausgerottet oder in die Sklaverei verschleppt werden. Darin ist er gut, aber wenn Lucian das Elend sieht, das die Vampire mit seiner Hilfe über die Lycaner bringen, fragt er sich, ob er richtig handelt. Wer ist er, den seine Herren nicht nur „zivilisiert“, sondern auch manipuliert haben?
Der Funke der Rebellion wäre sicherlich noch lange nicht aufgeflammt, hätte die schöne Sonja ihn eines Tages nicht erhört. Damit bringt sie ihren Vater und alle übrigen Vampire gegen sich auf, rüttelt sie doch an einem grundsätzlichen Tabu ihres Volkes: Eine Vermischung der Rassen darf nicht stattfinden! Selbst Nikolai, Markus‘ Sohn, gilt als dekadent, weil er sich mit menschlichen Liebesdienerinnen umgibt. Doch die Lycaner stehen sogar noch tiefer in der Hierarchie – sie gelten als halb tierische Kreaturen, weil sie sich bei Vollmond in Wölfe verwandeln, die nicht mehr vom Verstand geleitet, sondern von Instinkten beherrscht werden.
Für Lucian geht es ums nackte Leben. Als die Liaison öffentlich wird, hat er sich im Grunde längst entschieden und weigert sich, in der ihm zugewiesenen Rolle zu verharren. Er wird seine Strafe nicht akzeptieren, weil er sich nicht als Verbrecher fühlt. Intelligent und entschlossen wie er ist, schlägt er sich auf die Seite derer, die allein ihn gegen die Vampire schützen können: Lucian – ein mondsüchtiger Spartakus – wird zum Herrn und Lehrer der Werwölfe, die sich unter seiner Führung der Macht bewusst werden, die sie zum gleichwertigen Gegner der Vampire werden lässt.
Wem das zu komplex und psychologisch anspruchsvoll erscheint, sei beruhigt: Es wird literarisch auf Kurzrasenniveau präsentiert und mit sämtlichen Klischees bestückt, die sich der Horrorfan denken (oder über die er sich ärgern) kann. Die angestaubte Konstellation bietet Raum für weitere Pappkameraden. Selbstverständlich sind sowohl Marcus als auch Victor – der ihm später auf den Thron folgt – engstirnige Gewaltherrscher, die zudem den Einflüsterungen tückischer Verräter zugänglich sind. Falls das Alter wirklich Weisheit bringt, hat sie einen weiten Bogen um unsere Vampirfürsten geschlagen. Das gilt ebenso für die Lycaner, obwohl Lucian sie erst ordentlich schleifen muss, damit sie sich in der ihnen zugewiesenen Gegnerrolle nicht völlig blamieren. Ketzerisch ist die Frage, wieso beide Parteien nach 800 Kriegsjahren keinen Schritt weitergekommen sind – ketzerisch deshalb, weil sie einen tieferen Sinn in „Underworld: Blutfeind“ vermuten ließe, den es ganz sicher (den „Underworld“-Fans sei es garantiert) nicht gibt.
Greg Cox (geb. 1959) gehört zu den Autoren, die sich mit Haut und Haaren dem Verfassen sog. „tie-ins“ verschrieben haben: Er schreibt sehr erfolgreich Romane zu Filmen und Fernsehserien, die zum jeweiligen Franchise gehören und mit ihren Erträgen zum Gesamtgewinn beitragen. Literarische Qualität ist in diesem Umfeld eher ein Schimpfwort. Weitaus wichtiger ist die rasche Produktion und pünktliche Lieferung eines Titels, der zum Film- oder Serienstart im Buchladen liegen muss. Dort bleibt er nicht lange, denn die Halbwertzeit für einen „Tie-in“-Roman ist kurz und in der Regel mit der Zeitspanne identisch, die ein Film im Kino und eine TV-Show im Fernsehen läuft.
Cox erfüllt auch die zweite Anforderung eines „Tie-in“-Routiniers: Er findet den „Ton“ der jeweiligen Filme, den er in seine Bücher überträgt. Die Leser entdecken, was sie an den Vorlagen schätzen, und nehmen dabei in Kauf, dass sie nie mit wirklich Originellem konfrontiert werden, weil das Franchise ein Verharren im Status quo fordert: Mögliche Entwicklungen sollen dem Film vorbehalten bleiben, der die höheren Einkünfte garantiert.
Seit anderthalb Jahrzehnten schreibt Cox spannende aber anspruchslose Geschichten zu Blockbustern wie „Daredevil“, „Underworld“ oder „Ghost Rider“. Im TV-Segment gehört er zu den „Stammautoren“ der „Star Trek“-Serien, die er nach ihrem Auslaufen um halbwegs eigenständige Fortsetzungen bereichern kann. Zu den Fernsehserien, die Cox in Buchform aufleben ließ, gehören „Roswell“ und „Alias“. Storys lieferte er zu Sammelbänden mit neuen Abenteuern von „Xena“ und „Buffy“.
Grex Cox lebt in Oxford, Pennsylvania. Über sein umfangreiches Werk informiert er auf seiner Website http://www.gregcox-author.com.
Die „Underworld“-Trilogie wurde von Greg Cox verfasst und erscheint im |Panini|-Verlag:
1. Underworld (TB Nr. 1308)
2. Underworld – Evolution (TB Nr. 1309)
3. Underworld – Blood Enemy (dt. „Blutfeind“, TB Nr. 1343)
http://www.paninicomics.de
Spignesi, Stephen – Titanic. Das Schiff, das niemals sank. Chronik einer Jahrhundertlegende
Auf dieser Welt gibt es Menschen, die müssen mindestens eines ihrer früheren Leben als Hamster geführt haben. Nach ihrer Wiedergeburt mögen sie zwar die Evolutionsleiter hinaufgestiegen sein, doch der Drang zu sammeln und zu horten prägt ihr Wesen und ihr Verhalten weiterhin überdurchschnittlich stark. Allerdings schleppen sie nun nicht mehr Maiskörner und ähnliche Esswaren in ihre Höhle, sondern Informationen. Ein Grundsatz ist freilich derselbe geblieben: Quantität geht allemal vor Qualität!
Steven Spignesi ist einer jener Zeitgenossen, die ihre Erfüllung darin finden, Daten, Fakten und Bilder zusammen zu tragen, lange Listen aufzustellen und dieses kunterbunte Gemisch dann als „Sachbuch“ zu verkaufen, ohne sich mit dem Spinnen eines roten Fadens aufzuhalten. Bevor er sich dem berühmtesten Schiffswrack der Weltgeschichte widmete, hat er wie beschrieben über den Regisseur und Schauspieler Woody Allen, die Beatles und den Schriftsteller Stephen King „informiert“. Die „Titanic“ ist längst zu einer prominenten Persönlichkeit geworden, so dass die vorliegende Kompilation recht gut in die Reihe der Spignesi-Werke passt.
Seit der Luxusliner zum wiederholten Male, aber 1997 dank James Cameron besonders spektakulär im Kino untergegangen ist, sind allerdings auch schon wieder einige Jahre vergangen. Das Interesse ist zwar noch da, das echte „Titanic“-Fieber allerdings geschwunden, die Flut der Bücher, TV-Dokumentationen und anderer profitabler Devotionalien längst abgeklungen. Spignesi kommt also eigentlich ein wenig zu spät, aber das passt gut ins Bild vom eifrigen, aber wenig inspirierten Freizeit-Autoren, der geduldig den Datenschutt seiner professionelleren Vorgänger durchsiebt und triumphierend das eine oder andere bisher übersehene oder leicht ramponierte, aber noch halbwegs präsentable Fundstück hervorzieht.
Zu den Wissenslücken, die Spignesi auf diese Weise schließen kann (ohne dass sie seinen Lesern bisher aufgefallen wären), gehört zum Beispiel der Fund der Auslaufgenehmigung der „Titanic“, die hier zum ersten Mal im Wortlaut abgedruckt wird. Wieso er gerade dieses Dokument (und einige weitere, historisch ebenfalls eher belanglose Quellen) präsentiert, darüber hüllt sich der Autor in Schweigen.
Ebenso willkürlich ausgewählt sind die weiteren Zeugnisse zur letzten Reise der „Titanic“, als da u. a. wären: eine (sehr) knappe Chronik der Ereignisse, die (lückenhaft) auch die Vorgeschichte sowie die Jahre der Suche ab 1912 erfasst und sogar einen Vorausblick bis ins das Jahr 2002 wagt (dann sollte nämlich die „Titanic II“ vom Stapel laufen, woraus bekanntlich nichts geworden ist); Kurzporträts einiger prominenter, aber auch „normalsterblicher“ Passagiere (immer eine probate Methode, Seiten zu füllen); natürlich Augenzeugenberichte vom Untergang selbst (quasi ein Blick aus jeder Perspektive auf das im Wasser versinkende Heck); Auszüge aus dem „Bericht zum Verlust der TITANIC“ des britischen Handelsministeriums (liest sich genauso spannend wie der Titel verheißt) oder eine Reihe von Artikeln aus Zeitungen des Jahres 1912 (wenig aussagekräftig, da schon die zeitgenössische Presse wilde Spekulationen der ohnehin nur bruchstückhaft bekannten Wahrheit vorzog).
In einem eigenen Kapitel raunt Spignesi verheißungsvoll von einem „Jahrhundert voller Geheimnisse“, die sich um die Tragödie ranken, doch wenn es dann gilt, Farbe zu bekennen, muss er zugeben, auch keine Lösungen parat zu haben. Kapitän Smiths letzte Worte bleiben also weiterhin ein Geheimnis, was wahrscheinlich seinem Ruf eher förderlich ist; wie peinlich, sollte sich etwa herausstellen, dass er mit einem Fluch auf den Lippen statt „Rule Britannia“ gestorben ist.
Widerstehen konnte Spignesi natürlich auch nicht der Versuchung, die gewagte Verschwörungstheorie eines wirrköpfigen „Titanic“-Chronisten aufzuwärmen, der in den 1990er Jahren der Presse behilflich war, die Sauregurkenzeit des Hochsommers zu überbrücken. Er behauptete, nicht die „Titanic“, sondern ihr Schwesterschiff, die „Olympic“, sei 1912 im Atlantik versunken bzw. im Zuge eines gewaltigen Versicherungsbetruges versenkt worden. Diese hanebüchene Mär wurde längst und mit Leichtigkeit widerlegt; Spignesi hätte gut darauf verzichten können, dies noch einmal im Alleingang zu „beweisen“, aber die Geschichte ist halt einfach zu schön!
Neben solchem Seemannsgarn dürfen natürlich einige Pfeiler des multimedialen „Titanic“-Epitaphs nicht fehlen. Spignesi fasst daher noch einmal zusammen, was ohnehin schon jede/r wusste: An Berichten über die Suche nach und die Entdeckung der „Titanic“ durch Robert Ballard und sein Team im Jahre 1986 herrscht wirklich kein Mangel, und auch Regisseur James Cameron schaute ein Jahrzehnt später die Weltpresse über die Schulter, als er sein ganz persönliches Monumentalwerk zur Tragödie drehte.
Wohl weil er nun gar nicht mehr wusste, wo er sie thematisch unterbringen konnte, auf ihre Wiedergabe aber nicht verzichten mochte, schließt Spignesi sein Werk mit einem seitenlangen Blick auf die Frachtliste der „Titanic“ – und siehe da: Was dort im Bauch des Riesenschiffs nach Amerika reisen sollte, birgt wahrlich keine Sensationen. Schön, dass man sich davon dank Spignesi selbst überzeugen kann; allerdings hätte man ihm dies durchaus geglaubt, hätte er es in ein, zwei Sätzen abgehandelt.
Obwohl der Untertitel etwas Anderes suggeriert, ist die „Titanic“ im Jahre 1912 sehr wohl im Meer versunken. Bis auf weiteres ist zu diesem Thema alles gesagt. Die echte „Titanic“ wird das nächste Mal 2012 ins Zentrum des öffentlichen Interesses rücken, wenn sich der Tag des Untergangs zum 100. Mal jährt. Wie Spignisi eindrucksvoll (wenn auch unfreiwillig) belegt, ist es ratsam, dem Schiff und seinen unglücklichen Passagieren bis dahin eine publizistische Pause zu gönnen. Doch „Titanic“ steht inzwischen nicht mehr für ein tragisches, historisch im Grunde wenig bedeutsames Ereignis: Über die Welt des Jahres 1912 sind wir so gut informiert, dass es absolut überflüssig ist, aufwändig nach Artefakten auf den Grund des Ozeans zu tauchen. Die sieben Buchstaben des Schiffsnamens bilden heute so etwas wie ein Markenzeichen, das sich aufgrund des traumhaft hohen Bekanntheitsgrades wunderbar vermarkten lässt. Leider ist es nicht möglich, den Namen gesetzlich schützen zu lassen – das muss ein Albtraum für Marketingstrategen sein.
Über das, was die „Titanic“ – im 21. Jahrhundert kaum mehr als ein Haufen rostigen Schrotts, der sehr bald in sich zusammenfallen wird – tatsächlich noch erwähnenswert macht, schweigt sich Spignesi leider aus – das Gerangel zahlreicher Interessengruppen nämlich, die sich unter dem Deckmantel vorgeblich ehrenwerter Motive erbittert darüber streiten, was mit dem Wrack geschehen soll. Ob es nun Gedenkstätten-Touristen sind, die über der Unglücksstätte ankern, Kränze über Bord werfen und Krokodilstränen im Andenken an Menschen vergießen, mit denen sie persönlich rein gar nichts verbindet, oder „Historiker“, die nach verbeulten Klosettschüsseln des Modells „TITANIC 1912“ angeln, um sie den ehrfurchtsvoll staunenden Nachfahren der versunkenen Seefahrer im Rahmen weltweit wandernder Sonderausstellungen wie Ikonen zu präsentieren, oder schlichte „Dokumentaristen“, die „nur schauen“ wollen und anschließend stolz verkünden, jedes am Wrack aufgewirbelte Sandkorn sorgsam zurück auf seinen Platz gelegt zu haben: Die wahre Lehre, die man aus diesem Trauerspiel ziehen kann (wenn man denn Wert darauf legt), ist doch wohl die, dass sich die Menschen seit 1912 nicht geändert (oder gebessert) haben. Eine fatale Mischung aus Unwissen, fehlgeleitetem Übereifer und Profitgier (abgerundet durch gute, alte Dummheit) hat die „Titanic“ untergehen lassen. Damals wie heute war und ist das Schiff unabhängig davon, ob es mit Volldampf gen USA fährt, am Meeresgrund vor sich hin rostet, durch eine Disneyland-Kopie nachgeäfft oder gar gehoben wird, nur ein Spielball divergierender Interessen. Womöglich ist das ja die wahre Tragödie der „Titanic“. (Nebenbei: Trotz aller galligen Einwände liest sich Spignesis Kuriositätenkabinett über lange Strecken durchaus flott und unterhaltsam – man darf eben nur nicht auf den Titel hereinfallen, der eine „Chronik“ oder gar „das komplette Handbuch“ in Aussicht stellt.)
Loomis, Chauncey – Verloren im ewigen Eis. Der rätselhafte Tod des Arktisforschers Charles Francis Hall
Im Jahre 1845 laufen in England zwei Schiffe zu einer historischen Expedition aus: Sir John Franklin, Held zahlreicher Entdeckungsreisen, hat es sich in den Kopf gesetzt, endlich die sagenhafte Nordwestpassage zu finden, die angeblich quer über den nordamerikanischen Kontinent läuft und in den Pazifik mündet. Dieser natürliche Kanal würde die Reise zu den lukrativen Geschäftsgründen Asiens um einiges verkürzen. Neben handfeste wirtschaftliche Gründe treten darüber hinaus patriotische Erwägungen: Die Briten beherrschen die Weltmeere, ihr Empire breitet sich über den Globus aus, und deshalb stellen sie auch die tüchtigsten und fähigsten Forschungsreisenden – Punkt! Ein Vierteljahrhundert wurde bereits nach der Nordwestpassage gefahndet, und Franklin wird sie nun gefälligst finden!
Leider lehnt es die Realität ab, sich dieser Argumentation zu unterwerfen. Mit der |Erebus| und der |Terror| verschwinden über einhundert Menschen im Dunkel der nordpolaren Gewässer. Nächstenliebe ist eigentlich keine Eigenschaft, die das 19. Jahrhundert auszeichnet, doch John Franklin ist kein „normaler“ Mensch, sondern ein Idol seiner Epoche, und so wird sein ungewisses Schicksal als nationale Tragödie betrachtet. Zwischen 1848 und 1853 machen sich mehr als dreißig Suchmannschaften auf den beschwerlichen Weg in die endlosen Weiten der nordamerikanischen Polarwüste. Viele fallen selbst der grausamen Natur zum Opfer – und meist tragen sie allein die Schuld an ihrem Ende, denn die Entdeckungsreisenden aus Europa und den noch jungen USA erforschen ferne Länder nicht: Sie erobern sie, und je größer die Qualen sind, die sie dabei erleiden, desto süßer schmeckt der Sieg!
Daher haben sich Franklin und jene, die nach ihm kamen, niemals wirklich Gedanken darüber gemacht, dass es dort, wo sie frieren und hungern, schon seit ewigen Zeiten Menschen gibt: Die Inuit oder Eskimo haben sich an das Klima und die Lebensbedingungen angepasst und führen ein hartes, aber zufriedenes Leben. Aber sie sind Wilde und Heiden, und der wahre Gentleman stirbt eher in luftiger Tuchkleidung und mit einem Zylinder auf dem Kopf (das ist die Uniform für britische Offiziere zur See – und sie wird in der Nordsee wie in der Karibik oder auf dem Polarmeer getragen …), als dass er sich auf ihr Niveau begäbe!
Genau an dieser Mischung aus Unwissenheit, Hochmut und Dummheit ist die Franklin-Expedition längst zugrunde gegangen. Das ahnt man allmählich in Großbritannien und in den USA, wo die Suche aufmerksam verfolgt wurde, aber man weiß nichts Genaues. Unter denen, die diese Ungewissheit nicht nur zu schaffen macht, sondern zu Taten drängt, ist in der Stadt Cincinnati im US-Staat Ohio, einem Ort, der dem Nordpolarkreis denkbar fern liegt, der erfolgreiche Geschäftsmann und Verleger Charles Francis Hall. Niemand würde in ihm einen Nachfahren Columbus‘ oder Magellans vermuten, doch tatsächlich brodelt in Hall schon lange das Fernweh. Zwischen 1860 und 1871 unternimmt er zwei Expeditionen, die ihn jeweils über mehrere Jahre in den äußersten Nordosten des nordamerikanischen Kontinents führen. Aus dem enthusiastischen, aber unerfahrenen Abenteurer wird ein erfahrener Reisender, der nicht nur über-, sondern sich einlebt, weil er begreift, dass man in Norden nicht gegen, sondern mit der Natur leben muss. Hall lernt bereitwillig von den Inuit, er unternimmt ausgedehnte Fahrten über das Eis, findet die Relikte früherer Polarforscher – aber niemals eine Spur von der Franklin-Expedition.
Doch Charles Hall wird trotz aller scheinbaren Weltoffenheit niemals ein echter Bewohner des Nordens. Er kann und will nicht von seiner strengen Frömmigkeit ablassen. Mit den Inuit lebt er weniger zusammen, als dass er sich zu ihnen herablässt. Sein ungestümes Temperament bringt ihn immer wieder in gefährliche Situationen – kurz: Hall verlässt sich ahnungslos ein wenig zu sehr auf die Gunst des Schicksals. Er sieht sich als Bezwinger des ewigen Eises, und als solcher fasst er ein neues, schier wahnwitziges Ziel ins Auge: Er will als erster Mensch den Nordpol erreichen!
Mit der ihm eigenen Energie gelingt es ihm, ein Schiff zu finden und eine Besatzung zusammenzustellen, doch dieses Mal verlässt ihn sein Glück: Auf der [„Polaris“ 311 beginnt 1871 eine Reise ins Herz der Finsternis, die in Streit, Wahnsinn, Schiffbruch und womöglich Mord endet und die Überlebenden für den Rest ihres Lebens zeichnen wird …
„Verloren im ewigen Eis“ ist ein Sachbuch im besten Sinne des Wortes: Wissen wird dem Leser in leicht verständlicher Form präsentiert, ohne dass die Fakten „vereinfacht“ würden. Chauncey Loomis ist auf seine Weise selbst ein Besessener vom Schlage Halls, dessen Schicksal ihn seit Jahrzehnten bewegt. „Verloren …“ ist sichtlich das Resultat langwieriger und penibler Recherchen; kein Schnellschuss auf der Jagd nach dem Buchmessen-Bestseller der Saison. Chauncey hat viel Zeit in diversen Archiven verbracht; als Dozent für englische und amerikanische Literatur wusste er, wie und was er dort zu suchen hatte. Aber er klebte nicht an seinem Schreibtisch, sondern hat im Laufe der Jahre viele der Orte, die Hall einst bereiste, selbst besucht – und er ist dem Subjekt seiner Recherchen dabei buchstäblich bis ins Grab gefolgt.
So ist „Verloren …“ ein Kleinod auf dem Gebiet der historischen Reiseliteratur. Halls Erlebnisse werden immer wieder in die Geschichte des 19. Jahrhunderts eingebettet; vor diesem Hintergrund wird vieles klar, was heute fremd erscheint, denn die Welt vor 150 Jahren folgte eigenen, längst vergangenen Regeln. Mit spielerischer Leichtigkeit (die definitiv das Ergebnis harter Arbeit ist) verbindet Chauncey Fakten, Erläuterungen und Anekdoten zu einem echten „Pageturner“. Er hatte dabei Glück: Hall war ein eifriger Tagebuchschreiber. Aber auch hier zeigt sich Chaunceys souverän der Informationsflut gewachsen. Er zitiert nicht einfach, sondern wählt aus, prüft nach und interpretiert dort, wo es ratsam erscheint. Außerdem verschweigt er endlich einmal nicht jene Passagen, die kein so gutes Licht auf ihren Schreiber werfen. Es ist eigentlich eine bekannte Tatsache, dass berühmte Entdecker auf Reisen oft wenig von der menschlichen Größe an den Tag legten, die sie sich selbst in ihren Büchern bescheinigten, oder die ihnen ihre bewundernden Zeitgenossen und Nachfahren unterstellten. Dabei nahmen sie vor Ort durchaus kein Blatt vor den Mund und verewigten ihre (Un-)Taten womöglich selbst in später sorgfältig zensierten Aufzeichnungen. Hall war hier keine Ausnahme. Kluger Kopf, der, aber ungebildet, wie er war, hielt er sogar geradezu exemplarisch fest, wie die Forscher seiner Zeit über die unglücklichen Einheimischen kamen, ihnen Krankheiten, Alkohol oder die zweifelhaften Segnungen der christlichen Religion brachten, sie ohne Skrupel als lebendige Ausstellungsobjekte in die Fremde verschleppten oder wie selbstverständlich voraussetzten, von ihnen, die kaum echten Grund hatten, sich dem Forscherdrang zu ergeben, in gefährliche Region geführt oder gar noch bedient zu werden.
„Verloren …“ ist die erweiterte, aktualisierte Neuausgabe eines Buches, das zum ersten Mal Ende der 60er Jahre erschien. Chauncey tat gut daran, die Forschungsergebnisse der seither verstrichenen Jahrzehnte zu berücksichtigen, denn in der verstrichenen Zeit konnten doch einige damals notgedrungen offene Fragen geklärt werden. Aber in einem Punkt ist Chauncey hart geblieben: In der Frage, ob Charles Hall nun ermordet wurde oder einem Unfall zum Opfer fiel, legt er sich (zum Kummer seines Lektors) auch jetzt nicht fest. Die Indizien reichen eben für eine endgültige Entscheidung nicht aus, und Chauncey ist redlich genug, historische Genauigkeit vor marktschreierische Werbewirksamkeit zu setzen.
Mut beweist der Verlag mit der Wahl des Titelbildes. Wir sehen dort den kühnen Forscher Hall im Porträt gewürdigt; allerdings nicht als zeitgenössisches Foto oder Kupferstich, sondern so, wie er 1968 vorgefunden wurde, als ihn seine von Wissbegier durchdrungenen Nachfahren aus seinem eisigen Grab hoben – als verweste Leiche, deren Anblick selbst den (medien-)horrorerfahrenen Kindern des 21. Jahrhunderts schlaflose Nächte bereiten könnte.
Fredric Brown – Die grünen Teufel vom Mars

Fredric Brown – Die grünen Teufel vom Mars weiterlesen