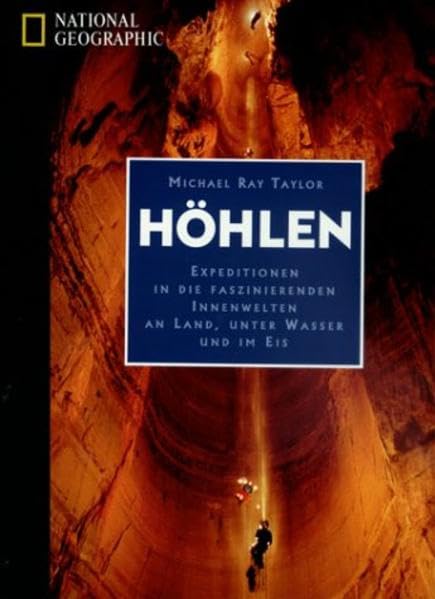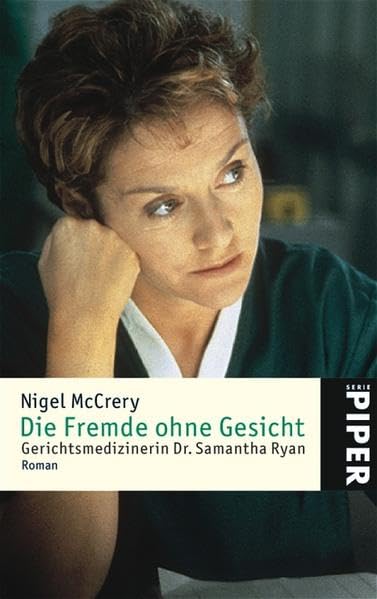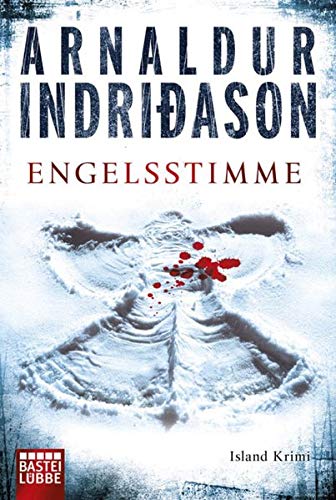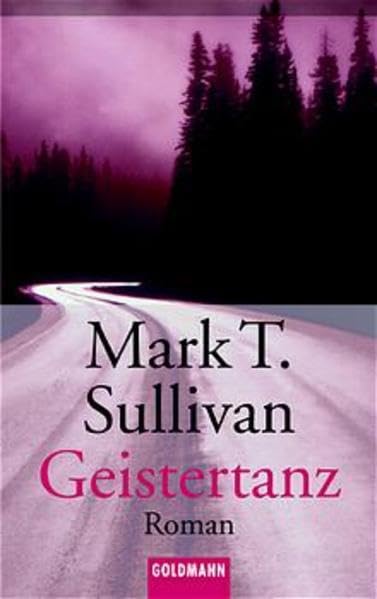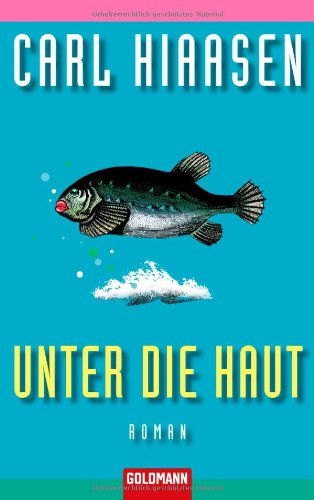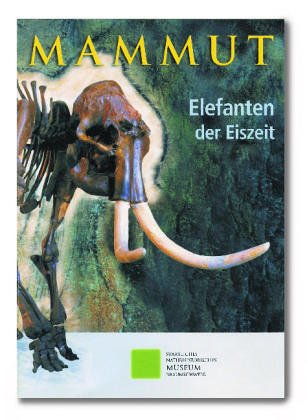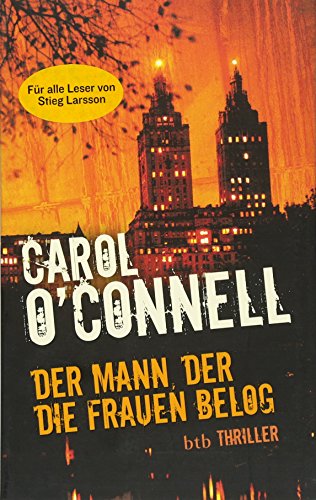
Carol O’Connell – Der Mann, der die Frauen belog [Mallory 2] weiterlesen
Alle Beiträge von Michael Drewniok
Bennett, David – Metro. Die Geschichte der Untergrundbahn
Eine Geschichte der Untergrundbahnen dieser Welt – nicht nur in ihrer Funktion als Verkehrsmittel, sondern auch als Stätten der Kunst und der Architektur:
|“Die Anfänge des U-Bahnwesens“| (S. 13-62): Eine Untergrundbahn konnte es erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts geben; vorher war sie technisch nicht zu realisieren und es bestand auch kein Bedarf. Erst die Industrielle Revolution und das rapide Wachsen der Städte, deren oberirdische Straßen und Schienen dem Verkehr nicht mehr Herr werden konnten, ließen den Gedanken an eine Verlegung des Massentransportmittels Bahn unter die Erde Realität werden. Der erste Verkehrstunnel der Welt entstand bis 1841 unter der Themse von London und verband Wapping mit Rotherhithe – ein Start mit Hindernissen und doch ein Unternehmen, das viele Fragen für spätere Projekte beantwortete: Wie breit muss ein U-Bahntunnel sein? Wie gräbt man ihn mit möglichst geringem Aufwand? Betreibt man U-Bahnen mit Dampf? Mit Strom? Mit Diesel? Baut man Waggons besser aus Holz oder aus Metall? Wie sieht die optimalökonomische U-Bahnstation aus? Viele Jahre des Versuchens, Irrens und Findens schlossen sich an.
|“Architektur und Kunst in den Stationen“| (S. 63-128): Wie sich herausstellte, gibt es keine U-Bahn, die an ihre Planer und Erbauer nicht eigene komplexe Anforderungen stellt. 15 ausgewählte Strecken aus Großstädten Europas, Nordamerikas und Südostasiens belegen die enormen Anforderungen, die schwankende Böden, hohe Grundwasserstände oder andere Hindernisse aufwarfen. Aus der Not wurde eine Tugend gemacht, die Untergrundbahnen nach allen Schwierigkeiten, die ihr Bau aufwarf, in Tempel des Transportwesens verwandelt und entsprechend ausgestattet.
|“Untergrundkultur“| (S. 129-155): Nutzen und Kunst gingen eine oft erstaunliche Symbiose ein. Diese beschränkte sich keineswegs auf die Züge, die Gleise oder die Stationen. Die „U-Bahn-Künstler“ bezogen jedes Detail ein. „Metro“ zeigt Fahrkarten, Plakatkunst, Graffiti, Züge als Werbefläche, Rolltreppen, Netzpläne, die oft wie Ausstellungsobjekte wirken.
|“Liste der U-Bahnen“| (S. 156-167): Ein Buch, das wie „Metro“ das Phänomen der Untergrundbahn in seiner vielgestaltigen Gesamtheit abbilden möchte, muss sich auf Beispiele beschränken. Eine Aufzählung aller U-Bahnen dieser Welt, die ergänzt wird durch die Angabe der wichtigsten Grunddaten zu Geschichte, Entwicklung, Größe und Ausstattung, vermittelt zumindest einen Eindruck davon, dass unter den Städten dieser Erde noch manches U-Bahn-Universum seiner Entdeckung harrt.
Abgeschlossen wird „Metro“ durch eine Bibliografie (S. 168), ein Stichwortverzeichnis (S. 169-175) sowie einen Bildnachweis (S. 176)
„Metro“ steht für „Métropolitain“, die Pariser U-Bahn, die zu den berühmtesten (und ältesten) Untergrundbahnen der Welt gehört. „Metro“ und „U-Bahn“ – das sind Begriffe, die auch in Deutschland zu Synonymen geworden sind. (Glück gehabt; es hätte auch wesentlich profaner „the tube“ – die Tube – heißen können: So nennen die Bürger von London ihre U-Bahn, durch deren enge Tunnel die Züge wie Zahnpasta gequetscht werden.)
„Metro“, das Buch, überrascht durch einen thematisch ungewöhnlich breiten Ansatz. Zwar bekommt man zunächst, was zu erwarten war, einen Überblick, der die Geschichte der Untergrundbahn ebenso einschließt wie eine Schilderung der U-Bahn-Gegenwart. Viel steht da geschrieben über Bodenschichten, monströse Aushubmaschinen oder einfallsreiche Ingenieure. In diese Darstellungen mischen sich Anekdoten erschröcklicher (Wassereinbruch im Tunnel) und ergötzlicher (Kristalllüster und Stuckwände in U-Bahn-Stationen) Art.
Doch dieses „Pflichtprogramm“ schließt Verfasser Bennett schon mit der Seite 62 ab. Nunmehr taucht er mit dem Leser in eine exotisch-fremde Welt ab: Für Bennett ist die Untergrundbahn sichtlich mehr als ein simples Transportmittel, das möglichst viele Menschen von A nach B bringen soll. Mit seinem Blick betrachtet man die U-Bahn plötzlich als vom Rest der Welt isolierte Sphäre mit eigenen Regeln und Gesetzen.
In dieser Unterwelt ist der Ingenieur der Herrscher. Er ist ein gütiger Tyrann, der Politiker nur zu Streckeneröffnungen einlässt, die schönen Künste fördert und mit Unterstützung der Technik eine bis ins Detail durchgeplante Welt erschafft, die funktioniert. Man könnte nach der Lektüre von „Metro“ tatsächlich zu dem Schluss kommen, dass dies der Realität entspricht, so intensiv huldigt Bennett seiner geliebten U-Bahn. Selbst Stationen, die der Leser aus eigener Erfahrung kennt und als finstere, schmutzige, von verdächtigen Gestalten bevölkerte Trollgruben beschreiben würde, geraten unter seiner Feder und vor allem unter seiner Kamera zu architektonischen Hymnen an den menschlichen Erfindungsreichtum. Die weniger erfreulichen Seiten der U-Bahn beschränkt Bennett weitgehend auf Klagen über allzu drastische Werbung sowie das Beschmieren von Wänden und Waggons (wobei die gezeigten Graffitis schon wieder den Tatbestand der Kunst erfüllen).
Diese Bilder sind großartig und definitiv keine Schnappschüsse. Der Standpunkt der Kamera ist mit Bedacht gewählt, sorgfältig hat man mit Licht inszeniert, was anschließend kunstvoll fotografiert oder besser: zu Lichtbildern veredelt wurde. Auch hier wird deutlich, dass „Metro“ weniger ein Sachbuch als ein „coffee table book“ ist, dessen Gestaltung mindestens ebenso wichtig ist wie der Inhalt; ein Prachtband, der sich, offensiv platziert, gut im repräsentativen Buchregal des weltoffenen, gut betuchten, kulturell interessierten Zeitgenossen macht.
Bennett ist selbst Ingenieur, was seine Begeisterung verständlich macht, die einer nüchternen Betrachtung sicherlich nicht standhalten kann. „Metro“ soll indes kein Sachbuch im rein darstellenden Sinn sein. Der Autor stellt die Untergrundbahn als geschlossenes System mit eigener „Evolution“ dar, was er verblüffend überzeugend an diversen Alltäglichkeiten deutlich zu machen weiß, die man ohne diese Darstellung weiterhin für selbstverständlich halten würde. So ist es ein weiter Weg bis zum heute gültigen, streng geometrischen, sich an der Topografie nicht mehr orientierenden U-Bahn-Netzplan gewesen. Die ersten Pläne bezogen noch das überirdische Straßennetz, Flussläufe und Zugstrecken ein, die gezeichneten Abstände zwischen den Stationen gaben maßstabsgerecht die realen Entfernungen wider. Das funktionierte, solange das U-Bahnnetz bescheiden blieb. Doch in jeder großen Stadt wuchs es kontinuierlich, bis sich die die ober- und unterirdischen Verkehrspläne hoffnungslos überlagerten. Erst allmählich lernte man zu trennen und „erzog“ den U-Bahn-Passagier zum selbstverständlichen Lesen abstrakter Netzpläne.
Die Untergrundbahn als Kunstausstellung wirkt ebenfalls ungewohnt. Dabei waren die Menschen schon immer stolz auf ihre Metros: Wer so viel Geist & Geld in die Erde versenkt, wünscht sich schon, dass etwas davon sichtbar wird. Heute gleichen U-Bahn-Stationen zwar nicht mehr den domähnlichen Prachtgewölben der Vergangenheit, doch ihre Architektur ist eher noch kühner geworden. Bennett dokumentiert Konstruktionen, die sich scheinbar schwerelos in den Raum erheben, was durch ausgeklügelte Lichtsetzung in der dramatischen Wirkung noch verstärkt wird. (Er verschweigt die banale Tatsache, dass harter Stahl, Keramik und Licht die Aktivitäten von Vandalen, Kunstbanausen und Sudelfinken erfolgreicher vereiteln als liebevoll gearbeitete aber empfindliche Wandpartien oder Bodenflächen.) In bzw. unter Stockholm (wo es offenbar weder Vandalen & Kunstbanausen noch Sudelfinken gibt) hat man die Stationen sogar in regelrechte Kunstgalerien oder begehbare Gesamtkunstwerke verwandelt.
Als Sachbuch mag „Metro“ nur bedingt bzw. in seinem ersten Drittel „tauglich“ sein, doch als Inszenierung einer Parallelwelt bereitet David Bennetts Besuch in einer Unterwelt mit vielen dunklen aber interessanten Winkeln großes Vergnügen. In der deutschen Ausgabe wird dieses durch die umständlich-steif wirkende Übersetzung („Die Konstruktionsweise der Wagen ist ein wesentlicher Faktor für die Gestaltung des Betriebs bei jeder U-Bahn, die teils mehrere Millionen Fahrgäste täglich zu befördern hat.“, S. 30) und bei einem Buch dieser Preisklasse erstaunlichen Zahl unkorrigiert gebliebener Rechtschreibfehler leicht getrübt, aber nicht wirklich verwässert.
Laymon, Richard – Rache
Er wollte nur kurz in den Drugstore und ein Päckchen Kondome besorgen, doch nun wartet Sherry, eine junge Aushilfslehrerin, schon mehr als eine Stunde auf ihren Lover Duane. In der korrekten Annahme, dass er sich in der Aussicht auf eine heiße Liebesnacht nicht einfach empfohlen hat, macht sie sich zunehmend besorgt auf die Suche. Die Sommernacht ist heiß, auf den Straßen sieht man kaum einen Menschen. Sherry ist deshalb froh, als sie ein bekanntes Gesicht sieht. Toby Bones sitzt in einer der Klassen, die sie unterrichtet. Er bietet ihr an, auf der Suche nach Duane zu helfen. Sherry nimmt an, zumal sie amüsiert und geschmeichelt bemerkt, dass sich der schüchterne, dickliche Toby zu ihr hingezogen fühlt.
Doch hinter der Maske höflicher Zurückhaltung steckt ein Psychopath. Schon lange brodelt es in Toby. Er ist ein gesellschaftlicher Niemand, ein unattraktiver Außenseiter, den die Mädchen keines Blickes würdigen. In dieser Nacht bricht er alle gesetzlichen und moralischen Brücken hinter sich ab. Toby will sich rächen an der Welt – aber vor allem will er eine Frau: Sherry, die er nicht mehr aus der Ferne verehren sondern sie sich nehmen wird.
Genauso geschieht es und es ist fast zu leicht. Einmal in Tobys Gewalt, gelingt es Sherry nicht, ihm zu entfliehen. Die Stadt scheint verödet, niemand bemerkt ihre Not. Die wenigen Pechvögel, denen sie sich verständlich machen kann, werden von Toby kurzerhand massakriert. Auch der arme Duane hat bereits sein Ende gefunden. Sherry ist auf sich gestellt. Ziellos fährt sie mit einem auch den Rest seiner Kontrolle verlierenden Toby durch die Straßen. Verzweifelt redet sie auf ihn ein, verhandelt, heuchelt Zuneigung, verspricht Gehorsam, selbst als Tobys Übergriffe zunehmend brutaler werden. Sherry weiß genau, dass sie sein letztes Opfer werden soll. Doch sie will leben und schmiedet einen verzweifelten Plan – nur: Wird ihr der irre aber schlaue Toby die Gelegenheit geben, ihn umzusetzen, oder muss sie vorher sterben wie so viele, deren Weg das unfreiwillige Paar kreuzt …?
„Rache“ erzählt eine ganz einfache Geschichte von Entführung, Folter, Mord und natürlich Rache. Autor Laymon berichtet, was geschieht, wobei er keinen Moment die Augen abwendet bzw. kein Blatt vor den Mund nimmt. „Rache“ ist ein finsterer, beklemmender, schmutziger Thriller, der sich einen Dreck um das schert, was heute als politisch korrekt gilt. Stattdessen lotet Laymon zwei kriminalistische Phänomene aus: den Serienmord und die Selbstjustiz.
Der Serienmörder hat es zum Medienstar und zur Kultfigur gebracht. Das „Publikum“ liebt Berichte und „True Crime“-TV-Shows, in denen akribisch die Jagdstrecken möglichst blutig vorgehender Killer nachgezeichnet werden, immer neue, bizarrere Hannibal-Lecter-Klone entspringen den Hirnen einfallsarmer Roman- und Drehbuchautoren. Psychologen und Kriminologen machen sich viele wichtige Gedanken um das Wer und Wieso; gern dürfen auch die Angehörigen der Opfer ins Rampenlicht.
Jenseits dieses Rummels lauert die schmutzige Realität. Psychopathische Attacken sind keine kriminalistischen Planspiele, sondern direkte Angriffe auf Leib und Seele. „Rach“ schildert genau das in einfachen, deutlichen, drastischen Worten, ohne „literarische“ Ambitionen und damit auch ohne Ablenkungen. Dadurch bleibt jederzeit klar, dass hier ein nackter, erbarmungsloser Kampf auf Leben und Tod stattfindet. Jegliche Würde, jegliche Menschlichkeit bleibt auf der Strecke. Sherry und Toby lassen die Masken fallen – die eine will erst überleben und dann Rache, der andere endlich seinen unterdrückten Trieben freien Lauf lassen. Daran ist nichts Heroisches, Sherry keine verkappte Leistungssportlerin mit Nahkampfausbildung, die zielsicher zurückschlagen wird, Toby kein Täter, dem per Diskussion rational beizukommen wäre. Auf ein wunderbares Hollywood-Happy-End darf man nicht hoffen, daran lässt der Verfasser keinen Zweifel.
Laymon lässt kein Entrinnen zu. Hin und wieder gelingt Sherry eine „kleine“ Flucht, die jedoch im Nichts öder Parkplätze oder verlassener Hinterhöfe endet. Sherry ist nicht schnell genug bzw. Toby zu brachial in seinem Amoklauf. Die wenigen Menschen, die in dieser Sommernacht unterwegs sind, scheren sich wenig umeinander. Bald gibt es Sherry gänzlich auf, Aufmerksamkeit zu erregen: Entweder hilft ihr niemand – und wer ihr hilft, wird sterben, denn bevor es ihr gelingt, dem potenziellen Retter die Situation zu verdeutlichen, taucht schon Toby auf und macht kurzen Prozess. Ihren Kampf müssen Sherry und Toby unter sich ausfechten, und es wird nur eine/r überleben.
Sherrys Fluchtversuche enden auch deshalb im Nichts, weil sie völlig unvorbereitet und arglos in Tobys Falle tappt: Der Durchschnittsbürger schaut sich gern die zahlreichen „Vorsicht, Strolche!“-Sendungen im Fernsehen an, kann oder will aber nicht begreifen, dass ihm oder ihr jederzeit ein ähnliches Schicksal blühen könnte. In äußerster Not muss Sherry den Umgang mit einem Psychopathen lernen. Fehler werden schmerzhaft bestraft. Vor allem begreift Sherry ihre völlige Hilflosigkeit. Niemand will oder kann ihr helfen. Retten kann sie sich nur selbst. Die vertraute Welt, in der sie sich tagsüber so selbstsicher bewegt, hat sich in ein Labyrinth verwandelt, das sie mit einem Ungeheuer teilt. Die Nacht ist Tobys Welt. Wenigstens für einige Stunden ist er der absolute Herrscher.
Die Lehre, die Sherry aus ihrer Horrornacht zieht, ist folgerichtig: Hilf dir selbst, denn dir wird niemand helfen. „Hilfe“ bedeutet in diesem Fall auch „Rache“: Sherry will keine Polizei, Toby soll nicht vor Gericht; sie wünscht keine peniblen, öffentlichen Schilderungen ihres Martyriums, und der Justiz vertraut sie nicht. Also nimmt sie das Recht in die eigene Hand – und wird selbst zur Kriminellen, die zudem noch zwei Halbwüchsige manipuliert, damit sie ihr zur Seite stehen.
Toby ist kein organisierter Täter, er hinterlässt überall Spuren. Er wird letztlich scheitern, man wird ihn fassen oder erschießen. Toby ist sich dessen dunkel bewusst, doch hier und jetzt ist es ihm völlig egal. Die Zukunft hat er aus seinem Lebenskonzept gestrichen. Immer haben „die Anderen“ – die Klügeren, Hübscheren, Reichen – bekommen, was ihm ebenfalls zusteht, wie er glaubt. Für ihn blieben nur Tritte, Hohn und Beschimpfungen. Wenn er nicht teilhaben darf, dann holt er sich eben, was er will, und pfeift auf die Konsequenzen. Endlich kann Toby bestimmen, was geschieht. Das macht ihn zum gefährlichsten Menschen überhaupt, denn er hat nichts zu verlieren und wird sich jeden noch so perversen Wunsch erfüllen.
War Toby schon immer ein Psychopath oder hat ihn sein trostloses Leben dazu „gemacht“? Es gibt einen kurzen Texteinschub, aus dem hervorgeht, dass es beim Tod seiner Eltern nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Darüber hinaus verhindert Laymon auch diesen Versuch einer rationalen Erklärung. Diese Frage ist irrelevant. Toby handelt – und als Resultat seiner Taten sterben Menschen. Wieso er das tut, darüber werden später Kriminalisten, Anwälte, Psychologen und Medienvertreter ausgiebig diskutieren. Für Sherry wird es dann allerdings zu spät sein. Die brutale Eindeutigkeit dieser Erkenntnis schmerzt vor allem Gutmenschen. Laymon schildert ohne Heuchelei eine Situation, in der Gewalt scheinbar nur durch Selbstverleugnung, Erniedrigung und Gegengewalt gekontert werden kann. Zudem lauert sie nach Laymon in den meisten Menschen und wartet auf ihre Gelegenheit: Toby ist selbst überrascht, als er unter denen, die er mit Waffengewalt in seinen Bann bringt, immer wieder freiwillige Komplizen findet. Sie nehmen die Gelegenheit wahr, ihren eigenen sadistischen Anwandlungen zu folgen, und „entschuldigen“ es damit, dass sie von Toby gezwungen werden.
Aber auch diejenigen, die Tobys Terror überlebten, sind gezeichnet. Sie haben die Gewalt kennen und durchaus lieben gelernt. „Die Macher“ nennen sie sich und warten geradezu darauf, dass in ihrer Anwesenheit jemand über die Stränge schlägt: Sie werden ihm oder ihr eine Lektion erteilen und sich der Macht erfreuen, die sie sich anmaßen – genauso, wie sie es gelernt haben.
Für dieses eigenwillige Finale wird man Laymon hassen, denn manche Wahrheit schmerzt. Das ist Laymon freilich gewöhnt, denn das Verhalten von Menschen in Extremsituationen hat er in seinen Romanen immer wieder zum Thema gemacht. „Rache“ ist eine tour de force durch die ganz finsteren Gefilde der Seele. Daran teilzunehmen, macht keine Freude, ist aber faszinierend: Der Mensch ist halt ein Voyeur; auch das ist eine bittere Medizin, die Richard Laymon großzügig austeilt.
Richard Carl Laymon wurde 1947 in Chicago, Illinois, geboren, wo er auch aufwuchs. Ein Studium in Englischer Literatur begann er an der Willamette University, Oregon, und schloss es mit einem Magistertitel an der Loyola University, Los Angeles, ab. Anschließend arbeitete Laymon u. a. als Schullehrer, Bibliothekar sowie Rechercheur für eine Anwaltskanzlei.
Als Schriftsteller debütierte Laymon 1980 mit den Psychothrillern „Your Secret Admirer“ und „The Cellar“ (dt. „Haus der Schrecken“). In den folgenden beiden Jahrzehnten veröffentlichte er mehr als 60 Romane und zahlreiche Kurzgeschichten. Dabei beschränkte er sich nicht auf die Genres Horror und Thriller, sondern schrieb u. a. auch Romanzen oder Westernromane. Laymons Erfolg hielt sich in den USA lange in Grenzen; seine eigentliche Fangemeinde hielt ihm in Europa die Treue. Dafür dürften seine ungeschminkt derben und an blutigen Effekten nicht sparenden, die puritanische Sexfurcht der US-Gesellschaft ignorierenden und anklagenden Geschichten verantwortlich sein. Dennoch wurden Laymon-Werke mehrfach für renommierte Buchpreise nominiert. Im Jahre 2000 wurde „The Travelling Vampire Show“ mit dem „Bram Stoker Award“ für den besten Horrorroman des Jahres ausgezeichnet.
Den Preis konnte Richard Laymon nicht mehr selbst in Empfang nehmen. Er starb völlig überraschend am 14. Februar 2001 an einem Herzanfall. Über sein Leben, vor allem jedoch über sein Werk informiert die Website http://www.ains.net.au/~gerlach/rlaymon2.htm.
http://www.heyne-hardcore.de
Neal Asher – Skinner: Der blaue Tod

Neal Asher – Skinner: Der blaue Tod weiterlesen
Taylor, Michael Ray – Höhlen. Expeditionen in die faszinierenden Innenwelten an Land, unter Wasser und im Eis
Im Jahre 2000 begab sich ein Team der Firma MacGillevray Freeman Film, Spezialisten für die Herstellung von IMAX-Filmen, auf eine Nabelschau ins Innere unserer Erde. Unterstützt von der National Geographic Society wurde ein abenteuerliches Projekt realisiert: Zum ersten Mal sollte die komplizierte Technik, mit deren Hilfe außergewöhnlich scharfe und farbintensive Aufnahmen möglich sind, in Höhlen eingesetzt werden, die nicht nur unter der Erde und damit im Dunkeln, sondern teilweise sogar unter Wasser oder im Gletschereis lagen.
Vom Ewigen Eis des Nordens bis in die warmen Meere Mittelamerikas ging die Fahrt, die in diesem Buch beschrieben wird, das eine Mischung aus Expeditionsbericht und Sachbuch darstellt. Als „Blickfang“ und Identifikationsfiguren für die Zuschauer wurden Hazel Barton und Nancy Aulenbach, zwei junge und in ihrem Metier erfolgreiche, aber auch optisch ansprechende Höhlenforscherinnen angeheuert, welche für eine bezahlte Forschungsreise gern in Kauf nahmen, vor der Kamera ihrem Job nachzugehen. Der Wissenschaftsjournalist Michael Ray Taylor schloss sich der Expedition an und sammelte parallel zu den Filmaufnahmen das Material für sein hier vorgelegtes Buch. Es gliedert sich in drei Großkapitel, die sich an den drei Höhlentypen orientieren, die auf dieser Erde vorkommen: Höhlen im Eis, unter Wasser und im Felsen.
„Eis: ins Herz von Grönland“ (S. 12-67): Viele Kilometer dick sind die Eisschichten, welche die meisten Gebiete der größten Insel dieser Welt bedecken. Vor allem im Sommer, wenn die Sonne sogar in diesen eisigen Breiten für Wärme sorgt, beginnen Schmelzbäche Rinnen, Schluchten und Höhlen in das Eis zu fräsen. Dies ist der Zeitpunkt, auf den einige Spezialisten unter den Naturforschern gewartet haben, können sie doch nur auf diese Weise in die Welt unter dem Eis eindringen, das ansonsten undurchdringlich weil hart wie Eisen bleibt. Angetrieben werden sie nicht durch Abenteuerlust. Wissenschaftliche Neugier treibt sie hinab in die Tiefe – ein gefährliches Unterfangen, denn Eis ist ein Material, das sich in Nichts auflösen, zusammenstürzen oder rasant neu bilden kann. Eishöhlen sind deshalb ständigen Veränderungen unterworfen, die eine Expedition dem Irren durch ein einsturzgefährdetes Labyrinth gleichen lassen. Doch der Einsatz lohnt sich, denn dort, wo man normalerweise nur öde Kälte erwartet, gibt es Leben. Einzeller und anderes mikroskopisch kleines Getier sowie Kreaturen, deren Einteilung in den Stammbaum des Lebens schwer fällt, tummeln sich hier unten und gedeihen prächtig. Sie erweitern die Grenzen dessen, was die Forschung bisher als Lebensraum definierte, gewaltig. Plötzlich wirken auch fremde Welten wie der Mars oder der Jupitermond Europa nicht mehr absolut lebensfeindlich: Es ist dem Leben offenbar nicht nur theoretisch möglich, unter solchen Extrembedingungen zu existieren.
„Wasser: Flüsse unter Yucatan“ (S. 68-133): Diese Theorie findet auch an einem ganz anderen Ort Bestätigung. Die mittelamerikanische Halbinsel Yucatan ist ein riesiger Schweizer Käse, unter dessen dünner Erd- und Felsoberfläche ein gewaltiges Höhlensystem im stützenden Gesteinssockel ausgewaschen wurde. Nachdem der Meeresspiegel in der Vergangenheit angestiegen ist, liegt es heute unter Wasser. Oft künden nur „Cenotes“, riesige runde Löcher dort, wo die Decke eingestürzt ist, von ihrem Vorhandensein. Riesige Flüsse erstrecken sich unter einem Regenwald, in dem es kaum offene Wasserflächen gibt. Die Höhlenwelt im Wasser ist warm aber dunkel und keineswegs ohne Leben. Die Besucher finden hier neue, bemerkenswert an ihre seltsame Umwelt angepasste Lebewesen, die in geradezu bizarren Symbiosen „zusammenarbeiten“ und so den Anforderungen genügen, die ihre Heimat an sie stellt. Deren Erforschung ist sogar noch riskanter als der Gang ins Eis, muss sich der Mensch doch in ein Element wagen, das ihm die wichtigste Grundlage für seine Existenz versagt: den Sauerstoff, auf den er anders als die Wesen, die er in der Tiefe sucht, keineswegs verzichten kann. Soll dann auch noch gefilmt werden, werden die logischen Anforderungen für einen Tauchgang zu einem Albtraum.
„Erde: Klettern und Kriechen“ (S. 134-203): Höhlen in Felsen erweisen sich endlich einmal als stabil. Dies macht ihre Erforschung freilich nicht einfacher, denn in der Regel finden sich die für die Forschung besonders interessanten Stellen exakt dort, wo kaum ein Hinkommen möglich ist. Viele hundert Meter geht es durch das rote Gestein von Arizona in düstere, gähnende Schlünde oder durch sargenge Schlupfgänge hinab in den Bauch des Planeten, aus dessen Wänden womöglich giftige Gase oder gar Säuretropfen quellen. Aber selbst hier hat das Leben seine eigenen Wege gefunden. Absonderliche Geschöpfe mit nie vermuteten Fähigkeiten werden hier entdeckt; womöglich verbergen sie in ihrem Inneren Heilstoffe gegen menschliche Krankheiten, welche die Medizin revolutionieren können.
Die Forschung als Abenteuer verpackt, kann durchaus das Interesse wecken (oder Sponsorenbörsen öffnen). Nur die echten Ignoranten winken ab, aber ihnen bleibt das Reich der Jamba-Jingles & Privat-TV-Komiker, dessen Grenzen sie hoffentlich nie überschreiten. Freilich ist es durchaus möglich, dass sogar einige dieser (im Kopf) Hartgesottenen durch dieses Buch angelockt werden. Höhlen üben auf Menschen eine eigentümliche Faszination aus. Sie fürchten sich entweder vor der Enge, der Dunkelheit, dem Unbekannten, das sich dort verbergen mag, oder sie werden magisch angezogen auf der Suche nach Schätzen, welche in diesem Fall aus wissenschaftlichen Erkenntnissen bestehen. Möglicherweise spielt ja eine kollektive Erinnerung an jene fernen Zeiten eine Rolle, in denen der Mensch in Höhlen wohnte. Es sind indes nie so viele gewesen, wie man heutzutage annimmt; Höhlen mit Lebensqualität sind nicht gerade zahlreich.
Erstaunlich viele Kreaturen sehen das allerdings anders. Tief unter der Erdoberfläche gibt es bizarre Ökosysteme, die sich der Mensch bis vor kurzer Zeit nicht hätte träumen lassen. Höhlen stellen das ideale Versuchslabor der Natur dar. Hier existieren alle nur denkbaren Extrembedingungen: extreme Hitze oder Kälte, Trockenheit, Nässe, Atmosphären mit Gasen, die man für giftig gehalten hatte, die manche Bakterien jedoch zum Leben benötigen; die frische Luft ist es, die sie töten würde. Kein Wunder also, dass diese Spezialisten Spitznamen wie „Klingone“ tragen: Sie muten außerirdisch an – und geraten damit zu Hoffnungsträgern jener, welche auf den Planeten und Monden unseres Sonnensystems allzu gern Leben fänden. Wie es aussieht, könnten sie Recht behalten.
Die Suche nach solchen Wesen ist unter den beschriebenen Umständen schwierig. Michael Ray Taylor weiß für sein Buch davon zu profitieren. Er muss nur beschreiben, was sich vor seinen Augen in diversen Höhlen abgespielt hat, und könnte sich dabei sogar die Mühe sparen, dies ebenso präzise wie knapp und lesenswert zu tun (was er glücklicherweise nicht macht): Die Aufmerksamkeit des Lesers wird sofort auf 135 bemerkenswerte Fotos gelenkt.
Die IMAX-Technik gehört vermutlich bald zu den Sackgassen der Technikgeschichte. Gewaltige Kameras müssen mit überdimensionalen Filmrollen gefüllt werden. Für die entstandenen Werke wurden sogar eigene Kinos mit entsprechenden Leinwänden gebaut: IMAX-Bilder sind riesig, farbintensiv und unglaublich detailscharf. Bis auch hier die digitale Revolution Einzug hält, gehören sie zu dem Feinsten, was man dem menschlichen Auge bieten kann. Durchweg auf feines Kunstdruckpapier gedruckt, spiegeln die ausgewählten Aufnahmen das Dargestellte mit spektakulärer Intensität wider.
„Höhlen“ ist auch ein Bericht über eine Reise in ferne und fremde Länder. Er hilft begreiflich zu machen, wieso der Mensch Informationen über solche Expedition liebt: Sie führen dorthin, wo noch niemand zuvor war. Es gibt sie noch, die berühmten „weißen Flecken“ auf der Landkarte. Heute werden sie denjenigen, die es vorziehen, den mit der Erforschung verbundenen Strapazen aus dem Weg zu gehen, sogar ins Haus gebracht. „Höhlen“ ist so dicht am Geschehen, dass man leicht vergisst zu berücksichtigen, dass diese Bilder im Grenzbereich des Lebens entstanden. Obwohl sich Verfasser Taylor nach Kräften bemüht, die Gefährlichkeit von Höhlen angemessen darzustellen, ist ihm klar, dass die vielleicht größte Gefahr erst durch Film und Buch heraufbeschworen wird. Nicht grundlos werden die Zugänge zu vielen Höhlen sorgfältig geheim gehalten. Die hier angesiedelten Ökosysteme sind fragil, die laienhaften Besucher tölpelhaft oder offen zerstörungswütig. Vor allem fällt es ihnen schwer zu begreifen, dass in einer Höhle jeder Schritt bedacht sein will; es könnte sonst der letzte werden.
„Höhlen“ ist in jeder Beziehung ein monumentales Werk. Damit die Bilder wie beschrieben zur Geltung kommen können, wurde ein Buchformat von 23 x 30 cm (Hochformat) gewählt. Das Ergebnis hat seinen (Kauf-)Preis, doch hier gibt es einen Tipp: „Höhlen“ wird nunmehr antiquarisch angeboten. Mein Exemplar erwarb ich für weniger als die Hälfte des ursprünglichen Preises. Unter diesen Umständen ist es beinahe unmöglich, einen Kauf zu verhindern …
Der amerikanische Journalist und Buchautor Michael Ray Taylor ist Dozent für Journalismus an der Henderson State University im US-Staat Arkansas. Er nimmt an Expeditionen teil und hat sich auf die Erforschung von Höhlen spezialisiert, von denen er inzwischen ca. 600 besucht hat. Sein besonderes Interesse gilt dabei der Suche nach den „Extremspezialisten“ unter deren Bewohnern – den Nanobakterien. Als Wissenschaftsjournalist arbeitet Taylor u. a. für die Website des Discovery-Channels (www.discovery.de bzw. www.discovery.com) und als Berater für Dokumentarfilme dieses Hauses, für die National Geographic Society sowie für andere Fernsehsender.
Die National Geographic Society informiert unter der Adresse http://www.nationalgeographic.de über ihr Buchangebot.
John Sandford – Tödliches Netz

James White – Gefangene des Meeres

James White – Gefangene des Meeres weiterlesen
McCrery, Nigel – Fremde ohne Gesicht , Die
Dr. Samantha Ryan, gerichtsmedizinische Gutachterin und Pathologin in der englischen Universitätsstadt Cambridge, wird an den Schauplatz eines Prominentenmordes gerufen. Das Opfer: Sophie, Gattin des Unterhausabgeordneten John Clarke. Erdrosselt liegt sie nackt und gefesselt auf ihrem Bett. Die Medien belagern die Stätte und belauern die ermittelnden Beamten. Ein Skandal liegt in der Luft, und vielleicht lässt sich den prominenten Beteiligten sogar quotenförderlich am Zeug flicken!
Zumal sich ausgerechnet Detective Sergeant Stanley Sharman für diesen Fall interessiert. Er ist ein ausgezeichneter Polizist, dessen Privatleben jedoch ein Trümmerfeld ist. Außerdem unterliegt er einem Drang zur beruflichen Selbstzerstörung. Gern würde ihn Superintendent Tom Adams endgültig kaltstellen. Er lässt ihm einen Fall weit ab vom Clarke-Getümmel übertragen: Auf einer wilden Müllkippe wurde eine skelettierte Leiche gefunden. Ein Fixer, der sich hier den „goldenen Schuss“ gesetzt hat, so heißt es.
Doch schon wieder muckt Sharman auf. Einige Indizien am Fundort deuten für ihn auf Mord hin. Da es kein Geld und keine Leute gibt, versichert sich Sharman der Unterstützung Sam Ryans, die selbst ein Hühnchen mit Adams zu rupfen hat, der bis vor einiger Zeit ihr Lebensgefährte war und sie dann für eine andere Frau verließ. Seitdem herrscht Krieg zwischen dem Superintendent und der Pathologin, der zum Tagesgespräch in den Revieren und Seziersälen von Cambridge geworden ist.
Dass Sharman Recht hat und dies dank Ryans Hilfe beweisen kann, fördert die Harmonie keineswegs. Schlimmer noch: Sharman mischt sich weiterhin auch in den Clarke-Mordfall ein. Dort hat ein anonymer Tipp inzwischen zur Festnahme des Assistenten von John Clarke geführt. Seine DNS wurde an der toten Sophie festgestellt. Sharman glaubt an ein Komplott, das der Polizei einen Sündenbock präsentieren soll. Zu seinem Schrecken muss Adams feststellen, dass dies zutreffen könnte.
Unverdrossen setzen Sharman und Ryan – inzwischen unterstützt von Sharmans Freundin, einer Prostituierten, und einem unternehmungslustigen Kunststudenten – ihre „inoffiziellen“ Ermittlungen fort. Sie locken nicht nur einen völlig neuen Verdächtigen aus seiner Deckung, sondern stoßen auf Verbindungen zwischen der Toten auf der Müllkippe und der ermordeten Sophie. Dahinter stecken Leute, die viel zu verlieren haben und wenig Rücksicht kennen. So wird aus der Suche nach der Wahrheit für Sam Ryan und ihre Mitstreiter bald ein Kampf ums Überleben, den einige Teilnehmer verlieren werden …
Zwei Morde und ihre Aufklärung – so lässt sich der Plot dieses vierten Abenteuers um die Pathologin Samantha Ryan zusammenfassen. Nichts Originelles also, aber das ändert sich rasch (auch wenn sich Verfasser McCrery da eher auf dem Holzweg befindet; dazu später Näheres). Die Hindernisse, die einer raschen Aufklärung entgegenstehen, sind primär hausgemacht: Wie die Kesselflicker raufen Kriminalpolizei, Politik und Medien. Die einen treiben Ehrgeiz und Profilsucht zur möglichst raschen Aufklärung, die anderen fürchten genau das, denn es gilt noch einige Tatsachen zu vertuschen, die kein gutes Licht auf manchen Beteiligten werfen.
Ein Prominentenmord ist kein einfacher „Fall“, das macht Nigel McCrery uns deutlich. Da ergeben sich Möglichkeiten und Gefahren, Seilschaften werden aktiviert, alte Gefälligkeiten eingefordert, neue Mauscheleien in Gang gesetzt. Wehe dem, der sich in dieser Schlangengrube „nur“ als Ermittler sieht, der vor allem das Verbrechen klären will. Wie das zu geschehen hat, das wird „von oben“ diktiert!
Diese internen Querelen zu verfolgen, ist mindestens ebenso spannend zu beobachten wie die Art und Weise, wie sich Sam Ryan und Stanley Sharman unbeirrbar auf ihren Kreuzzug für Gerechtigkeit begeben. Das ist gut so, denn mit fortschreitender Handlung wird diese leicht fadenscheinig. Die Verknüpfung des Clarke-Mords mit dem Leichenfund auf der Müllkippe ist schon konstruiert genug. Dann bastelt McCrery noch eine gar schröckliche Brücke zum Klischee-Grusel Snuff-Porno, der sich hier publikumswirksam mit dem realen Balkangrauen der unmittelbaren Vergangenheit verleimen lässt.
Die vom Verfasser gelieferten „Erklärungen“ überzeugen nicht. McCrery setzt den Plot endgültig mit einer Last-Minute-Entlarvung des Mörders in den Sand, die so unvermittelt wie lächerlich in Szene gesetzt wird. Glücklicherweise sind wir da bereits auf den letzten Seiten. Die bis dahin positive, weil spannend erzählte Story kann dadurch nur noch marginal beschädigt werden.
Der britische Kriminalroman ist mit Recht bekannt für seine gelungene Mischung aus Spannung und Alltagsrealität. Keine Deduktions-Maschinen gehen hier heldenhaft & vollautomatisch ihrem Job nach. Menschen sind es, die sich gern selbst im Weg stehen, während sich Beruf und Privatleben ständig vermischen.
Samantha Ryan ist daher ein angemessen widerborstiger Charakter. (So muss man es wohl im Zeitalter glatt gebügelter Ermittlerfiguren bezeichnen.) Sie ist ein echtes Arbeitstier und gut in ihrem Job; fast zu gut, denn sie ist sich ihres Könnens durchaus bewusst und legt großen Wert darauf, fachlich ernst genommen zu werden. Freilich neigt sie zur Kleinkrämerei. Im Kriminalroman ist das ein wertvoller Charakterzug, sticht Sam Ryan doch deshalb so manches Indiz ins Auge, das die eher nach Dienstplan agierenden Kollegen übersehen.
Dank kann Dr. Ryan dafür nur selten erwarten: Genau wie im richtigen Leben schildert Autor McCrery ein Arbeitsklima, in dem Genialität unerwünscht ist bzw. sich dem hierarchischen Denken unterzuordnen hat. Missgünstig und neidvoll beobachten die Ermittler einander. Karriere machen vor allem Streber und Arschkriecher mit den „richtigen“ politischen Verbindungen und guten Kontakten zur Presse.
Die wirklich fähigen Männer und Frauen fristen dagegen allzu oft ein frustriertes Berufsleben im Verborgenen. Stanley Sharman ist so ein Quertreiber, der sich einfach nicht anpassen kann und will. In einem US-amerikanischen Kriminalroman würde man so eine Figur vermutlich nicht entdecken: ein ruppiger, ständig die Konfrontation suchender Polizist, der privat in eine bizarre Liebesgeschichte mit einer Nutte verwickelt ist, woraus er nicht einmal einen Hehl macht. Sam Ryan leidet hingegen noch immer unter den Nachwirkungen einer hässlich gescheiterten Liebesbeziehung zu Superintendent Tom Adams, mit dem sie zur engen Zusammenarbeit gezwungen und sich dabei für eine hässliche Privatfehde keineswegs zu schade ist.
Die ständigen Streitigkeiten zwischen den handelnden Personen wirken keineswegs – auch hier ist McCrery lobenswert realistisch – katalytisch auf die Ermittlungen. Stattdessen zermürben sie und binden Energie, die besser in die Suche nach dem Mörder investiert werden sollte. Aber harmonisch ideensprühend funktioniert ein kriminalistisches Team halt nur in mittelmäßigen TV-Serien.
Das kriminalistische Prozedere ist gut recherchiert und dort, wo es nicht diversen dramatischen Zuspitzungen zum Opfer fällt (der Bulle & die Nutte; also bitte, Mr. McCrery!), überzeugend in der Schilderung – kein Wunder, war der Verfasser (geboren 1953 in London) doch selbst neun Jahre als Polizeibeamter tätig. Als akademischer „Spätberufener“ studierte er später in Cambridge (aha!), arbeitete dann für die BBC und entwickelte dort die Figur der Samantha Ryan. Sie sollte ihm Glück und klingende Münze einbringen, denn sie fand 1996 nicht nur ihren Weg ins Fernsehen, sondern wurde dort vor und hinter der Kamera außergewöhnlich sorgfältig und kundig in Szene gesetzt.
„Silent Witness“, eine Serie spielfilmlanger, lose verbundener Episoden, entwickelte sich umgehend zum Straßenfeger und wird bis heute mit Amanda Burton in der Rolle ihres Lebens fortgesetzt. McCrery kam mit dem Schreiben bald nicht mehr nach, so dass andere Autoren die Drehbücher verfassten, was aber dem Erfolg keinen Abbruch tat, da es – diese Rezension hat es wohl deutlich gemacht – viele Schriftsteller gibt, die McCrery in Sachen Einfallsreichtum das Wasser reichen können.
In Deutschland wurde „Silent Witness“ ausgerechnet von RTL, dem dümmsten aller großen Privat-TV-Sender, ins Programm aufgenommen, und fiel dort lange wohl nur den hartgesottensten Krimifreunden auf. Auch den Büchern zur Serie war das Schicksal zunächst wenig hold, wurden sie doch im |vgs|-Verlag, der sich auf Reißbrett-Romane zu billigen TV-Serien spezialisiert hat, deutlich unter Wert verheizt. Nun geschieht den Bänden zumindest im Taschenbuch Gerechtigkeit – eine Chance, die der Krimifreund nutzen sollte!
Denn Nigel McCrery zeigt sich ungewöhnlich anpassungsfähig. Wie viele Kriminalrätsel kann das beschauliche Cambridge noch hergeben? Mit wem kann sich Sam Ryan noch verkrachen? McCrery mag kein begnadeter Autor sein; er ist sich jedenfalls der Tatsache bewusst, dass er sich zu wiederholen beginnt. „Die Fremde ohne Gesicht“ legt daher das Fundament für jene Veränderungen, die in der „Silent Witness“-TV-Serie, die nach den Romanen entsteht, bereits vollzogen wurde: Dr. Ryan zieht einen Strich, kündigt ihren Job und geht nach London. Ein neuer „Spielplatz“ mit neuen Möglichkeiten tut sich damit auf.
http://www.piper.de
Indriðason, Arnaldur – Engelsstimme
Der Dezember in einem noblen Hotel in Reykjavík bringt für die Angestellten viel Stress, denn zur Weihnachtszeit zieht es viele ausländische Besucher in die winterliche Hauptstadt des Inselstaates Island unweit des Nordpolarkreises. Am Pol selbst soll ja der Sage nach der Weihnachtsmann seine Werkstatt eingerichtet haben. In besagtem Hotel übernimmt diese Rolle indes seit vielen Jahren Guðlaugur Egilsson, der Portier und Hausmeister. Dieses Jahr fällt sein Auftritt freilich aus; man findet ihn erstochen in seinem kleinen Kellerzimmer, oberhalb der Gürtellinie bereits in seinem ehrwürdigen Kostüm, unterhalb allerdings nur mit einem Kondom „bekleidet“.
Kommissar Erlendur Sveinsson übernimmt den Fall. Zum Unmut des Managers quartiert der unkonventionelle Polizist sich sogar im Hotel ein. So erfährt er von recht unsauberen Umtrieben hinter den Kulissen des gar nicht so feinen Hauses. Prostituierte sollen hier mit Billigung der Geschäftsleitung ihrem Job nachgehen, die Angestellten angeblich kräftig in die eigenen Taschen wirtschaften. Guðlaugur wusste davon und damit womöglich zu viel.
Erstaunliches kommt außerdem über die Vergangenheit des Portiers zum Vorschein: Guðlaugur war als Kind ein berühmter Sänger, gesegnet mit einer wahren Engelsstimme. Seine viel versprechende Karriere wurde vom Stimmbruch abrupt beendet; ein Erlebnis, das Guðlaugur niemals verwunden und das ihn seiner Familie entfremdet hat. Nur zwei Schallplatten hat er vor Jahren aufgenommen, die heute gesuchte Sammlerstücke sind. Erlendur lernt im Hotel den Briten Wapshot kennen, der fanatisch nach Guðlaugurs Werken fahndet und diesem bereits viel Geld gezahlt hatte. Kam es darüber zum Streit zwischen den beiden Männern? Wapshot belügt Erlendur und versucht Island heimlich zu verlassen. Das macht ihn zu einem weiteren Verdächtigen.
Die Wahrheit entspricht wie so oft nicht dem, was die Indizien versprechen. Erlendur und seine Kollegen müssen tief in das Universum der Knabensänger eindringen und entdecken dabei eine eigenartige Kunstwelt, deren „Gesetze“ jedoch nicht annähernd so hart und unerbittlich sind wie die Schrecken, welche die eigene Familie bereithält …
Wie in den ersten beiden in Deutschland veröffentlichten Bänden der Erlendur-Serie – in Island duzen sich die Menschen und sprechen einander mit Vornamen an – geht es in „Engelstimme“ um Rätsel der Vergangenheit. Dass diese in Arnaldurs Island besonders akut bleibt, mag an der konservierenden Frische der Nordmeerinsel liegen, die als Kulisse durch den drastischen Kontrast zwischen der Zivilisation des 21. Jahrhunderts und der archaischen Wildheit einer Insel im Grenzbereich der menschlichen Existenztoleranz weiterhin reizvoll neu wirkt. Die Natur beginnt nicht nur unmittelbar hinter den Ortsgrenzen, sie ist auch von einer Kompromisslosigkeit, die dem modernen Menschen im Grunde fremd ist: Auf Island ist es leicht möglich, während eines Winterspaziergangs „verloren“ zu gehen; Kommissar Erlendur hat es selbst erlebt (s. u.).
Islands Abgeschiedenheit verstärkt die Sonderrolle: Die Bewohner der Insel sind auch heute noch weitgehend unter sich. Im Vergleich mit Ländern vergleichbarer Größe ist die Zahl der Bewohner gering; sie konzentriert sich zudem in Dörfern und „Städten“, die anderenorts kaum als solche bezeichnet würden. Selbst Reykjavík, die Hauptstadt, bringt es auf gerade 115.000 Einwohner. Man kennt zwar einander nicht persönlich, aber man läuft sich immer wieder über den Weg. In diesem recht übersichtlichen Umfeld gären ungelöste Konflikte deshalb gut, bis sie den Deckel sprengen – das ist oft der Zeitpunkt, an dem Kommissar Erlendur und seine Kollegen ins Spiel kommen müssen.
Viel „geschieht“ nicht in dieser Geschichte – dies gilt jedenfalls, wenn man einen Krimi am Faktor „Action“ misst. Die Dramatik liegt im Denken und Handeln der Figuren. So kann ein scheinbar simpler Mord aus Leidenschaft in eine griechisch anmutende Tragödie ausarten, die immer mehr Personen in ihren unheilvollen Bann zieht. Geradezu lawinenhaft vermehren sich dabei die begangenen Verbrechen. Zum Mord gesellen sich Betrug, Diebstahl, Misshandlung, Kinderpornografie – ist die Dose der Pandora erst einmal geöffnet, ergießt sich ihr Inhalt unbarmherzig über die allzu Neugierigen.
Guðlaugur Egilsson brachte seine Engelsstimme in eine höllische Lebenssituation. Er wurde zum „Wunderkind“ gedrillt und erlitt dadurch seelische Schäden. Als sich dann sein einzigartiges Talent verflüchtigte, zerbrach er daran, geißelte sich selbst als Versager und bestrafte sich, indem er buchstäblich von der Bildfläche in einen öden Kellerwinkel verschwand. Dies war auch der Versuch die schmerzlich gewordene Geschichte abzuschütteln, was freilich misslingen musste, denn so tief sind auch auf Island die Keller nicht, dass dich die unbewältigte Vergangenheit nicht doch irgendwann findet.
Niemand weiß dies besser als Kommissar Erlendur. Er gibt sich selbst die Schuld am tragischen Wintertod seines jüngeren Bruders, den er in Albträumen immer wieder durchleben muss und dessen Leiche nie gefunden wurde. Auch deshalb lässt er nicht locker in seinem Bemühen, das Geheimnis um Guðlaugur zu lüften. Als Kriminalist weist Erlendur darüber hinaus manische Züge auf. Die Arbeit ist sein Leben bzw. seine Chance vor dem Leben zu flüchten. Arnaldur lässt das Schicksal erneut hart zuschlagen: Erlendur ist so einsam, dass er es daheim nicht mehr aushält und lieber in ein Hotel zieht, wo er sich ebenso verzweifelt wie hoffnungslos um eine Frau bemüht. Seine Ex-Gattin hasst ihn aus tiefster Seele, seine drogenabhängige Tochter droht erneut der Sucht zu verfallen. Erlendur hat auch einen Sohn; der ist Alkoholiker.
Das ist fast schon zu viel des Depressiven, wäre da nicht Arnaldurs Kunst, die böse Realität mit sehr viel trockenem Humor darzustellen. Isländer knausern mit Worten. Was sie zu sagen haben, bringen sie möglichst auf den Punkt. Das lässt sich in wunderbaren Onelinern konzentrieren. Erlendurs Kollegen von der Kriminalpolizei sind in dieser Beziehung besonders erfinderisch. Hinter ihrem Sarkasmus verbergen sie die Seelenpein, die ihnen ihre unerfreuliche Arbeit oft beschert. Trotzdem sorgen sie für willkommene Auflockerungen, denn Erlendur, der geplagte Mann mit Charaktertiefe aber wenig Eigenschaften, wäre auf Dauer und ausschließlich als Kriminalist wohl doch schwer zu ertragen.
Im allzu Menschlichen verbirgt sich schließlich auch die Wahrheit im Mordfall Guðlaugur. Man sollte nicht versuchen, schneller zum Täter vorzudringen als Erlandur; der Verfasser spielt zwar fair, d. h. der Mörder gehört zum Kreis der handelnden Figuren, doch er denkt nicht daran, ihn durch nachträglich verdächtige Randbemerkungen anzukündigen. Wie die ganz und gar nicht kriminalistisch genial wirkende Polizei bleiben wir Leser ratlos – und sind schließlich genauso überrascht wie diese, als der Fall eine deprimierende Finalwendung nimmt.
Arnaldur Indriðason wurde am 8. Januar 1961 in Reykjavík geboren. Er wuchs hier auf, ging zur Schule, studierte Geschichte an der University of Iceland. 1981/82 arbeitete als Journalist für das „Morgunbladid“, dann wurde er freiberuflicher Drehbuchautor. Für seinen alten Arbeitgeber schrieb er noch bis 2001 Filmkritiken. Auch heute noch lebt der Schriftsteller mit Frau und drei Kindern in Reykjavík.
1995 begann Arnaldur Romane zu schreiben. „Synir duftsins“ – gleichzeitig der erste Erlendur-Roman – markierte 1997 sein Debüt. Jährlich legt der Autor mindestens einen neuen Titel vor. Inzwischen gilt er – auch im Ausland – als einer der führenden Kriminalschriftsteller Islands. Gleich zweimal in Folge wurde ihm der „Glass Key Prize“- der Skandinaviska Kriminalselskapet (Crime Writers of Scandinavia) – verliehen (2002 für „Nordermoor“, 2003 für „Todeshauch).
Drei seiner Romane hat Arnaldur selbst in Hörspiele für den Icelandic Broadcasting Service verwandelt. Darüber hinaus bereiten die isländischen Regisseure Baltasar Kormákur bzw Snorri Thórisson Verfilmungen von „Nordermoor“ bzw. dem Thriller „Napóleonsskjölin“ (Operation Napoleon), den Arnaldur 1999 schrieb, vor.
Die Erlendur-Romane erscheinen gebunden und als Taschenbücher im (|Bastei-)Lübbe|-Verlag:
(1997) [Menschensöhne 1217 („Synir duftsins“) – TB Nr. 15530
(1998) „Dauðarósir“ (noch nicht in Deutschland erschienen)
(2000) [Nordermoor 402 („Mýrin“) – TB Nr. 14857
(2001) [Todeshauch 856 („Grafarþögn“) TB Nr. 15103
(2002) [Engelsstimme 721 („Röddin“) – TB Nr. 15440
(2004) [Kältezone 2274 („Kleifarvatn“)
(2006) „Vetraborgin“ (noch nicht in Deutschland erschienen)
Richard Matheson – Das Höllenhaus

Botting, Douglas – große Zeppelin, Der
Der Traum ist – so lautet eine der zahllosen Definitionen – ein Ventil, das unser Hirn benötigt, um in der Nacht kreativen Überdruck abzulassen, der in der grauen Realität des Tages meist fehl am Platze ist, denn dort haben Krämerseelen, Erbsenzähler oder Notstandsverwalter das Sagen. Nur manchmal geschieht es, dass die sonst vergeudete Energie, statt im Nichts zu verpuffen, den Weg ins Hier & Heute findet, um dort jenen komplexen Mechanismus aus Versuch & Irrtum anzutreiben, dem wir Menschen es verdanken, dass wir als Adresse nicht mehr die Höhle Nr. Sicher angeben müssen.
Was haben die raren Zeitgenossen, die von uns weniger Klugen oder Mutigen als „Spinner“ verlacht werden, bis wir sie nach wider Erwarten sich einstellendem Erfolg zum „Genie“ befördern, nicht zu erdulden, während sie unbeirrt ihrem seltsamen Drang folgen, der Welt etwas zu schenken, was diese zwar selten verdient, aber oft genug gut gebrauchen kann! Die Geschichte dieser erfindungsreichen Geister ist mit der des Zeppelins praktisch deckungsgleich. Im Nachhinein gibt es natürlich viele kluge Antworten auf die Frage, wieso das Luftschiff gerade um 1900 erfunden wurde, aber wie Douglas Botting so informativ wie unterhaltsam darzulegen weiß, ist die historische Wahrheit nur die Hälfte der Geschichte.
Luftschiffe sind keine Objekte nüchterner Betrachtung; das sind sie höchstens für Regierungen und Konzerne, die sie bezahlen müssen. Ansonsten stellen sie Objekte der Bewunderung und Projektionsflächen für die Träume der normalsterblichen Bodenbewohner dar. Weil Zeppeline üblicherweise recht voluminöse Gebilde sind, verbinden sich mit ihren entsprechend große oder großartige Träume. „Dr. Eckeners Traum-Maschine“ nennt denn auch der Verfasser sehr viel treffender, als der prosaische deutsche Titel dies auszudrücken vermag, sein Werk. Was er damit meint, führt er uns sogleich überzeugend vor Augen, als er mit der Chronologie seiner Zeppelin-Historie bricht und die Ehrfurcht gebietenden Riesen der Lüfte in den Stunden ihrer größten Triumphe zeigt. Die sagenhafte Erdumkreisung des „Grafen Zeppelin“ von 1929 führt dem Leser aber exemplarisch auch vor Augen, dass eine der ganz großen technischen Errungenschaften der Menschheitsgeschichte enden musste wie sie begann: großartig, aber tragisch.
Dr. Hugo Eckener (1868-1954) ist für beides der ideale Hauptdarsteller. Ein nüchterner, auf Sicherheit und Zuverlässigkeit schwörender, genialer, sturer, schroffer, selbstbewusster, hoch verehrter, verschlossener, überlebensgroßer Mann, alles andere als ein trauriger Held, sondern eine Persönlichkeit mit Visionen und der Kraft, diese allen Widrigkeiten zum Trotz umzusetzen. Wohl nur Eckener konnte quasi im Alleingang die Luftschifffahrt Wirklichkeit werden lassen, weiß Botting deutlich zu machen, und was den Unterschied ausmacht, erklärt er uns, indem er Eckener den legendären Grafen Ferdinand von Zeppelin gegenüber stellt, der als eigentlicher Erfinder der (starren) Luftschiffe gilt, doch als solcher eigentlich ein Geschöpf der Medien war und sogar von Eckener, der sich als Journalist und Sachbuch-Autor mit der Materie auskannte, als solches erschaffen wurde. Graf Zeppelin war allerdings „nur“ der Mann mit der richtigen Idee, der mit dieser geistig nicht Schritt halten konnte und schließlich von ihr vereinnahmt wurde, Eckener dagegen ein Visionär auf dem Boden nackter Tatsachen, der stets bereit und fähig war dazuzulernen.
Er war zudem eine Führergestalt im positiven Sinne. Da der direkte Vergleich historisch möglich ist, zieht Botting ihn. Anders als Hitler besteht Eckener diesen Test, denn die Beweise sagen eindeutig, dass die Nazis mit ihrem genialen Luftschiffer gar nicht glücklich wurden. Mit seltener, durchaus tollkühner Eindeutigkeit hat sich Eckener gegen Hitler und sein Regime ausgesprochen. Nur sein Prominentenstatus als Liebling des deutschen Volkes, dem anders als sein „Führer“ die Zeppeline wert & teuer waren, rettete Eckener die Freiheit und womöglich das Leben. Seine scharfe Zunge kostete ihn freilich die über Jahrzehnte hart erarbeitete Vormachtstellung im deutschen Luftschiff-Bau: Als er d a s Meisterwerk der Zeppelin-Kunst, die „Hindenburg“, verwirklicht sehen wollte, musste er doch manche braune Kröte schlucken, um nicht kaltgestellt zu werden.
Die Geschichte der „Hindenburg“ bildet den zweiten Teil dieses Buches. Sie scheint hinlänglich bekannt, konzentriert sich aber tatsächlich meist auf jenen explosiven Moment, als dieses Schiff 1937 über dem Landefeld von Lakehurst havarierte und damit das Ende einer Epoche besiegelte. Botting macht deutlich, dass dies zu kurz gedacht ist. Die „Hindenburg“ symbolisiert einerseits das Ende einer grandiosen Sackgasse der Luftfahrt: Das Flugzeug hatte schon damals den Zeppelin eingeholt und überflügelt. Andererseits stellt die „Hindenburg“ noch heute eine technische Glanzleistung dar. Nach mehr als zwei Jahrzehnten grüner Verteufelung aller nicht auf Bäumen gewachsener Schöpfungen menschlichen Erfindergeistes ist es etwas aus der Mode gekommen, solche zur Kenntnis zu nehmen. Zudem wäre es falsch, die Katastrophe von Lakehurst mit dem Ende der Luftschifffahrt gleichzusetzen: Schließlich gab es noch einen heute fast vergessenen „Graf Zeppelin II“, der dem unglücklichen Schwesterschiff an Größe nicht nachstand. Erst der II. Weltkrieg machte Dr. Eckeners Traum-Maschine endgültig den Garaus.
Aber der Traum als solcher lebt: Douglas Botting bekennt sich selbst zu ihm und lässt dabei exakt dasselbe Maß an Selbsttäuschung erkennen, das auch Eckener und seine Gasschiff-Jünger einst an den Tag legten. Zum Zeitpunkt der Niederschrift von „Der große Zeppelin“ schien es, als ob die alte Pracht und Herrlichkeit in Deutschland wieder erstehen würde. „CargoLifter“ hieß die „Hindenburg“ der Gegenwart; ein Projekt, auf das Botting in einem Schlusskapitel voller Zuversicht und Hoffnung nicht nur hinweist, sondern – wohl ohne es selbst zu bemerken – von dem er enthusiastisch schwärmt. Wieder sah auf dem Papier alles glänzend aus: Nicht als Passagierschiff, sondern als fliegender Kran und Transporter für gewaltige, sperrige Fracht war der „CargoLifter“ konzipiert; in der Vergangenheitsform muss man inzwischen über ihn sprechen, denn Bottings Vision von der Wiederkehr der ruhigen Riesen zerstob ebenso wie die Hoffnung der „CargoLifter“-Aktionäre auf eine fette Rendite. Bei eindrucksvollen Computer-Simulationen ist es bisher geblieben, während die Kosten noch spektakulärer explodierten als einst die „Hindenburg“. Schlagzeilen macht der „CargoLifter“ höchstens als Pleitegeier. Eine gigantische Werfthalle nahe Berlin, die größte ihrer Art in der Welt, in deren lichter Kuppel sich echte Wolken bilden, und die heute als exotische Freizeitanlage genutzt wird, legen Zeugnis darüber ab, dass Luftschiffe heute mehr denn je Traum-Maschinen sind.
So bleibt einmal mehr nur der Blick zurück in eine schier unglaubliche Epoche. Die Bilder, die Botting zusammengetragen hat, lassen völlig ungeachtet des Wissens, wie dieser Traum endete, beim Betrachter den unbändigen Wunsch aufsteigen, selbst sofort mitzufliegen. (Sie leiden freilich unter ihrem zu geringen Format – wie immer und überall beansprucht so ein Zeppelin auch als Abbildung eine Menge Raum!) Kluge Köpfe wurden über der Frage zerbrochen, wieso dies so war, ist und immer sein wird. Kaffeesatz-Psychologen wiesen gern auf die frivole Form der Luftschiffe hin, und tatsächlich lässt sich mit Fug und Recht behaupten, dass Deutschland einst auf dieser Welt den Längsten hatte. Botting mag sich dieser simplen Interpretation nicht anschließen, und er hat wohl Recht: Primär ist es wohl die Kombination von Größe und Schwerelosigkeit, die dem Luftschiff seinen Nimbus verleiht. Immer wieder schwärmen Zeugen von der Freiheit, die in einem Zeppelin über den Wolken tatsächlich grenzenlos war. Das erschließt sich dem heutigen Leser so mühelos, dass daran wohl etwas dran sein muss.
Fasman, Jon – Bibliothek des Alchemisten, Die
Im Jahre des Herrn 1154 schickt Roger II., der wissenschaftlich stark interessierte König von Sizilien, seinen Geografen al-Idrisi auf eine heikle Mission: Der arabische Gelehrte soll eine Karte der bekannten Welt zeichnen. Roger hat den richtigen Mann für diese Aufgabe gefunden. Al-Idrisi gilt nicht grundlos als genialer Forscher und brillanter Kartograph. Der König bot seinem Gast sämtliche Möglichkeiten zur Forschung. Al-Idrisi dankte es seinem Herrn mit bemerkenswerten Entdeckungen. Die Begeisterung des Arabers über den aktuellen Auftrag hält sich freilich in Grenzen. Seine Reise ist höchst gefährlich und wird ihn viele Jahre seinem Labor fernhalten.
Außerdem sind da bestimmte Experimente, über die al-Idrisi lieber schweigt. Er betätigt sich auch als Alchemist, was ihn als Magier verdächtigt machen und die gefährliche Aufmerksamkeit der Kirche wecken könnte. So hat er ein Rezept entdeckt, das sein Leben weit über das übliche Maß verlängert. Hinweise darauf geben einige Instrumente und Artefakte, die in al-Idrisis Labor zurückblieben. Dort hat sich der Dieb Omar Iblis seine Abwesenheit zu Nutze gemacht, ist in sein Labor eingebrochen und hat die unersetzlichen Objekte gestohlen. Sie werden im Laufe der nächsten Jahrhunderte vor allem in die Weiten der späteren UdSSR zerstreut.
Al-Idrisi hatte einige Alchemistenkollegen in sein Geheimnis eingeweiht. Diese gründeten einen Bund, den sie seiner Bewahrung weihten. Skrupellose Männer trugen das Verlorene wieder zusammen. Der letzte Hüter erwies sich als Verräter, was einen erbitterten Kampf im Verborgenen ausgelöst hat: Die Alchemisten wollen ihren Schatz zurück – um wirklich jeden Preis!
Von alledem ahnt der junge Paul Tomm gar nichts. Er arbeitet als Journalist für eine kleine Wochenzeitschrift, die im Städtchen Lincoln im neuenglischen US-Staat Connecticut über die alltäglichen Vorfälle in einem recht verschlafenen Ort berichtet. In dieses Muster passt Tomms aktuelle Recherche: Er soll einen Nachruf für den just verblichenen Jaan Pühapäev schreiben, der an der Universität im nahen Wickenden sehr unauffällig als Linguist und Professor für baltische Geschichte tätig gewesen ist. Tomms Interesse erwacht, als er herausfindet, dass Pühapäev weit mehr war als ein weltfremder Bücherwurm. Offenbar gehört er einem Orden oder einer Sekte an, die (s. o.) nach gewissen Objekten fahndet. Paul gerät den Alchemisten in die Quere, aber was zunächst wie die Story seines Lebens aussieht, droht ihn bald genau jenes zu kosten …
(Randbemerkung: Sage ich zu viel über die Handlung? Nun, meine Idee war es nicht, dieses Buch im Deutschen „Die Bibliothek des Alchemisten“ zu nennen und damit bereits im Titel zu verraten, wer hinter dem mysteriösen Geschehen steckt …)
Ein dunkles Geheimnis aus ferner Vergangenheit wirft in der Gegenwart bedrohliche Schatten: Auf diese wenigen Worte lässt sich der Plot von „Die Bibliothek des Alchemisten“ reduzieren. Geht man von der alten Hollywood-Weisheit aus, dass sich eine richtig gute Story auf der Rückseite einer Streichholzschachtel skizzieren lassen muss, darf man zwar nichts Neues aber trotzdem Großes = Spannendes von diesem Roman erwarten.
Es setzt auch erfreulich, wenn auch gemächlich ein. „Die Bibliothek …“ startet zwei Handlungsstränge, die zunächst nichts miteinander zu tun haben – die kommentierte Geschichte diverser Gegenstände aus al-Idrisis Labor sowie der Bericht von Paul Tomm, der von einem autobiografischen Abriss mit zahlreichen „coming of age“-Elementen langsam (sehr langsam) in eine Thriller-Handlung übergeht. Allmählich kristallisieren sich diverse Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und Gegenwart heraus; Verfasser Fasman weiß hier geschickt die Spannung zu schüren, indem er jedem Artefakt eine „Karteikarte“ zuordnet, die es als Museumsobjekt zu beschreiben scheint. Entscheidende Episoden aus der Historie der Stücke werden erzählt; sie enthüllen eine endlose Kette von Gräueltaten, die im Laufe von Jahrhunderten um ihren Besitz begangen werden. Diese Rückblicke bleiben unkommentiert. Wer schreibt sie, was ist der Grund? Es bleibt offen, der Leser muss sich selbst einen Reim darauf machen.
Die eigentliche Handlung ist ihm keine große Hilfe. Während Fasman die historischen Vignetten sehr gut gelingen, geht ihm im Paul-Tomm-Strang die Puste aus. Er kommt einfach nicht auf den Punkt. Mehr als hundert Seiten vergehen, ehe überhaupt etwas geschieht, das den Thriller andeutet. Leider wird das nicht besser, sondern geht ebenso behäbig weiter. Fasman scheint lieber vom Alltag eines jungen Mannes – sein Alter Ego? – zu erzählen, der nach seinem Platz in dieser Welt sucht. Die entsprechenden Fragen mögen ihn, der noch recht jung ist (Jahrgang 1975), stark beschäftigen, doch im Rahmen eines Thrillers drücken sie in dieser epischen Breite auf Tempo und Spannung. Fasman hätte lieber den Handlungsmotor mit mehr Hirnschmalz schmieren sollen: Als es endlich ein wenig lebhafter wird, wirken die Thrillerelemente hausbacken und ungelenk.
Die meisten alchemistischen Artefakte tauchen in der historischen UdSSR bzw. in deren Nachfolgestaaten auf. Das ist kein Zufall, sondern lässt sich mit Fasmans Biografie erklären; der Autor hat einige Jahre in Moskau gelebt und gearbeitet und dort auch „Die Bibliothek …“ geschrieben. Als Journalist steht er in den Passagen, die in allerlei exotischen Winkeln des versunkenen Sowjetreiches spielen, auf spürbar sicherem Boden. Hier bietet der Roman eine Qualität, die man in der Haupthandlung schmerzlich vermisst.
Als das Rätsel des Alchemisten endlich gelüftet wird, ist das Interesse an diesem Roman fast erloschen. Das letzte Kapitel schreibt Hannah Rowe – es gibt da noch eine ganze Reihe von offenen Fragen, die abschließend zu klären sind: Kein gutes Zeichen, wenn solche Erklärungen einem Roman quasi angeklebt werden. Als Leser ist man bei der Lektüre geblieben, weil man nach vielen Stunden noch wissen will, wie es ausgeht, und weil Fasman anders als allzu viele „Schriftsteller“, welche den aktuell so beliebten „Da-Vinci-Code“-Quark in den Buchläden der Welt breit treten, immerhin schreiben kann. Damit hievt der Autor sein Werk jedoch nur auf Mittelmaß: Zufriedenheit und Enttäuschung halten sich mühsam die Waage. Fasman hat sich viel vorgenommen, aber nur wenig erreicht.
Werfen wir einen näheren Blick auf die Figuren. Über Paul Tomm wurde bereits weiter oben geklagt. Dies ließe sich hier fortsetzen. Ihr Rezensent bittet Sie allerdings, ihm dies zu erlassen und zu glauben, dass Mr. Fasman die Schaffung eines jungen, unerfahrenen Charakters allzu gut gelungen, aber Paul als glaubhafter Handlungsträger kaum tauglich ist. Auch sonst treten nur Chargen auf, die mit viel Klischeewolle gestopft wurden. Väterlicher Freund des Helden, kantiger Bulle mit Herz aus Gold, schwarzhumoriger Pathologe, weltfremder Universitätsdozent … Sie alle sind fest verankert in der modernen Unterhaltung, sollten jedoch nicht so eindimensional daherkommen wie hier.
Wieso sich Hannah in Paul „verliebt“, wird uns nachträglich aufdringlich erläutert. Zu ihrem Glück ist das Opfer keine Leuchte, denn als Agentin taugt Hannah ganz sicher nicht. Damit der Leser merkt, dass sie verdächtig ist, lässt Fasman sie etwa so diskret handeln wie Mata Hari in einem Stummfilm der 1920er Jahre. Dass mit der guten Hannah Rowe, die sich so bereitwillig in Pauls Bett ziehen lässt, etwas faul ist, merkt so, wie Fasman an die Sache herangeht, selbst der inzwischen schläfrig gewordene Leser. Nur der gute Paul ist wie gesagt mit einer Blindheit geschlagen, die man ihm gern durch einen kräftigen Tritt in den Hintern austreiben möchte. Neu-England muss ein Ort sein, der dem menschlichen Verstand nicht sehr zuträglich ist …
Die Alchemisten-Schurken in unserem Spektakel konzentrieren sich glücklicherweise auf ihren Job. Sie suchen und killen und treten primär in den Rückblenden auf. Das bekommt ihnen gut, denn sie müssen nicht hilflos im Sumpf der Fasman’schen Trivialcharakterisierungen versinken. Erst im großen Finale – das sich auf eine lächerliche Prügelei und umständliches Geschwätz beschränkt – kommt der Chefgauner aus seinem Loch. Er enthüllt einen Masterplan, über dessen „Sinn“ man lieber nicht nachdenken sollte, weil man sich sonst nachträglich ärgern würde, diesem Roman so viele Stunden gewidmet zu haben, und entfernt sich zwecks weiterer Spinntrigen (aber hoffentlich nicht in Vorbereitung einer Fortsetzung!) in die weite Welt.
Jon Fasman wurde 1975 in Chicago geboren. Er wuchs in Washington, D.C., auf und studierte in Rhode Island Englische Literatur der Renaissancezeit. Anschließend arbeitete er für eine kleine Wochenzeitschrift. Die Heirat mit einer aus Russland gebürtigen Frau veranlasste ihn, dieser nach Moskau zu folgen, wo er – ein Fremder in einem fremden Land – für die „Moscow Times“, eine englischsprachige Zeitung, tätig wurde und genug Muße zur Niederschrift seines ersten Romans fand. „The Geographer’s Library“ entstand nach eigener Auskunft als Zeitvertreib und verarbeitete, was sein Verfasser über die Verhältnisse und die Geschichte seines neuen Heimatlandes lernte. Später fand das Manuskript seinen Weg zum renommierten |Penguin|-Verlag in New York, wo es 2005 als Fasmans Debütwerk erschien.
Der Autor hat Moskau inzwischen verlassen und leben in London, wo er für „The Economist“ schreibt. Er arbeitet an einen neuen Thriller mit fantastischen Elementen, der wiederum im fiktiven Wickenden spielt, das dem realen neuenglischen Providence nachempfunden wurde.
http://www.heyne.de
Rennie Airth – Orte der Finsternis

Sullivan, Mark T. – Geistertanz
Lawton in den Green Mountains im US-Bundesstaat Vermont, im Frühjahr 1998: Der Dokumentar-Filmer Patrick Gallagher besucht den kleinen, abgelegenen Ort, um für ein neues Projekt zu recherchieren. Um die Jahrhundertwende hat der Gemeinde-Pfarrer Pater Victor D’Angelo in Lawton angeblich zahlreiche Dorfbewohner durch das Auflegen seiner Hände vor dem sicheren Tod bewahrt. War D’Angelo ein Heiliger? Pater McColl, der heute die Gemeinde Lawton leitet, hat das komplizierte kirchliche Verfahren in Gang gesetzt, durch das D’Angelo selig oder sogar heilig gesprochen werden könnte. Über diesen Mann und seine Geschichte will Gallagher einen Film drehen.
In Lawton werden Fremde mit Misstrauen bedacht – besonders, wenn sie womöglich die Kür eines eigenen Ortsheiligen gefährden könnten! Das stellt Gallagher rasch fest, als er sich um eine Unterkunft bemüht. Erst Andromeda „Andie“ Nightingale, die als Sergeant für die Kriminalpolizei des Ortes arbeitet, ist bereit, ihm eine Hütte zu vermieten. Sobald Gallagher sich eingerichtet hat, drängt es den passionierten Angler zum Bluekill River. Nach kurzer Zeit geht ihm ein wahrhaft kapitalen Brocken an den Haken: die Leiche des brutal ermordeten Zahnarztes Hank Potter.
Andie Nightingale findet unter den Hinterlassenschaften Potters eine seltsame Zeichnung, die laut Gallagher Charun darstellt, den mythologischen Fährmann der Seelen in das Reich der Toten. So viel humanistische Bildung lässt den Filmmann für Chief Mike Kerris und Lieutenant Brigid Bowman, Nightingales Kollegen bei der Polizei, umgehend zum Hauptverdächtigen aufsteigen. Der Druck auf Gallagher wächst, als weitere Morde „Charuns“, wie der Killer bald genannt wird, Lawton in Unruhe versetzen. Dennoch kann Gallagher Nightingales Vertrauen gewinnen und sie bei ihren Ermittlungen unterstützen. Sie finden heraus, dass Charun es auf die Besitzer eines mysteriösen Tagebuchs abgesehen hat, das die junge Indianerfrau Sarah Many Horses – eine Nichte Sitting Bulls – vor mehr als einem Jahrhundert niedergeschrieben hat und das nach ihrem Tode aufgeteilt wurde. Die Aufzeichnungen werfen ein äußerst unvorteilhaftes Licht auf die damals wie heute die Geschicke Lawtons bestimmenden Familien. Schlimmer noch: Many Horses starb unter grotesken Umständen, die auch Pater D’Angelo in den Kreis der Verdächtigen ziehen. Will Charun die Spuren dieser alten Kollektiv-Schuld tilgen?
„Geistertanz“ ist ein Roman, dessen Handlung von falschen Fährten, mutwillig angelegten Sackgassen und mehrdeutigen Anspielungen bestimmt wird. Das beginnt bereits mit dem Titel, der auf ein reales historisches Phänomen anspielt: den pseudo-religiösen Kult der Geistertanz-Bewegung, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts unter den Indianerstämmen des US-amerikanischen Westens aufkam. Von den weißen Siedlern, den Soldaten und der Regierung immer stärker bedrängt, entlud sich der äußere und innere Druck der Ureinwohner in einem an sich wahnwitzigen Irrglauben, in dem eigene Mythen sich mit Elementen des Christentums mischten. Der „Geistertanz“ sollte eine Brücke zwischen den zahllosen toten und den wenigen überlebenden Kriegern schlagen, die dann gemeinsam gegen den verhassten weißen Feind vorgehen zu können glaubten. Außerdem waren die Anhänger des Kultes überzeugt, von nun an unverwundbar zu sein. Der US-Regierung machte weniger die Sorge um die Realität dieser aus Verzweiflung geborenen Bewegung zu schaffen als die plötzliche Einigkeit zwischen eigentlich verfeindeten Stämmen, die sich zu einem gefährlichen, weil sehr realen Gegner entwickeln konnten. So wurden Truppen ausgeschickt, die den Geistertanz-Glauben niederhalten sollten. Erwartungsgemäß kam es dabei zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, die im Winter 1891 in South Dakota in einem Massaker am Wounded Knee gipfelten, bei dem die Armee „vorsichtshalber“ viele hundert Männer, Frauen und Kinder niedermetzelte – eines der bekannteren Gräuel der modernen Geschichte.
Sullivans fiktive Sioux-Frau Many Horses ist eine Überlebende von Wounded Knee und eine der Letzten, die das Geistertanz-Ritual kennt. Mehr als dieses lokalkoloritische Element trägt sie nicht zum Roman bei. Die Geschichte, wie Many Horses nach Lawton kam, um dort einer bizarren örtlichen Sekte buchstäblich zum Opfer zu fallen, ist sehr interessant zu lesen und wird vom Autor auch sehr spannend nach und nach enthüllt, doch sie trägt angesichts des Raumes, die Sullivan ihr zugesteht, zur eigentlichen Geschichte zu wenig bei. Fakt ist, dass Many Horses‘ Tod bzw. der weiter bestehende Aberglaube um ihre wundertätigen Kräfte zwar die Ursache für die Morde von Lawton ist. Doch das ist nicht das Thema der von Sullivan ausgewalzten Vorgeschichte zur Mordserie von 1998.
Wie ist es überhaupt um die angebliche Wunderkraft bestellt? Sullivan spielt ständig mit übernatürlichen Elementen, nur um sie im Finale sämtlich „logisch“ aufzulösen. Es gibt in Lawton keine indianischen Rachegeister, und es gab sie nie. Dann fragt man sich als Leser natürlich, wieso Sullivan seinen Roman mit einem Kapitel einleitet, das im Jahre 1918 spielt und den angeblichen Heiligen Pater D’Angelo eindeutig als Wunderheiler beschreibt. Die Erklärung ist ebenso einfach wie ärgerlich: Sullivan bedient sich eines simplen Tricks, um das Interesse seines Publikums zu erregen. Als er am Schluss seiner Geschichte eher beiläufig das Thema noch einmal aufgreift, versucht er sich mit der Binsenweisheit, dass Glaube Berge versetze, aus der Affäre zu ziehen – eine sehr unbefriedigende „Lösung“, die zudem suggeriert, der Leser müsse halt selbst entscheiden, wie „geisterhaft“ die Ereignisse der verstrichenen Seiten nun zu werten sind.
Solche faulen Tricks hätte der Roman gar nicht nötig. „Geistertanz“ ist ein solide konstruiertes und kompetent (wenn auch ein wenig hausbacken) geschriebenes Buch. Die Fakten sind sauber recherchiert, was kaum verwunderlich ist, wenn man sich vor Augen führt, dass Mark T. Sullivan, der als Wirtschaftskorrespondent für die Agentur Reuters in Chicago arbeitet, bereits zweimal für den renommierten Pulitzer-Preis nominiert wurde und sein journalistisches Handwerk nachweislich beherrscht. Die einfach gestrickte und altmodische, aber in zahllosen Romanen und Filmen bereits bewährte Geschichte vom düsteren Geheimnis in einem kleinen, abgegrenzten, nur scheinbar idyllischen Ort bringt er gut über die Runden. Schade nur, dass er im Finale auf den obligatorischen Killer mit erheblichem Dachschaden zurückgreift; typisch dann aber wieder, dass er plötzlich noch einen zweiten, den „richtigen“ Bösewicht aus dem Hut zaubert.
Mit seinen beiden Hauptfiguren Gallagher und Nightingale hat sich Sullivan beinahe schon zu viel Mühe gegeben. Er möchte imaginären Figuren echtes Leben einhauchen, was an sich nur zu begrüßen ist. Doch er geht in seinem Eifer oft zu weit, wenn er Seite um Seite tragische Ereignisse aus der Vergangenheit Gallaghers und Nightingales (harte Kindheit, persönliche Enttäuschungen, Alkoholismus, Schuldgefühle usw. usf.) nacherzählt, die mit der eigentlichen Handlung nicht das Geringste zu tun haben. „Geistertanz“ ist somit ein durchschnittlicher, gut lesbarer und bis auf das enttäuschende Finale spannender Roman, der sich indes ein wenig wichtiger nimmt, als ihm zukommt.
Hiaasen, Carl – Unter die Haut
Er ist nicht der Mann, mit dem man sich unbedingt anlegen sollte: Mike Stranahan war ehemals Soldat in Vietnam (1) und wurde später Ermittler für die Staatsanwaltschaft von Dade County im US-Staat Florida. Nachdem er im Dienst und in Notwehr drei Menschen und zuletzt einen korrupten Richter erschossen hat, beschloss die Behörde, ihn lieber mit einer guten Pension nach Hause zu schicken. Gerade vierzig Jahre alt geworden, bewohnt Stranahan seitdem im „Stelzendorf“ an der Biscayne Bay und damit direkt am Wasser ein altes Haus auf hohen Pfählen und lebt nach seiner fünften Scheidung recht vergnügt in den Tag hinein, als die Vergangenheit ausgerechnet in der Gestalt von ‚Dr.‘ Rudy Graveline wieder auflebt. Der ebenso geldgierige wie unfähige Schönheitschirurg hat bereits eine blutige Spur durch einige Bundesstaaten gezogen. Im Norden ist ihm der Boden zu heiß geworden, aber in Florida ist er endlich auf jenes Umfeld aus Bestechlichkeit, Dummheit und Eitelkeit gestoßen, das es ihm ermöglichte, nicht nur sein unheilvolles medizinisches Werk fortzusetzen, sondern sogar eine eigene, äußerst gut gehende Privatklinik namens „Whispering Palms“ zu gründen, in der sich die Reichen und Berühmten von echten oder eingebildeten Schönheitsfehlern befreien lassen können.
Nur noch selten greift Graveline selbst zu Skalpell und Fettabsauger. Er ist vorsichtig geworden, seit er vor vier Jahren einen Routine-Eingriff verpfuscht hat und ihm die junge Vicky Barletta auf dem Operationstisch gestorben ist. Mit Hilfe einflussreicher Freunde hat Graveline dies vertuscht und die Leiche verschwinden lassen. Doch jetzt droht alles wieder ans Licht zu kommen: Der eingebildete TV-‚Reporter‘ Reynaldo Flemm ist auf den Barletta-Fall aufmerksam geworden und will ihn in seiner primitiven, aber bei der Proleten-Fraktion des Publikums sehr beliebten Krawallshow präsentieren. Noch schlimmer: Die Mordkommission könnte die Untersuchung wieder aufnehmen! Zwar zeigt die Staatsmacht wie üblich wenig Neigungen in dieser Richtung, doch Graveline weiß, dass einen der damaligen Ermittler der ungelöste Fall noch heute wie ein Stachel im Fleisch schmerzt. Sein Name: Mike Stranahan!
Graveline gerät in Panik und heuert einen Killer an. „Tony der Aal“, eine freundliche Leihgabe der örtlichen Mafia, geht allerdings seinen Job mit mehr Elan als Intelligenz an und wird von Stranahan unter Zuhilfenahme eines ausgestopften Schwertfisches ins Jenseits befördert. Der nächste Gegner ist von anderem Kaliber: Blondell Tatum, genannt „Chemo“, dessen Gefühlskälte eindrucksvoll durch seine Physiognomie widergespiegelt wird, die der des Frankenstein-Monsters gleicht.
Dass immer neue Mordanschläge auf ihn verübt werden, reißt Stranahan aus seiner Frührentner-Lethargie. Er nimmt als Privatmann die Ermittlungen auf, was ihn der Verpflichtung enthebt, dabei den Buchstaben des Gesetzes Folge zu leisten. Rasch entspinnt sich an der sonnigen Küste Südfloridas eine blutige Komödie der Irrungen und Wirrungen, in der auch Stranahans ‚Haustier‘ – ein mannsgroßer Barrakuda – kräftig mitmischt …
Die Welt ist schlecht: Selten ist dieser Stoßseufzer so überzeugend in Worte gegossen worden wie in „Unter die Haut“, einer weiteren Runde im Kampf Carl Hiaasens gegen die allgegenwärtige Dreifaltigkeit der modernen menschlichen Zivilisation – Dummheit, Gier und Ignoranz. In Florida scheinen sich diese wenig erfreulichen Wesenszüge besonders prächtig zu entwickeln. Vielleicht kann Hiaasen aber auch einfach seinen Heimvorteil ausspielen: Er kennt diesen Teil der Vereinigten Staaten wie seine Westentasche, und das schließt die von der Tropensonne kaum beschienenen Bereiche ausdrücklich mit ein.
Carl Hiaasen wurde 1953 in Florida geboren; er ging hier zu Schule, studierte hier (bis 1974) Journalistik und ging anschließend zum „Miami Herald“. Bei dieser Zeitung ist er noch heute und schreibt Kolumnen und Berichte, in denen er jene Sünden anprangert, mit denen wir auch in seinen Romanen immer wieder konfrontiert werden. Zu schaffen macht Hiaasen besonders der unentwirrbare Filz aus Politik, Wirtschaft und Verbrechen, der Florida in Sachen Korruption und Umweltzerstörung einen traurigen Spitzenplatz in den USA garantiert.
Da Hiaasen die Erfahrung machen musste, dass seine wütenden Attacken im täglichen Mediengewitter mehr oder weniger untergingen, begann er ab 1981 Romane zu schreiben, die in spannender Thrillerform und scheinbar fiktiv die genannten Missstände auch jenem Publikum nahe zu bringen verstehen, die gemeinhin nur den Sportteil einer Zeitung zur Kenntnis nehmen. Zunächst ‚übte‘ Hiaasen und schrieb die ersten drei Romane mit seinem Journalisten-Kollegen William D. Montalbano, bevor er sich mit „Tourist Season“ (dt. „Miami Terror“) 1986 quasi selbstständig machte. Schon früh begann er damit, die bittere Medizin, die er verabreichen wollte, zu versüßen, indem er dazu überging, immer groteskere Plots für seine ohnehin actionbetonten Geschichten zu entwerfen. Ironie und Sarkasmus, die jederzeit in blanken Zynismus umschlagen können, versuchen die Welt, wie Hiaasen sie in Florida vorzufinden glaubt, als Tollhaus zu demaskieren.
Die Rechnung ging auf: Weil Hiaasen sein Talent, wirklich krude Geschichten mit knochentrockenem und dadurch um so wirksamerem Witz zu entwerfen, rasch zur Perfektion entwickelte, fand er sein Publikum. Den Ritterschlag als echter Bestseller-Autor erhielt Hiaasen, als Mitte der 90er Jahre Hollywood auf ihn aufmerksam wurde. Zwar entwickelte sich „Striptease“ nicht zuletzt dank seiner Hauptdarstellerin, der unsäglichen Demi (no) Moore, zu einem üblen Kassengift, aber immerhin konnte Hiaasen (übrigens auch hierzulande) einen Popularitätsschub verzeichnen.
„Unter die Haut“ zeigt Carl Hiaasen jedenfalls auf der Höhe seines Könnens. Mit unnachahmlicher Eleganz, die in der deutschen Übersetzung erfreulich gut erhalten blieb, breitet der Autor ein Panorama ruchloser Menschen aus, die ausnahmslos mehr oder weniger Dreck am Stecken haben. Sie alle erhalten entweder ihre Strafe, die in der Regel ziemlich grauslich, aber immer unerwartet ausfällt, oder werden vom Schicksal auf eine Weise belohnt, die dieses in jedem Fall als recht hinterlistig outet … Nicht so recht ins wüste Bild will sich nur die Figur der Produzentin Christina Marks fügen, die Hiaasen ein wenig zu ’normal‘ angelegt hat, so dass sie manches Mal wie eine Spielverderberin dasteht.
Das ändert jedoch überhaupt nichts am Lesespaß, den man sich nicht entgehen lassen sollte: Carl Hiaasen ist in diesem unseren Lande weiterhin ein Geheimtipp, was primär bedeutet, dass seine Werke zwar veröffentlicht, aber selten neu aufgelegt werden. Während jeder schimmelige Schinken aus der Anne-Perry- oder Elizabeth-George-Kammer für Junkfood-Leser zig-fach aufgewärmt wird, müssen echte Feinschmecker leider darben. Sogar „Striptease“ ist heute vergriffen, und auf ein Wiedersehen mit „A Death in China“, „Tourist Season“ oder „Double Whammy“ (1987, dt. “Miami Morde”) darf wohl erst recht nicht gehofft werden!
Anmerkung:
(1) Unsere Geschichte spielt im Jahre 1989!
Cross, Wilbur – Tragödie am Pol
Die Fakten: Im Frühjahr des Jahres 1928 macht sich das Luftschiff „Italia“ unter dem Kommando des Generals Umberto Nobile auf den Weg zum Nordpol, den es zum Nutzen der Wissenschaft sowie zum Ruhme Italiens und des faschistischen Mussolini-Regimes anfliegen soll, um dort womöglich sogar zu landen. Allen technischen Problemen zum Trotz gelingt immerhin Ersteres, doch das auch im polaren „Frühling“ unberechenbare Wetter bringt auf dem Rückflug die Katastrophe: In einem schweren Sturm stürzt die „Italia“ am 25. Mai 1928 im Niemandsland der Treibeiszone nördlich von Spitzbergen ab. Die Hälfte der Besatzung kommt um, Nobile wird schwer verletzt. Fast ohne Ausrüstung und Verpflegung sehen die Überlebenden im „Roten Zelt“ einem schrecklichen Ende entgegen, wenn es nicht gelingt, über das wundersam gerettete Funkgerät Hilfe herbei zu rufen. Der Versuch, das Festland zu Fuß zu erreichen, endet für drei Männer der Expedition in einem grausigen Desaster. Nach qualvollen Wochen werden Nobile und seine Gefährten endlich gefunden. Zahlreiche Rettungsversuche zu Wasser, zu Lande und durch die Luft scheitern oder fordern sogar neue Opfer, zu denen auch Roald Amundsen, der legendäre Bezwinger des Südpols, gehört; nur ein Flugzeug kommt durch, das den geschwächten Nobile ausfliegt. Die übrigen Männer können nach weiteren Wochen der Angst und Ungewissheit vom russischen Eisbrecher „Krassin“ geborgen werden.
Der Mythos: Umberto Nobile war ein von Stolz und Ehrgeiz zerfressener Mann, der es nicht ertrug, den Ruhm einer früheren, von Zank und Hader bestimmten, aber immerhin geglückten Luftschiff-Expedition zum Nordpol (deren Leiter ironischerweise Roald Amundsen war) teilen zu müssen. Er erzwang eine Wiederholung, dieses Mal unter eigenem Kommando, überschätzte sein Schiff und seine Fähigkeiten, brachte Tod und Verderben über seine unglücklichen Begleiter, gab im Notlager auf dem Polareis eine denkbar unglückliche Figur ab und ließ sich dort bei der ersten Gelegenheit in Sicherheit bringen, während er seine Freunde feige ihrem Schicksal überließ, vor dem sie erst ein Wunder in Gestalt der gar nicht so satanischen Sowjets retten konnte.
Die Wahrheit: Selten ist ein Mann nach Ansicht von Wilbur Cross so erfolgreich das Opfer politischer Intrigen geworden wie Umberto Nobile. Der angebliche Feigling war tatsächlich ein Mann von beträchtlichem Mut und Durchsetzungsvermögen, der nicht nur einer der fähigsten Luftschiff-Konstrukteure der Welt war, sondern dem auch das Kunststück gelang, als ausgewiesener Pazifist ein hohes militärisches Amt zu bekleiden, und sich nach 1922 – dem Jahr, in dem die Faschisten in Italien die Macht ergriffen – als ausgesprochen unbequemer Zeitgenosse erwies, der das „Italia“-Unternehmen quasi gegen den Willen Mussolinis und seiner Vasallen realisierte. Das Scheitern der „Italia“ war vor allem Pech, Nobiles Rettung eine notwendige, mit seinen Gefährten abgesprochene Aktion, die später von den Gegnern des Generals publizistisch ausgeschlachtet wurde, um diesen endgültig kaltzustellen.
Die Höllenfahrt der „Italia“ gehört zu den berühmtesten Episoden der an Sensationen nicht gerade armen Geschichte der Nordpol-Entdeckung. Der war zwar schon zwanzig Jahre zuvor über das Eis und ganz klassisch per Hundeschlitten erreicht worden, aber die Nobile-Tragödie schuf einen gar zu schönen Epilog. Ebenso klar waren die Rollen in diesem Drama verteilt: Nobile = Feigling, Amundsen = tragischer Held, Nobiles Männer = Hintergrundchor der Tapferen und Irregeleiteten, Besatzung der „Krassin“ = Personifikation des Völkerverständnisses, das sogar im freien Westen gewürdigt werden durfte, ohne dass man Gefahr lief, als Kommunisten-Knecht angeprangert zu werden.
Dabei sagen die Fakten ganz anderes aus, und sie liegen schon lange offen; tatsächlich war es niemals gelungen, sie wirklich zu unterdrücken, obwohl es Mussolinis Schwarzhemden mit aller Macht versucht hatten. In gewisser Weise sind sie erfolgreich geblieben: Die Mär vom feigen Nobile hat sich bis auf den heutigen Tag gehalten (falls sich überhaupt noch jemand an die Geschichte der „Italia“ erinnert). Eine gewisse ausgleichende Gerechtigkeit liegt freilich in der Tatsache, dass dies auch so ziemlich der einzige Triumph blieb, den die italienischen Faschisten feiern konnten.
Immerhin war dasselbe Schicksal, das ihn so viele Jahre in die Schurkenrolle drängte, gnädig genug, Nobile durch eine bemerkenswerte Lebensspanne zu entschädigen: Er starb erst 1978 im Alter von 93 Jahren, überlebte alle Feinde und erlebte noch die Genugtuung, weitgehend rehabilitiert zu werden, wobei das Pendel jedoch nicht vollständig zurückschlug oder zurückschlagen konnte: Unzweifelhaft ist – dies stellt auch Cross deutlich heraus – Nobiles Führungsschwäche, sein Beharren darauf, auch in Krisensituationen Entscheidungen zur Diskussion zu stellen, statt sie zu treffen, an sich ein liebenswerter Wesenszug, der Nobile jedoch den Weg in die Entdecker-Elite versperrte: Wahre Helden kennen keine Zweifel oder zeigen sie nicht, und sie achten vor allem sorgfältig darauf, dass sich niemand zwischen sie und die Geschichtsbücher drängt. Nobiles Konkurrent Amundsen kannte und beherzigte diese Faustregeln.
Vor allem aber stand Umberto Nobile noch der modernen Geschichtsschreibung als Zeuge zur Verfügung. Auch Wilbur Cross, der das hier vorgestellte „Italia“-Buch verfasst hat, konnte aus dieser Quelle schöpfen. Nach eigener Auskunft hat er viele Jahre recherchiert, bevor er es im Jahre 2000 endlich schrieb, und dabei nicht nur Nobile, sondern auch die meisten anderen Überlebenden des Absturzes befragt.
Wenn dies so geschehen ist, dann wundert man sich bei der Lektüre allerdings etwas darüber, dass „Tragödie am Pol“ als Sachbuch nicht wirklich eine Offenbarung ist. Echte Überraschungen bleiben aus; im Grunde wird längst Bekanntes noch einmal aufbereitet. Einzige Ausnahme scheint die Geschichte von Nobiles Niedergang als Folge faschistischer Intrigen zu sein, während auf dem Eis die historischen Korrekturen marginal bleiben. Sehr viel hat Cross wirklich nicht gemacht aus seinem Privileg, Zugang zu den Zeitzeugen und den Primärquellen erhalten zu haben.
In diesem Zusammenhang muss man wissen, dass Cross ein Profi des historischen Sachbuchs ist: Fast fünfzig hat er davon in den letzten Jahrzehnten geschrieben, was ihm nicht übermäßig viel Zeit für die Pro-Band-Recherche lässt. Das schlägt sich im Endprodukt durchaus nieder. Knapp 300 recht großzügig bedruckte Seiten sind nicht gerade üppig. Echte Schnitzer unterstreichen den Eindruck des mit der recht heißen Nadel gestrickten Werkes. So bricht Roald Amundsen Ende August 1928 zur Suche nach Nobile auf – und verschwindet nicht nur aus der Geschichte, sondern auch aus diesem Buch. Als Cross dann später beschreibt, wie Nobile und seine Gefährten nach ihrer Rettung in Skandinavien von der um ihren Helden Amundsen trauernden Bevölkerung geschnitten und beschimpft werden, ist man verwirrt: Dass Amundsen inzwischen tot und wie es dazu gekommen ist, hat Cross mit keiner Silbe erwähnt!
Deshalb ist „Tragödie am Pol“ eine zwar spannende, aber keineswegs tiefgründige Lektüre. Die deutsche Ausgabe ist angenehm lesbar übersetzt, der Mittelteil birgt eine Strecke historischer Fotos, die indes bis auf die zwar schon oft gezeigten, aber immer wieder sehenswerten Bilder aus dem „Roten Zelt“ recht beliebig wirken.
Joger, Ulrich / Kamcke, Claudia (Hgg.) – Mammut. Elefanten der Eiszeit
Vom 1. Dezember 2005 bis 18. April 2006 fand im Staatlichen Naturhistorischen Museum Braunschweig die Sonderausstellung „Mammut – Elefanten der Eiszeit“ statt, zu der das vorliegende Werk den Begleitband darstellt. Es gliedert sich in sieben Großkapitel:
1. Eine kurze Geschichte der Mammutfunde (S. 9-24): Gewaltige Knochen findet man seit jeher überall dort, wo einst die mächtigen Urzeit-Elefanten lebten. In Deutschland taten sie dies beispielsweise im Harz oder im Braunschweiger Land, wo sich seit dem 17. Jh. die moderne Wissenschaft mit ihnen beschäftigt. Sah man sie zunächst als Überreste von Unglücksrüsslern, die von der biblischen Sintflut verschlungen wurden, erkannte man sie dann als Relikte eiszeitlicher Elefanten. Seit 1800 wurden im Eis der sibirischen Dauerfrostböden immer wieder gefrorene und vollständig erhaltene Mammuts entdeckt, die es der Wissenschaft ermöglichten, über diese Wesen so viel in Erfahrung zu bringen wie über manche heutige Tierart.
2. Die Evolution des Mammuts (S. 24-32): Mammut ist längst nicht gleich Mammut. Es gab dieses Tier nicht nur langhaarig, sondern in mehreren Arten, die ihren jeweiligen Ökosystemen perfekt angepasst waren. Aufgrund der zahlreichen Funde existiert ein Elefanten-Stammbaum, der Aufschluss über die Entwicklung dieser Arten gibt.
3. Das Wollhaarmammut – ein Elefant der Eiszeit (S. 33-44): Die Untersuchungen der Knochen und Kadaver sowie der Böden, in denen sie liegen, ermöglichen es heute das Leben der Mammuts bis in Details zu rekonstruieren. Dazu gehören sogar Einblicke in das Sozialleben der gesellig lebenden Riesentiere.
4. Das Eiszeitalter – nicht nur Eis und Kälte (S. 45-56): Das Eiszeitalter stellt sich der heutigen Forschung längst nicht mehr als Folge von Gletschervorstößen und -rückzügen, sondern als komplexe Serie kurzer und rasch aufeinander folgender Kalt- und Warmzeiten dar. Nicht selten gab es in diesem Eiszeitalter Phasen, in denen das Eis sich weit zurückzog und die Durchschnittstemperaturen sogar höher als heute lagen. In diesem Kapitel werden die komplexen wissenschaftlichen Messmethoden vorgestellt, mit denen es gelang, dies festzustellen, sowie Rückschlüsse auf die zeitgenössischen Umwelt/en gezogen.
5. Die „Mammutsteppe“ – ein untergegangenes Ökosystem (S. 57-68): Die trockenen Kältesteppen, durch die das Wollhaarmammut zog, sind keineswegs identisch mit der arktischen Tundra der Jetztzeit. Stattdessen bot die „Mammutsteppe“ nicht nur den großen Pelzelefanten, sondern einer Vielzahl anderer Tiere (Nashörner, Riesenhirsche, Löwen, Hyänen usw.) eine Heimat, die sie, selbst wenn sie nicht ausgestorben wären, heute nicht mehr vorfänden.
6. Mammutjäger – Mensch und Kultur im jüngeren Eiszeitalter Europas (S. 69-92): Mensch und Mammut waren Zeitgenossen. Wie sah das Verhältnis zwischen den beiden Lebewesen dar, die auf ihre Weise den gemeinsamen Lebensraum dominierten? Der Mensch jagte das Mammut, aber wie intensiv tat er es? Ist er sogar (mit-)verantwortlich für das Aussterben dieser Elefanten? In diesem Kapitel werden neue Erkenntnisse vorgestellt, die überraschen.
7. Das Mammut in der Kunst der Eiszeitjäger (S. 93-112): Obwohl der Mensch der Eiszeit des Schreibens nicht mächtig war, gibt es Zeugnisse, die darüber informieren, wie er das Mammut sah. Er schnitzte es in Elfenbein, die Wände zahlreicher Höhlen zeigen Bilder, welche sich sogar chronologisch ordnen lassen: Das Verhältnis zwischen Mensch und Mammut unterlag zeitlichen Wandlungen, deren Kenntnis das Bild vom eiszeitlichen Leben ergänzt.
Ein Glossar (S. 113-115) informiert über die wichtigsten Fachbegriffe, ein Autorenverzeichnis (S. 116) über die am Buch beteiligten Verfasser.
Knapp und präzise informiert dieser Begleitband zu einer Braunschweiger Ausstellung rund um das Thema „Mammut“. Hier und da macht sich die Beschränkung auf eine möglichst geringe Seitenzahl – der Katalog sollte offensichtlich möglichst erschwinglich bleiben – negativ bemerkbar – dies nicht unbedingt, weil wichtige Informationen fehlen, sondern weil man als Leser mehr erfahren möchte. (An Literaturangaben herrscht indes kein Mangel, so dass dies mit ein wenig Laufarbeit möglich ist.) Diese Reaktion zeigt, dass dem Mammut in der Gunst des Menschen eine ähnliche Rolle zukommt wie den Dinosauriern: Die großen Elefanten sind zwar ausgestorben, aber wir bedauern es und möchten mehr über sie erfahren. Die Sehnsucht ist sogar so stark, dass ernsthaft über die Möglichkeit spekuliert wird, Mammuts „auferstehen“ zu lassen.
Der Mensch schätzt also das Mammut, das er im Gegensatz zu den Sauriern noch selbst kennen gelernt hat. Es ist faszinierend, wie gut sich dies dokumentieren lässt: In der Kunst des Eiszeitmenschen spielte das Mammut eine große Rolle. Er hat sich immer wieder mit diesem Tier beschäftigt, auch wenn die jeweiligen Zusammenhänge nur vermutet werden können. Noch besser: Der Mensch ist offenbar nicht verantwortlich für sein Aussterben; konkrete Untersuchungen bekannter Tierschlachtplätze widerlegen das Bild vom Speer schwingenden Eiszeitkiller, der die Mammuts herdenweise über steile Klippen in den Tod jagt.
Mit vielen Mammutmythen räumt dieses Buch wie nebenbei auf. So ist es ganz und gar nicht so, dass in Sibirien riesige Eiswürfel auf ihre Entdeckung warten, die in ihrem Inneren so perfekt konservierte Rüsseltiere bergen, dass diese quasi aufgetaut und ins Leben zurückgerufen werden können – dies zumindest über den Umweg des Klonens. Tatsächlich sehen gefrorene Mammuts keineswegs stattlich aus. Die Kadaver enthalten keine DNS, die nach heutigem Forschungsstand fürs Elefantenbasteln taugen. Außerdem unterscheiden sich Mammuts genetisch so stark von heutigen Elefanten, dass deren weibliche Exemplare als „Leihmütter“ nicht in Frage kämen. Aus der Traum vom „Pleistocene Park“ …
Die Erforschung des Mammuts ist auch als Spiegel der menschlichen Entwicklung von großer Bedeutung. Funde in unmittelbarer oder weiterer Entfernung von Mammutkadavern schließen nicht selten schmerzhafte Wissenslücken. Viele urzeitliche Artefakte sind nur deshalb bekannt geworden, weil sie der Mensch zur Jagd und zum Zerlegen der großen Elefanten eingesetzt hat. Ein Mammut speiste eine Menschengruppe über viele Wochen und lieferte Rohmaterial für Kleidung, Werkzeuge, Jagdwaffen, Schmuck. Diese Funde liefern wiederum Informationen über ihre Besitzer. So greift im Idealfall ein Zahnrad ins andere und vermittelt das Bild einer lebendigen Vergangenheit.
„Mammut“ wartet deshalb auch mit interessanten neuen Erkenntnissen über den Neandertaler auf. Schon länger wird vermutet, dass es sich bei diesem keineswegs um einen ungehobelten Steinzeitklotz handelte. Der Neandertaler war eine zweite Menschenart, die sich von seinem jüngeren Zeitgenossen, dem heute allein überlebenden Cro-Magnon-Menschen, anatomisch und genetisch recht deutlich unterschied, ohne deshalb jedoch „primitiver“ oder „dümmer“ gewesen zu sein. Neandertaler konnten offenbar sehr wohl sprechen und sie existierten deutlich länger als bisher gedacht, ohne sich mit den „moderneren“ Nachbarn zu bekriegen.
So muss ein Buch aussehen, das neugierig macht auf Wissen – und noch mehr Wissen! Deshalb lässt sich das recht biedere Layout – beispielsweise sehen manche Karten wie mit dem Buntstift gezeichnet aus – leicht verschmerzen. Hier übertrifft der Inhalt die Verpackung – eine angenehme Abwechslung zumal in einer Sachbuchwelt, die sich heute gar zu gern der „Galileo: Halbwissen spannend gemacht“-Schule des Privatfernsehens anpasst.
Caleb Carr – Das Blut der Schande
Irgendwann in den späten Tages des 19. Jahrhunderts – ein exaktes Datum verschweigt uns der Verfasser, aber den Hund der Baskervilles deckt bereits der kühle Rasen – tritt Mycroft, der ältere Bruder des berühmten Privatermittlers Sherlock Holmes, mit einem Spezialauftrag an diesen heran: In Holyroodhouse, dem Sommerlandsitz der britischen Königin Victoria, sind zwei Männer auf grausige Weise zu Tode gekommen: Man fand ihre Leichen von unzähligen Klingenstichen durchbohrt; jeder Knochen im Leib war zerbrochen.
Mycroft, welcher der Regierung als ‚Berater‘ nahe steht, wähnt schottische Anarchisten oder sogar deutsche Spione am Werk. Diskret soll die peinliche Affäre aufgeklärt werden. Sherlock freut sich, denn zur Sorge seines treuen Gefährten Dr. Watson hegt der sonst so rational denkende Detektiv seit einiger Zeit merkwürdige Theorien, die um die Existenz jenseitiger Welten kreisen. Holyroodhouse war vor drei Jahrhundert Schauplatz eines düsteren Ereignisses: Vor den Augen einer entsetzten Königin Maria Stuart ermordeten schottische Adlige ihren italienischen Sekretär und Vertrauten. Seither soll der Geist dieses David Rizzio im Westturm von Holyrood umgehen und rachedurstig die Unvorsichtigen packen, die ihm zu nahe kommen. Caleb Carr – Das Blut der Schande weiterlesen
Cheyney, Peter – Rote Lippen – blaue Bohnen
Zwei hochrangige Physiker sind spurlos verschwunden. In der mexikanischen Sierra Leone sollten sie zum Nutzen des freien Westens atomare Überraschungen für die heimtückischen Sowjetroten testen. J. Edgar Hoover, Leiter des FBI, entsandte den Agenten Pepper über die Grenze. Er sollte sich dort unauffällig umhören – und ging ebenfalls verloren.
Auftritt Lemuel H. „Lemmy“ Caution, FBI-Mann der draufgängerischen Sorte, der selten im Büro sitzt, sondern lieber durch die Welt gaukelt und die Bösen das Fürchten lehrt, wobei manche Flasche Whiskey und noch mehr schöne Frauen seinen Weg säumen. Inkognito reist Caution Pepper hinterher, dessen Leiche er in einem einsamen Wüstengrab findet. Auch Lemmy bekommt es sofort mit jenen dunklen Mächten zu tun, die weitere Nachforschungen und ihn im Keim ersticken wollen. Unter seinen Gegnern findet er erstaunt den Schläger Jack Hotshot, genannt „Spiegelei“, der für den Mafiaboss Mike Koltisow in Chicago die Drecksarbeit erledigt.
Aber auch dieser sitzt noch längst nicht am Ende der Fahnenstange: Dort lauern die finsteren Sowjets, die gern viel Geld für die brisanten Dokumente zahlen würden. Diese müssen ihnen – die verdrehte Dramaturgie dieser Räuberpistole will es so – in Frankreich übergeben werden. Also macht sich Lemmy auf den Weg ins alte Europa, zumal sich im Schlepptau der Gangster die schöne Georgette befindet, die es zu retten gilt. Bloß: Ist sie Opfer – oder steckt sie gar hinter den Ereignissen, die in Paris ins Rollen kommen, Lemmys Pläne gründlich durcheinander bringen und in einem furiosen Finale auf dem offenen Atlantik münden …?
Nein, der Plot ist es wirklich nicht, der den Krimifreund hier fesseln könnte. Autor Cheyney macht freilich nie einen Hehl daraus, dass er die dünne Handlung nur als Vorwand für ein turbulentes Garn betrachtet, das primär durch Schlägereien und schwitzige Techtelmechtel mit willigem Weibsvolk geprägt wird, wobei die einen mit den anderen abwechseln.
Ernst zu nehmen ist hier nichts. Physiker wurden entführt? Es könnten auch Marsmenschen sein. Der Plot ist ein Hitchcockscher „McGuffin“, d. h. eine von den Lesern verlangte Notwendigkeit, die der Handlung ein Fundament verschaffen soll. Peter Cheyney, der wie Edgar Wallace stets mit zahllosen Gläubigern auf den Fersen schrieb, kümmerte sich wenig um die Schlüssigkeit seiner Geschichten. Er erzählte sie schnell und ohne sich Gedanken über die Logik zu machen. Viel mechanisches Schreibhandwerk wird allzu offenbar, wenn sich Lemmy wieder und wieder auf offensichtlich kriminelle Frauen einlässt und Schurken vertrimmt.
Trotzdem geht die Rechnung auf: „Rote Lippen – blaue Bohnen“ unterhält. Cheyney macht Tempo, jagt Lemmy Caution kreuz & quer durch Mittel- und Nordamerika. Dass er von den realen Verhältnissen auf beiden Kontinenten nur rudimentäre Kenntnisse besitzt, ist eigentlich unwichtig. Heute gilt dies mehr denn je; Lemmy prügelt und liebt sich durch diverse Märchenländer, über die zu lesen nostalgisches Vergnügen (mit gewissen Einschränkungen – s. u.) bereitet.
Wer heute an Lemmy Caution denkt, vor dessen geistigem Auge entsteht sofort die narbige, dauergrinsende Visage des Schauspielers Eddie Constantine, der mit dieser Figur nicht nur die Rolle seines Lebens fand, sondern ihr vor allem eine Gestalt verlieh, die sie angenehm vom literarischen Vorbild unterschied.
Lemmy Caution à la Peter Cheyney ist eine Figur, über welche die Zeit längst hinweggegangen ist. Einst war er der Held für kleine und große Jungs – ein Kriminalist, der jeglicher bürokratischer Vorschriften und alltäglicher Langeweile enthoben war, und stattdessen durch die ganze Welt zog, um dort allerlei Gangsterpack zu jagen. Stets hat dieser Lemmy einen coolen Spruch auf und eine Flasche Whiskey an den Lippen. („Ich muss selbst auf mich aufpassen, denn mein FBI-Ausweis ist hier für mich genausoviel wert wie ein Erdbeereis für einen Eskimo mit doppelseitiger Lungenentzündung.“) Schöne Frauen ziehen ihn an wie das Licht die Motte; auf die weibliche Gegenseite wirkt die Anziehungskraft sogar noch stärker.
Diese Damen heißen hier Fernanda oder Zellara aber ihre Namen sind unwichtig: Cheyney-Frauen sind austauschbar schön aber heimtückisch. Sie schmelzen wie Butter in der Sonne, sobald Lemmy auf der Bildfläche erscheint, doch den freigiebig (wenn auch zeitgebunden züchtig) dargebotenen Reizen ist meist nicht zu trauen. Dame und Herr tauschen andeutungsreiche Anzüglichkeiten aus, denen aber niemals bettschwere Taten folgen.
Caution kämpft gegen Verbrecher, die mit der Realität rein gar nichts verbindet. Raue Kerls sind das, denen ihr Job ins hässliche Gesicht geprägt steht. Sie reden und handeln so, wie sich der fleißige Kinosesseldrücker das einst vorstellte. Bei aller Brutalität sind sie ziemlich dumm, so dass sich Caution mit flinken Fäusten & flotten Sprüchen aus jeder Todesfalle winden kann.
Das geht in Ordnung so, denn Cheyney-Thriller sind unter kriminalliterarischen Gesichtspunkten fröhlicher Unsinn, der einfach nur unterhalten soll. Allerdings war der echte Peter Cheyney, der sich gern als kosmopolitischer Lebemann gab, nach Aussagen seiner Zeitgenossen kein durchweg angenehmer Mensch. So soll er ausgesprochen rassistisch gewesen sein. Nach der Lektüre von „Rote Lippen – blaue Bohnen“ will oder muss man das gern glauben. Die Geschichte spielt in Mexiko, dessen Bürger der Verfasser entweder herablassend – Lemmy duzt sie alle, während er selbstverständlich gesiezt wird – oder offen als „Menschen minderer Klasse“ behandelt werden:
– „Sie setzen sich hin, greifen nach ihren Gitarren und gucken verdutzt aus der Wäsche, wie das die Mexikaner immer tun, wenn sie merken, dass sie arbeiten müssen.“ (S. 9)
– „Ich stelle fest, dass sie für eine Mexikanerin einen verteufelt hübschen Mund hat. Sie hat nicht solch dicke Lippen wie die meisten Frauen hier unten …“ (S. 11)
– „Er hat den Mund voll Gold wie jene naiv-protzigen Südamerikaner, die damit zeigen wollen, dass sie die Taschen voll Geld haben.“ (S. 109)
Dies sind willkürlich herausgegriffene Beispiele. Die traurige Liste lässt sich leicht verlängern. Für Caution = Cheyney sind alle (männlichen) Mexikaner faule, verlogene, geldgierige, korrupte Gockel, die man ordentlich züchtigen muss. Die Frauen sind hitzig und allzu freizügig, so dass ein (weißer) Mann, der auf sich hält, es tunlichst vermeidet, sich in amouröse Niederungen zu begeben. Dass solche Niederträchtigkeiten quasi wie nebenbei und in Nebensätzen geäußert werden, zeigt, dass sie vom Verfasser so beabsichtigt sind.
Die deutsche Übersetzung versucht den Verfasser offenbar noch zu übertrumpfen. „Don’t Get Me Wrong“ wurde 1939 veröffentlicht, „Rote Lippen – blaue Bohnen“ indes erst 1954, als die Lemmy-Caution-Filme auch die deutschen Zuschauer in die Kinos lockten. Die Handlung wurde „aktualisiert“: Plötzlich lesen wir von Lemmys Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg, der zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung gerade erst begonnen hatte. Es fällt ohne Blick in den Originaltext schwer zu beurteilen, ob sich der Plot auch ursprünglich um Atomspionage mit sowjetischen Drahtziehern drehte. Sowjets gab es auch 1939 schon, aber die gesamte Kalter-Krieg-Szenerie muss dem Roman nachträglich aufgepfropft worden sein – samt hysterischer Hasstiraden gegen die roten Teufel, die Lemmy am liebsten über den Haufen schießen will.
|“Rote Lippen – blaue Bohnen“ – der Film|
Eddie Constantine spielte die Lemmy-Caution-Figur mit der nötigen Dosis Selbstironie, welche zum operettenhaften Geschehen passt, was ihr bei Cheyney völlig abgeht. Constantines Caution ist ein sympathischer, großer, nie erwachsen gewordener, kalauernder Junge, der weder sich noch die absurden „Kriminalfälle“ ernst nimmt, in die er ständig verwickelt wird. Diese Unbekümmertheit floss in die rasant gemachten B-Movies der 1950er Jahre ein, die Constantine, ein US-Amerikaner in Frankreich, wie am Fließband drehte. „Rote Lippen – blaue Bohnen“ („Vous Pigez?“/“Il Maggioratio Fisico“), eine französisch-italienische Coproduktion, entstand 1955 unter der Regie von Pierre Chevalier. Vor und hinter der Kamera tummelten sich filmerfahrene Leute, so dass dieses vierte Filmabenteuer von Lemmy Caution trotz der dicken Staubschicht, die sich auf diesen Streifen gelegt hat, auch heute noch anschaubar ist. (Hier dreht sich die Story übrigens nicht um geheime Sprengstoffe, sondern um die Herstellung künstlicher Diamanten – ein weiterer Hinweis auf die Nebensächlichkeit von Logik.)
Reginald Evelyn Peter Southouse Cheyney wurde am 22. Februar 1896 in London, Stadtteil Whitechapel, als jüngstes von fünf Kindern geboren. Rechtsanwalt sollte er werden, doch wie so viele seiner Altersgenossen musste er in den I. Weltkrieg einrücken, wo er es bis zum Lieutenant brachte. Der junge Mann versuchte nach seiner Entlassung im Showbusiness Fuß zu fassen. Jahre der Armut folgten, in denen Cheyney kleine Theaterrollen ergatterte, Sketche und Lieder schrieb. In der zweiten Hälfte der 1920er Jahre verzeichnete Cheyney endlich Erfolg als Ghostwriter, der unter dem Namen eines ehemaligen Polizisten „wahre Kriminalgeschichten“ verfasste. Er gründete eine Literaturagentur, die gleichzeitig Detektei war.
1936 versuchte sich Cheyney als Schriftsteller unter eigenem Namen. „This Man is Dangerous“, der erste Roman einer Serie um den FBI-Agenten Lemmy Caution, wurde sogleich ein großer Erfolg. Auch mit Slim Callaghan, einem britischen Privatdetektiv, traf Cheyney ins Schwarze. In den nächsten 15 Jahren verfasste er mindestens zwei Romane pro Jahr. Hinzu kamen unzählige Kurzgeschichten, die sich derselben Mixtur aus Sex & Crime bedienten wie später u. a. Ian Fleming (James Bond) oder Mickey Spillane (Mike Hammer).
Peter Cheyney ließ die Kerze seines Lebens an beiden Enden kräftig brennen. Schon in den späten 1940er Jahren begann der Raubbau, den er mit seinen Kräften trieb, seine Folgen zu zeigen, ohne indes seine Produktivität zu beeinträchtigen. Am 26. Juni 1951 ist Cheyney im Alter von nur 55 Jahren gestorben.
Den eigentlichen Erfolg seiner Werke erlebte Cheyney nicht mehr. Besonders in Frankreich erfreuten sich seine unbekümmert harten, anspruchslosen Geschichten großer Wertschätzung. Zwei Jahre nach seinem Tod entstand mit „La mome vert-de-gris“ (dt. „Im Banne des blonden Satans“) der erster einer langen Reihe von Lemmy-Caution-Streifen, die den aus Los Angeles stammenden, in den USA erfolglosen Schauspieler Eddie Constantine (1917-1993) zum europäischen Film- und Kultstar machten. Auch in Deutschland liefen diese rabaukig charmanten B-Movies viele Jahre erfolgreich in den Kinos und später im Fernsehen. Primär kamen die deutschen Leser in den Genuss der Cheyney-Romane um Caution und Callaghan, während das sonstige Werk nur sporadisch Aufmerksamkeit gewann. Seit den 1980er Jahren werden die lange nachgedruckten Romane nicht mehr aufgelegt.
Die Lemmy-Caution-Serie:
01. This Man is Dangerous (1936, dt. „Eine Dame stiehlt man nicht/Dieser Mann ist gefährlich“)
02. Poison Ivy (1937; dt. „Hiebe auf den ersten Blick“)
03. Dames Don’t Care (1937; dt. „Schwierige Damen/Serenade für zwei Pistolen“)
04. Can Ladies Kill? (1938, dt. „Frauen sind keine Engel/Lemmy schießt nicht auf Blondinen“)
05. Don’t Get Me Wrong (1939, dt. „Rote Lippen – blaue Bohnen“)
06. You’d Be Surprised (1940; dt. „Auf Befehl der FBI“)
07. Your Deal, My Lovely (1941; dt. „1 : 0 für Lemmy“)
08. Never a Dull Moment (1942; „Im Bann der grünen Augen/Lemmy lässt die Puppen tanzen“)
09. You Can Always Duck (1942; dt. „Gut versteckt ist halb gewonnen“)
10. I’ll Say She Does (1945; dt. „Die Geheimakten/Wer Lemmy eine Grube gräbt“)
James P. Blaylock – Brunnenkinder
Placentia, ein kleiner Flecken unweit der südkalifornischen Küste, im Jahre 1884: Hale Appleton, geistiger Führer eines obskuren spiritistischen Kultes, ertränkt seine kleine, kranke Tochter in einem der Brunnen. Er ist davon überzeugt, dass sich die letzten Gedanken des sterbenden Kindes als gläserne Kugel manifestieren werden, mit deren Hilfe er das Kind sogar ins Leben zurückrufen kann.
Tatsächlich findet sich im Opferbrunnen eine solche Kugel, doch sie wird Appleton vom zwielichtigen Alejandro Solas gestohlen, der damit ein lukratives Geschäft plant. Der gutherzige Lehrer Colin O=Brian erfährt von der Schandtat und entwendet seinerseits die Kugel, um sie dem Dorfpfarrer zu bringen, der wissen wird, wie damit zu verfahren ist. Unterstützt wird er von den Freundinnen May und Jeanette. Doch das Trio verhält sich recht ungeschickt. Bald ist ihm der gefährliche Solas auf die Schliche gekommen; ihm folgt der vor Kummer irrsinnig gewordene Appleton. Über dem Brunnen kommt es zum großen Finalkampf aller Beteiligten. Als sie dabei ins Wasser stürzen, entpuppt sich dieser als Tunnel durch die Zeit, der die Geister der fünf Menschen in der Zukunft verstreut … James P. Blaylock – Brunnenkinder weiterlesen