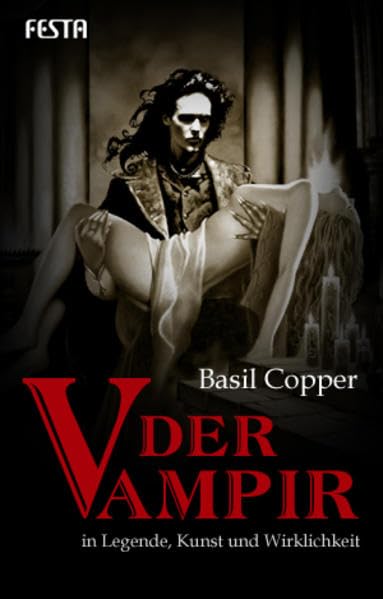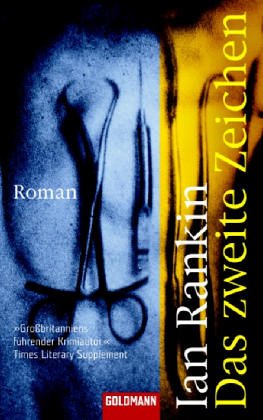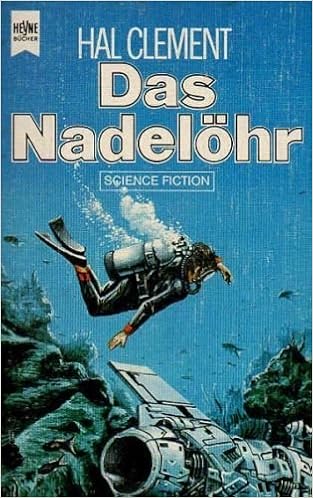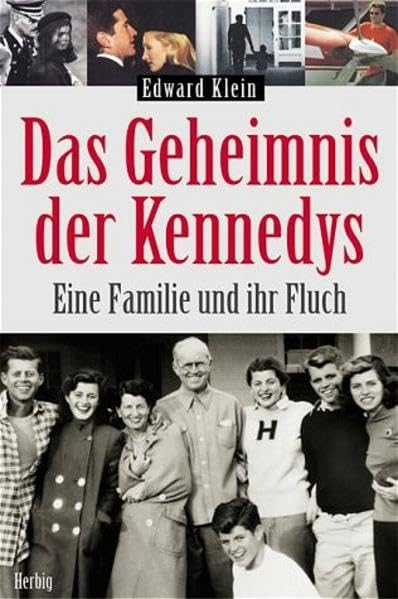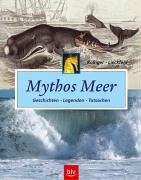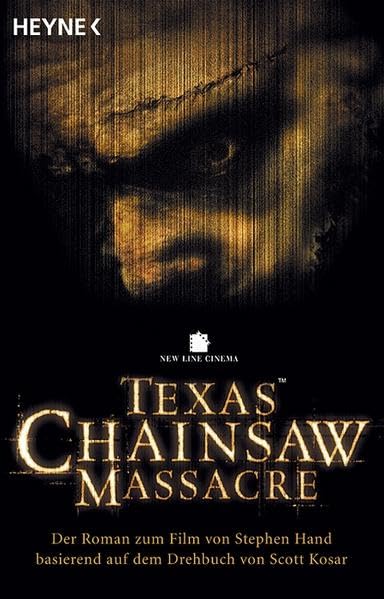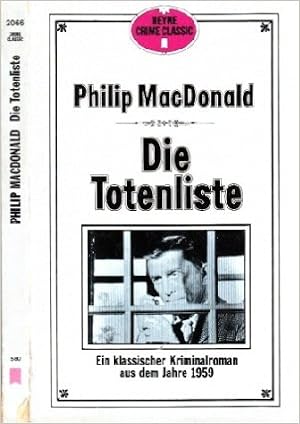Die coolen Crooner sind wieder da; Steven Soderbergh ließ im Kino mit „Ocean’s Eleven“ & „Ocean’s Twelve“ das „Ratten-Pack“ aus dem Las Vegas der 50er und 60er Jahre neu erstehen, und Robby Williams (der arme Tropf) hält sich für die Inkarnation von Frank Sinatra. Da kann es nicht ausbleiben, dass auch das Interesse am vielleicht rätselhaftesten Bombast-Schmalzer des 20. Jahrhunderts neu erwacht: Dino Crocetti alias Dean Martin (1917-1995), Sänger, Schauspieler, TV-Star, Spieler, Schwerenöter und Trinker, Macho und Mimose – die lebende Parodie auf den Amerikanischen Traum, Idol für Millionen und eine menschliche Sphinx, deren Mysterien – falls es denn welche gab – weder die engsten Freunde noch die eigene Familie je zu lösen vermochten.
Nick Tosches unternahm den bisher wohl ambitioniertesten Versuch, dieser mysteriösen Persönlichkeit auf die Spur zu kommen. Schon 1992, also noch zu Lebzeiten Martins, begann er zu recherchieren. Martin selbst verweigerte Tosches wie noch jedem Biografen jegliche Zusammenarbeit; wie dieser später entdeckte, war es dazu ohnehin zu spät: Zu den vielen Tragödien, die Dean Martin in seinem Leben trafen, ist die Demenz der letzten Jahre wohl die schrecklichste. Sterben würde er schließlich an Lungenkrebs, und nur dieser Kampf fand seinen Niederschlag in der Presse. Dass der große Dean Martin da schon nicht mehr wusste, wer er war, blieb weitgehend unerwähnt – ein ungewöhnliches Zugeständnis der Medien, das Tosches dezent aber deutlich enthüllt.
Ansonsten hält Tosches nichts von falscher Heldenverehrung. „Dino“ zeichnet das keineswegs schmeichelhafte Bild eines mit vielen Talenten gesegneten, aber nicht gerade liebenswerten, weil verschlossenen und egoistischen, an den Dingen um ihn herum sträflich uninteressierten Mannes, der sogar eine recht ausgeprägte dunkle Seite besaß. Wie wir jedoch erfahren, war der Einsatz der Ellenbogen unverzichtbar für einen Mann, dem der Erfolg als Künstler kaum in die Wiege gelegt wurde. Tosches hat fabelhafte Kärrnerarbeit geleistet und Martins frühe Jahre in der Industriestadt Steubenville, Ohio, akribisch nachgezeichnet. Der spätere Superstar stammte aus einfachen Verhältnissen. Daraus hat er nie ein Geheimnis gemacht oder sich gar dessen geschämt, aber er hat auch nur wenige Worte darüber verloren. Tosches hatte das Glück des Tüchtigen: Er fand zahlreiche Zeitgenossen, die Aufschlussreiches über Dean Martins frühe Jahre zu erzählen wussten. Sogar die europäischen Ursprünge der italienischen Einwandererfamilie Crocetti in den kargen Abruzzen konnte er offen legen.
Nie beschränkt sich Tosches auf die simple Nacherzählung von Fakten. Er fügt sie stets in den historischen Kontext ein. So erleben wir die Crocettis nicht als singuläre Reisende ins Gelobte Land Amerika, sondern als Körnchen in dem Strom, der sich im späten 19. Jahrhundert aus Europa über den Atlantik gen Westen ergießt. Dass Dean Martins Leben so verlief, wie es quasi verlaufen musste, ist eine Folge von Ereignissen, die auf den ersten Blick mit ihm als Person gar nichts zu tun haben. Tosches Verdienst ist es, die unterschwelligen Verbindungen erkannt und aufgedeckt zu haben. Das betrifft Martins tiefe Verwurzelung in der italienischen Kultur seiner Vorfahren, die ihn stärker prägte als bisher bekannt war. Integraler Bestandteil dieser Kultur waren aber auch Martins Verbindungen zum organisierten Verbrechen, die natürlich das Interesse des heutigen Lesers ganz besonders erregen. Während sein Kumpel Frank Sinatra entsprechenden Nachforschungen zeitlebens mit einen Stall gut dotierter und angriffslustiger Juristen begegnete, legte Martin Tosches keine Steine in den Weg. So recherchierte der Verfasser praktisch ungehindert und rekonstruierte mit bisher nicht gekannter Eindringlichkeit die Rolle der Mafia in der Unterhaltungsindustrie der USA.
Dean Martins Kontakte zum organisierten Verbrechen gingen schon auf seine Jugendjahre in Steubenville zurück, das sich in Tosches Rückschau als wahres Mekka der Kriminalität entpuppt. Wie wenig Martin mit dem daueralkoholisierten Bruder Leichtfuß gemein hatte, den er später so erfolgreich seinem Publikum vorgaukelte, lässt sich schon daraus folgern, dass er zwar mit den Gangstern von Steubenville gut Freund war, aber niemals mit dem Gesetz in Konflikt kam: Dino Crocetti wusste stets sehr genau, was gut für Dean Martin war; während seine Jugendfreunde ihr Leben als arme Schlucker beschlossen, die sich wehmütig daran erinnerten, wie sie ihre Tage einst mit infantilen Großmannsträumen vertaten, starb ihr Kumpel zwar unglücklich, aber immerhin reich.
„Dino“ ist ein mit Fakten, Geschichten und Anekdoten überreich gefülltes Horn, das über die gesamte Distanz von immerhin 700 Seiten jederzeit unterhält. Das heißt nicht, dass es nichts zu bemängeln gäbe. So kommt auffällig oft dem Biografen Tosches, der virtuos die Vergangenheit wieder aufleben lässt, der Schriftsteller Tosches – dem wir mit „Trinities“ (1994, dt. „Die Meister des Bösen“) einen der besten zeitgenössischen Romane um die Mafia überhaupt verdanken – in die Quere. Letzterer kann einfach nicht widerstehen, Wissen durch Fantasie zu ersetzen. Es lässt sich nun einmal nicht leugnen, dass es auch dem unermüdlichen Tosches misslungen ist, den emotionalen Panzer Dean Martins zu „knacken“. Das ist jedoch kein Freibrief dafür, die Lücken mit hypothetischen Selbstreflexionen eines imaginären Dino Crocetti zu füllen – ganz besonders dann, wenn der Verfasser mehr als einmal anklingen lässt, dass dieser zur Selbstreflexion womöglich gar nicht fähig war. Aber Martin/Crocetti muss einfach Tosches‘ Vorstellungen eines von dämonischen Begierden tragisch Getriebenen und schließlich Gescheiterten erfüllen; das sind die Menschen, die ihn interessieren und von denen er meint zu wissen, wie sie funktionieren. Wir finden diese für Tosches typischen, literarisch eindrucksvollen, aber sachlich fragwürdigen Sentenzen auch in seinen Biografien über den Musiker Jerry Lee Lewis oder den Boxer Sonny Liston; „Hellfire“ bzw. „Der Teufel und Sonny Liston“ heißt es da dräuend und verheißungsvoll schon im Titel – Theaterdonner und faule Tricks für die Armen im Geiste.
In dieselbe Kerbe schlägt Tosches, wenn er hier und da der Verlockung erliegt, die Vergangenheit so zu inszenieren, dass sie seinem pessimistischen Weltbild entspricht. Dabei stören weniger die unverhohlenen Wertungen – er verabscheut sichtlich aus tiefem Herzen die Kennedys oder macht sich über Frank Sinatra und Ronald Reagan lustig -, denn sie lassen sich als |vox toschesi| vom Leser klar erkennen. Schwieriger fällt dies, wenn der Verfasser seinem Hang nachgibt, die Trivialisierung der US-Gesellschaft und -Kultur seit dem II. Weltkrieg zu geißeln. Tosches gilt als Kritiker des American Way of Live – und zwar als ebenso wortgewaltiger wie guter, was ihn besonders der Intelligentia Europas zum Lieblingskind werden ließ. Aber er hat halt auch einen Hang zum Prediger und redet gern in Zungen; machtvoll und ungedämmt fließt der Strom seiner Worte, wenn es gilt, die Boheme und Künstlerszene der Prohibitionszeit oder den Wahnsinn Las Vegas zu beschwören. Schwere Jungs und leichte Mädchen, Sex & Schnaps & nein, noch nicht Rock ’n‘ Roll, aber Schlagerschmalz rund um die Uhr, gutes Geld und schlechter Geschmack, das Leben ein pausen- und bedeutungsloser Rausch von Erfolg und Ruhm – ohne es zu merken, reiht der Verfasser Klischee an Klischee. Schlimm ist das in fader Rührseligkeit versickernde Finale, aber noch deutlicher verraten ihn die Fußnoten (Tosches liebt Abschweifungen): Das rührselige, erstaunlich distanzlos vorgetragene Klagelied von Marilyn Monroe, dem armen, kleinen, von den Männern/den Kennedys/der Mafia/dem FBI/den Außerirdischen verratenen & verkauften Mädchen, hat man z. B. ein wenig zu oft gehört, um es noch hören oder gar ernst nehmen zu können.
Der Schaden hält sich indes in Grenzen, weil Tosches immer wieder rasch auf den Boden der Tatsachen zurückfindet. Dort leistet er Großes, bringt völlig Neues ans Tageslicht oder entlarvt alte, lieb gewonnene Legenden. Darin ist Tosches ein wahrer Meister. Ob Jerry Lewis, Dean Martins Partner der frühen, turbulenten Jahre, wohl ahnte, wie ihm geschehen würde, als er seinem Gesprächspartner Rede und Antwort stand? Tosches hörte ihm und seinen vielen anderen Gesprächspartnern sehr genau zu – und überprüfte wie jeder wirkliche gute Biograf oder Historiker das Notierte mit Hilfe anderer Quellen. Dabei ergaben sich viel sagenden Diskrepanzen; man liest es mit Vergnügen (und Schadenfreude) und lernt viel darüber, wie Stars „gemacht“ werden.
Bleibt abschließend die Frage, ob denn die zehnjährige Differenz zwischen Original und Übersetzung dem Werk nicht Schaden zufügt. Die Antwort ist nein; ohne das eingangs erwähnte Crooner-Revival wäre dem deutschen Leser dieses bei allen Fehlern fabelhafte Werk sicherlich gänzlich vorenthalten geblieben. Außerdem gibt es Martins Leben nach 1992 rein gar nichts mehr hinzuzufügen; da reicht tatsächlich ein lakonisch dem Anhang eingeflickter Hinweis: „Dean Martin starb am 25. Dezember 1995“. Wie wir nun wissen, war er da eigentlich schon mindestens zehn Jahre tot.