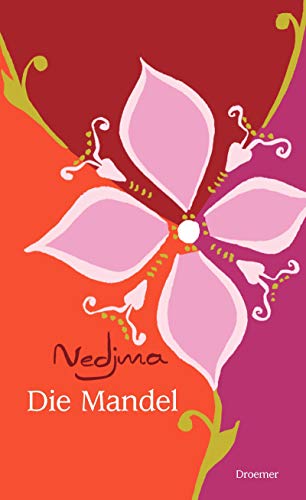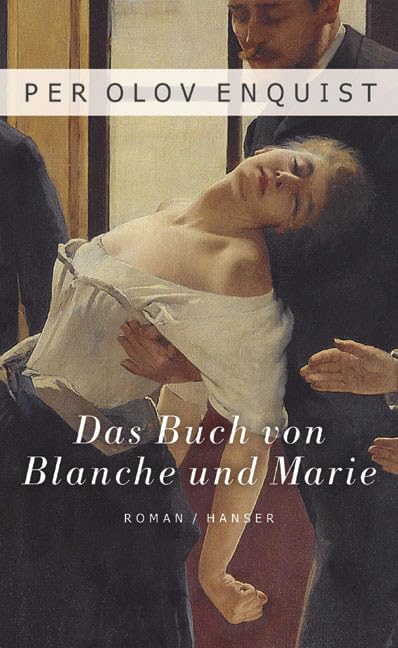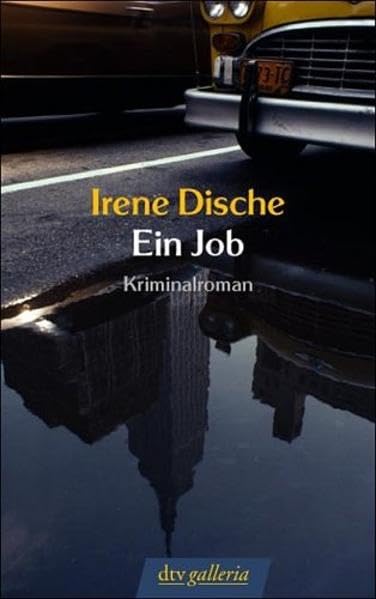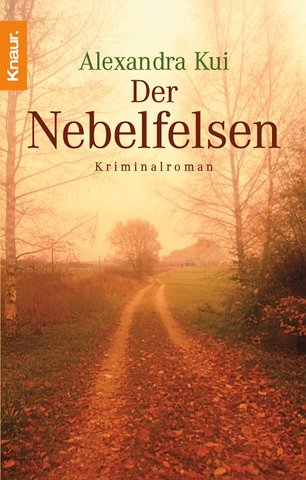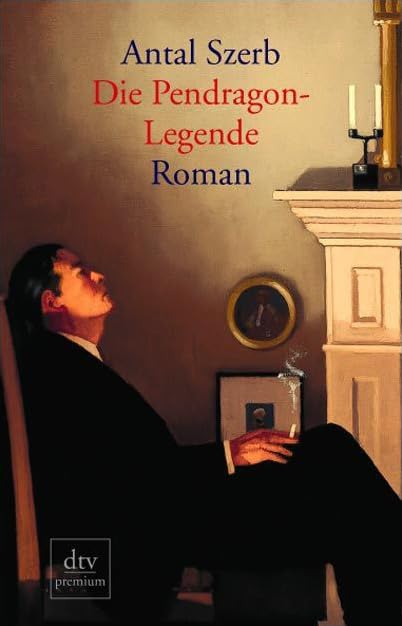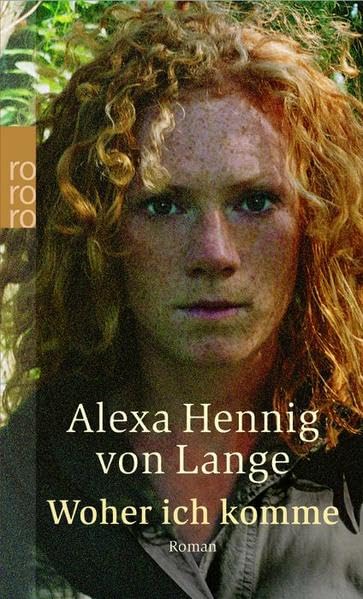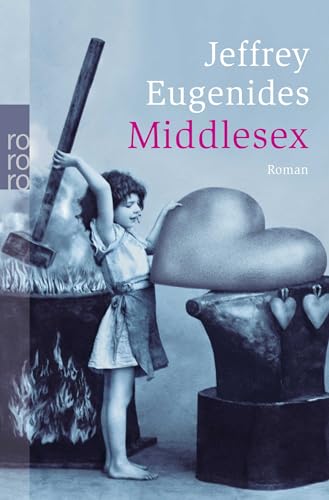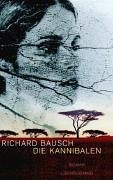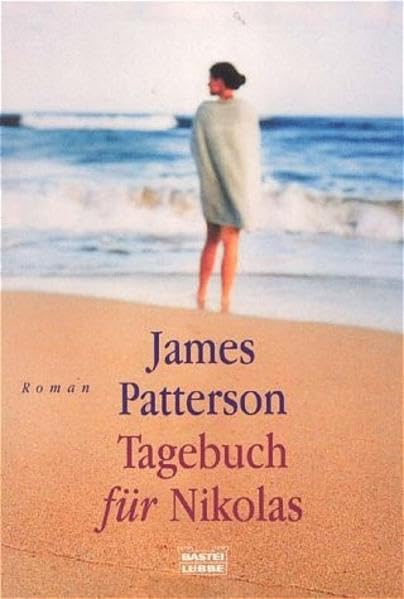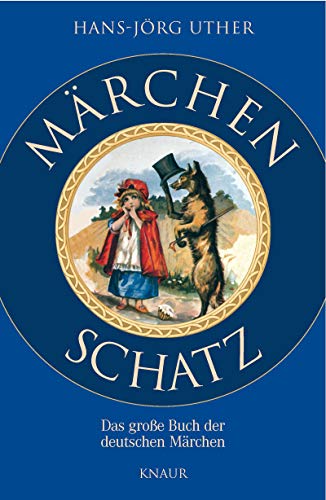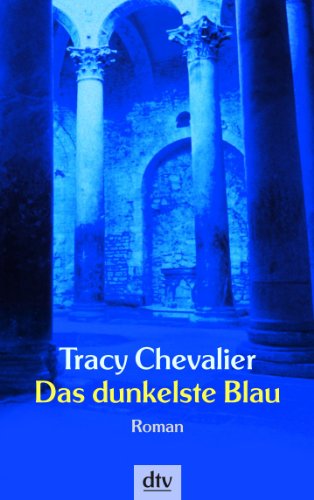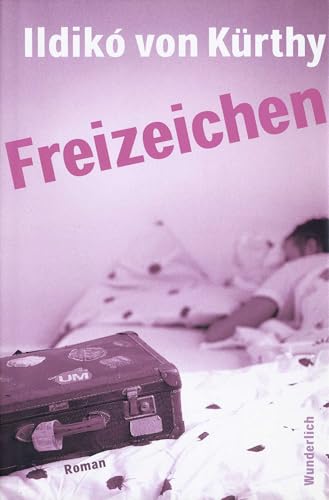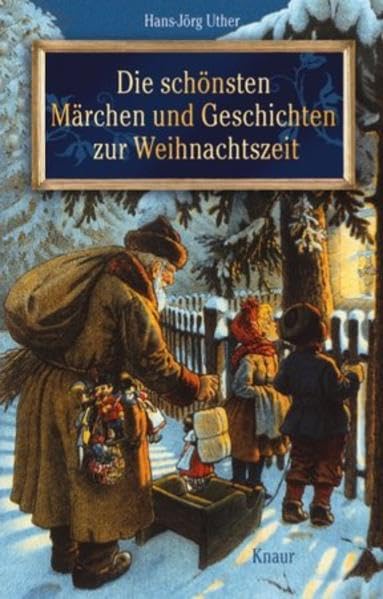Laut Verlag handelt es sich bei der Autorin um eine Araberin Anfang bis Mitte vierzig, die unter dem Pseudonym „Nedjma“ ihre Lebensgeschichte veröffentlicht. In Frankreich stand das Buch lange Zeit auf den Bestsellerlisten und das wohl aus einem guten Grund, denn Sex verkauft sich natürlich immer hervorragend. Nach der Lektüre des Buches kommen dem nachdenklichen Leser einige begründete Zweifel an der wahren Identität der Autorin, denn bereits das angebliche Alter stimmt nicht mit der im Buch erzählten Geschichte überein. Doch interessiert das wirklich? Wird dieser Roman spektakulärer durch ein wahres Schicksal? Oder ist er als erdachte Erzählung nicht ebenso lesenswert? Ich persönlich glaube nicht an die Wahrheit der erzählten Geschichte und habe das Buch dennoch gern gelesen …
_Badras Geschichte_
Badra ist erst siebzehn Jahre jung, als sie den wesentlich älteren Hmed heiraten muss. Wie die Tradition es haben möchte, wird vor der Hochzeit ihre Jungfräulichkeit überprüft, damit ihr zugedachter Ehemann sie in der Hochzeitsnacht entjungfern kann. Doch bereits die erste Nacht zwischen Badra und Hmed wird für die junge Frau zur Qual. Ihr Ehemann ist bereits zum dritten Mal verheiratet, da seine ersten beiden Frauen ihm keine Kinder hatten schenken können. Schon in der Hochzeitsnacht müssen Badras Schwester und Schwiegermutter hinzukommen, um sie festzuhalten, da Badra sich vor dem Geschlechtsverkehr sträubt. Jede Nacht stirbt Badra ein wenig mehr, wenn ihr Ehemann emotionslos über sie hinwegsteigt und seinen eigenen Orgasmus als einziges Ziel sieht.
Nur drei Jahre lang hält Badra es bei Hmed aus, ihre eigene und glücklich verheiratete Schwester ist es schließlich, die ihr zur Flucht nach Tanger zu ihrer Tante Selma verhilft. Ihrer Tante erzählt Badra von den Qualen ihrer Ehe, um ihr zu verstehen zu geben, dass sie nicht zu Hmed zurückkehren kann. Bald lernt Badra den angesehenen Arzt Driss kennen und lieben. Er ist es schließlich, der ihr bei der Erfüllung ihrer geheimsten sexuellen Wünsche hilft. Mit ihm erlebt sie über Jahre hinweg scheinbar das sexuelle Glück in Vollendung, doch muss Badra sich schließlich eingestehen, dass sie ihrem Liebhaber hörig ist. Obwohl es sie unendlich quält, dass er neben ihr auch mit anderen Frauen und Männern schläft, kann sie sich nicht von Driss trennen.
_Klartext reden_
Bereits in einem kurzen Vorwort macht Badra deutlich, worum es ihr in diesem Buch geht, denn sie möchte ihre eigene Lebensgeschichte aufschreiben und von ihrer sexuellen Befreiung berichten. Sie ist überzeugt davon, das allerschönste Geschlecht überhaupt zu besitzen, das sie einzusetzen weiß und dies auch tut. Die Autorin nimmt kein Blatt vor den Mund, um von ihren intimsten Erlebnissen zu berichten, das zeigt schon die kurze Leseprobe aus dem Vorwort:
S. 10: |“Ich, Badra, verkünde, mir nur einer Sache sicher zu sein: Dass ich das schönste Geschlecht der Welt habe; es hat die schönste Form von allen; es ist prall, heiß, feucht, duftend und singt wie kein anderes; und es ist unübertrefflich in seinem Verlangen nach harpunengleich sich reckenden Schwänzen.“|
In abgeklärten Worten schildert Badra von ihrer gescheiterten Ehe mit Hmed und den seelischen Qualen, die sie dort erleiden musste. Als die Ehe kinderlos bleibt, muss sie zudem merkwürdige Rituale vollführen, um die Fruchtbarkeit anzulocken, doch selbstverständlich scheitern all diese Versuche. Fast bekommt der Leser den Eindruck, dass Badra eine mögliche Schwangerschaft durch bloßen Widerwillen ihrem Mann gegenüber verhindern konnte.
Wenn Badra von ihren Erlebnissen mit Hmed berichtet, sind ihre Sätze meist kurz und knapp, darüber verliert sie kein Wort zu viel, während sie ihre sexuellen Episoden mit Driss und anderen demgegenüber ausschmückt und ausführlich in allen Facetten zu beschreiben weiß. So drücken sich ihre Gefühle auch in der veränderten Sprache aus:
S. 47: |“Ihn bedienen, dann wieder abräumen. Ihm ins Ehebett folgen. Die Beine breit machen. Mich nicht bewegen. Nicht seufzen. Die Übelkeit bekämpfen. Nichts fühlen. Sterben. Auf den Kelim starren, der an der Wand hängt. Saied Ali zulächeln, der den Menschenfresser mit seinem gegabelten Schwert enthauptet. Mich zwischen den Beinen trockenreiben. Schlafen. Die Männer hassen. Ihr Ding. Ihr übel riechendes Sperma.“|
Der gesamte Roman ist leicht und verständlich geschrieben, ein ausführliches Glossar am Ende des Buches erleichtert das Verständnis des arabischen Vokabulars, das sich nicht immer aus dem Zusammenhang erschließt. Doch deckt das Glossar alle fremden Vokabeln ab, sodass keine Fragen offen bleiben.
_Nichts ist unmöglich_
Die Autorin entwickelt zwei verschiedene Handlungsstränge. Auf der einen Seite berichtet Badra von ihren Erlebnissen bei Tante Selma in Tanger und von ihrer Liebe zu Driss, eingeschoben sind aber immer wieder kursiv gedruckte Kapitel, die Geschichten aus ihrer Vergangenheit erzählen. Im Vordergrund stehen jedoch die Episoden um Driss, die den deutlich größeren Raum in diesem Buch erhalten. Über Badras Vergangenheit erfahren wir nur das Nötigste, hier offenbart sie nur die Fakten, die erforderlich sind, um ihre Handlungsweisen zu verstehen und um deutlich zu machen, dass sie aus ihrer Ehe flüchten musste.
Neben den Episoden einer gescheiterten Ehe erfährt der Leser darüber hinaus Geschichten aus Badras Kindheit und muss erkennen, dass die junge Frau schon lange vor ihrer Entjungferung mehr als neugierig war. Dort lesen wir Geschichten über ihre Cousine Noura, die oftmals mit einigen Freundinnen zu Badra zu Besuch kommt, um dort statt mit Puppen zu spielen, sich gegenseitig zu erkunden und zu befriedigen. Doch auch die Jungen wissen sich zu helfen, denn eines Tages kann Badra eine Reihe von Jungen beobachten, von denen „jeder den neben ihm Liegenden zwischen den Beinen bearbeitete“, so ihre Ausdrucksweise.
Als Badra schließlich ihre Affäre zu Driss beginnt, driftet „Die Mandel“ (welch treffender Titel!) deutlich ins Schlüpfrige ab, der Leser bekommt mehr als offenherzige Episoden zu lesen, nicht nur Badra erscheint uns sexsüchtig, sondern auch Driss, der offen bekennt, dass er auch gerne mit Männern und bisexuellen Frauen schläft. In diesem Buch gibt es nichts, was es nicht gibt. Hier befriedigen sich die Jugendlichen nicht nur untereinander, da gibt es auch Driss‘ Großmutter, die sich mit Vorliebe jungen Mädchen gewidmet hat, auch Geschichten aus der Oberschule erzählt uns Badra, wo die Mädchen des nachts zu zweit in einem Bett geschlafen haben – offiziell, um sich gegenseitig zu wärmen, doch bezeichnet Badra das Schulheim ganz deutlich als „knisterndes Freudenhaus“.
Bei derlei Beschreibungen über den arabischen Lebensstil regen sich nun spätestens leise Zweifel angesichts des Wahrheitsgehalt dieses Buches, denn schwer vorstellbar ist es doch, dass derlei freie Liebe dort wirklich praktiziert wird. Doch haben diese Zweifel auch ihren Reiz, da der Leser für sich entscheiden kann, ob er Nedjmas Lebensbeichte Glauben schenken mag oder das Buch als unterhaltsame erotische Lektüre sieht, die vielleicht noch Anregungen für das eigene Liebesleben zu bieten vermag?!
_Sexuelle Befreiung?_
Ein wichtiger Punkt ist die Frage nach der sexuellen Befreiung, auf den die Autorin besonders deutlich verweist. Badra flüchtet zu ihrer Tante Selma, um ihrem lieblosen Ehemann zu entkommen, der sie als bloßes Stück Fleisch ansieht, an dem er sich allabendlich kurz abreagieren kann. Dass auch seine Frau sexuelle Begierden hat, scheint Hmed nicht zu interessieren. Erst Driss ist es, der seiner Geliebten jeden Wunsch von den Augen ablesen kann, der sie in Sphären mitreißen kann, die sich Badra nie erträumt hätte. Sie ist abhängig von ihm und süchtig nach dem Sex mit ihm, in ihrer Beziehung zueinander dreht sich alles um das Eine und Badra erkennt schnell, dass ihr einmal Sex nicht reicht. Der Leser ist selbstverständlich immer mittendrin im Geschehen und erlebt alles hautnah mit.
Während Badra noch von ihrer sexuellen Befreiung schwärmt, merkt sie offensichtlich nicht, wie sie immer abhängiger wird von Driss. Er gibt ihr jeden Monat Geld für ihren Lebensunterhalt und kauft ihr am Ende sogar eine Wohnung. Obwohl es Badra fast das Herz zerreißt, lässt sie Driss gewähren und mit anderen Frauen und Männern schlafen. Selbst wenn die beiden zusammen ausgehen, ist es doch nicht sicher, dass Driss später Badra auswählt, die er mit nach Hause nehmen wird. Alles schluckt sie runter, auch Zeiten der Abstinenz, in denen Driss Badra nicht beachtet und nicht mit ihr schläft. Badra wird dabei immer unglücklicher und beschließt schlussendlich, sich von ihrem Geliebten zu trennen, doch ist die Hörigkeit so groß, dass sie es nicht schafft.
So wird beim Lesen doch immer offensichtlicher, dass die sexuelle Befreiung keine wirkliche Befreiung ist, da sich Badra in eine Abhängigkeit zu Driss begeben hat. Erst spät erkennt sie die Lage, in die sie geraten ist und nach Driss‘ Tod spricht Badra teils in verbitterten Worten über ihren einstigen Geliebten. Dennoch finde ich es fragwürdig, diese sexuelle Hörigkeit als eine Befreiung hinzustellen, die sie in Wahrheit nicht ist.
_Bildungslektüre mit Spaßfaktor_
Insgesamt ist das Buch angenehm zu lesen und auch eine unterhaltsame Lektüre, die eventuell manchem Leser noch etwas Neues zu berichten weiß. Am Ende ist man fast traurig, dass es nur einen Abend braucht, um dieses schmale Buch zu lesen, das einen in eine exotische und faszinierende Welt versetzt, die man höchstens aus erotischen Filmen kennt, die keine Jugendfreigabe erhalten. Diskussionswürdig ist die Frage nach der sexuellen Befreiung, die eigentlich keine ist, auch wenn die Geschichte einer Frau, die sich von religiösen und kulturellen Fesseln lösen kann, anderen Frauen in einer ähnlichen Situation vielleicht auch Mut machen kann. Das Buch wird ergänzt durch ein umfassendes Glossar, das alle auftauchenden arabischen Wörter erklären kann. Mit nur kleinen Einschränkungen bleibt das Buch insgesamt empfehlens- und auch lesenswert.
http://www.droemer-knaur.de/mandel/