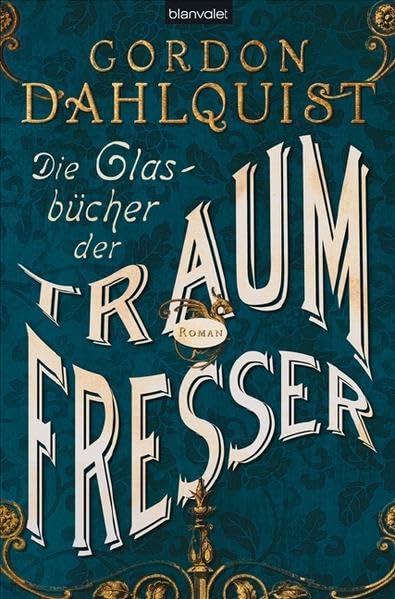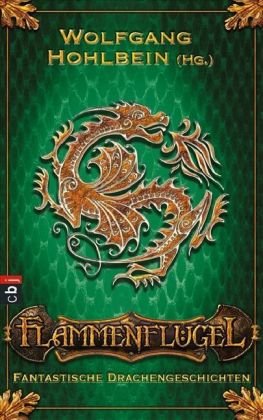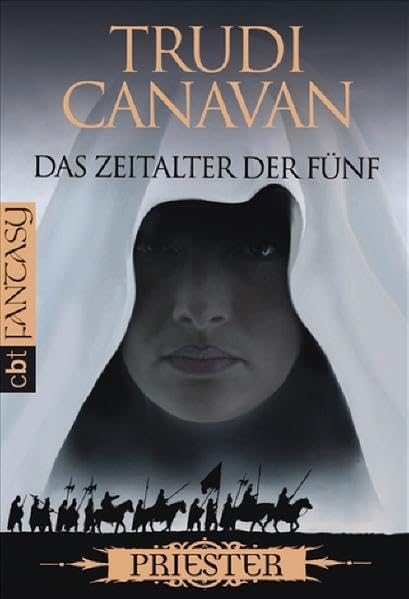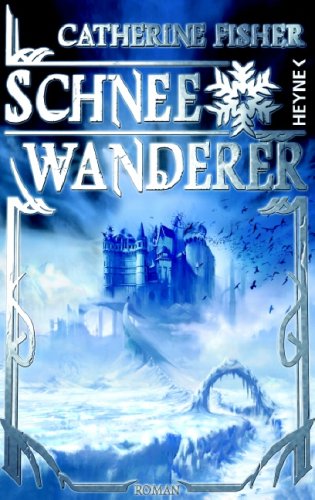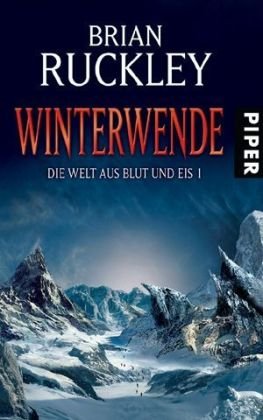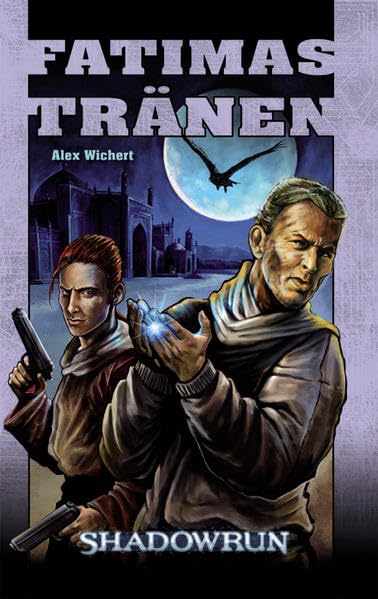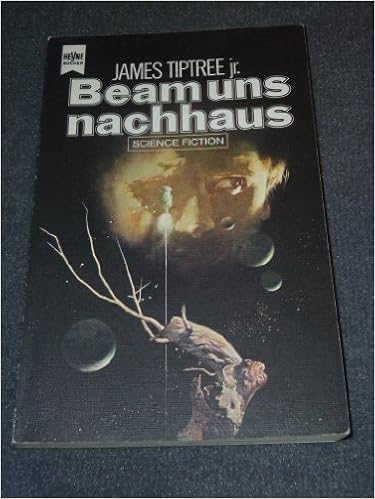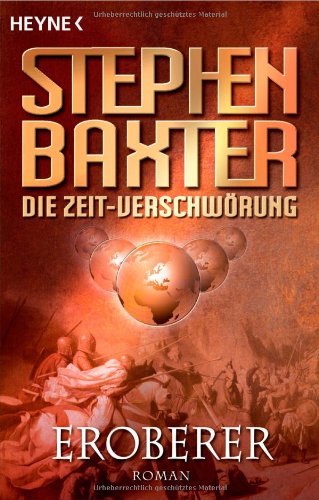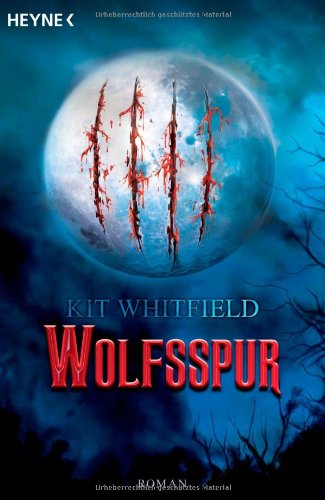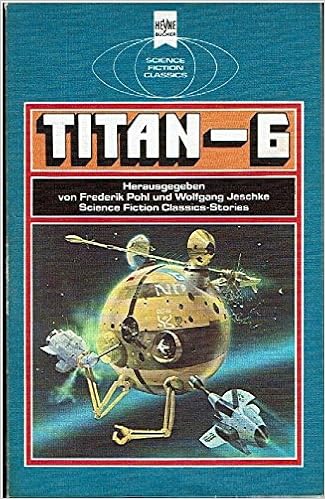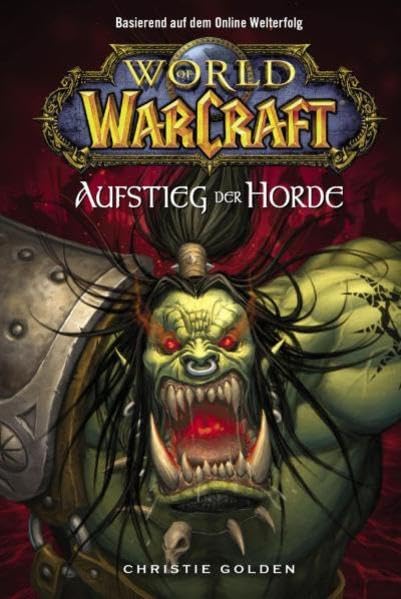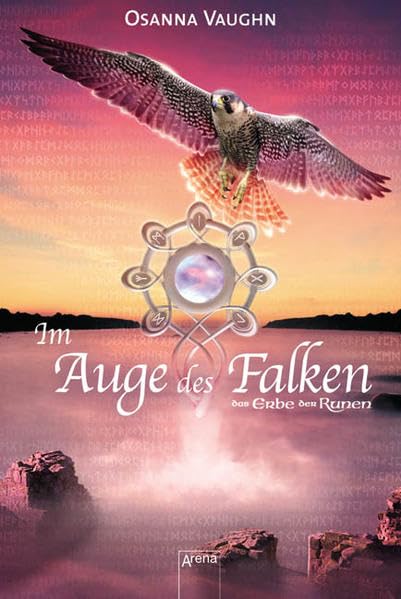Was Gordon Dahlquist mit seinem Debütroman „Die Glasbücher der Traumfresser“ abgeliefert hat, ist schon rein optisch ein Hingucker: Ein großformatiger Schuber mit zehn handlichen Einzelbänden. Ein Hauch von Groschenroman weht da mit, genau wie eine gehörige Portion Nostalgie, wenn man im Klappentext liest: |“Zehn komfortabel zu lesende Bände für die schlanke Damenhand und für den Herrn auf Reisen“.|
Gordon Dahlquist hat ein durch und durch viktorianisches Buch geschrieben – das fängt bei der Skizzierung von Zeit und Figuren an und hört erst beim zeitgemäßen optischen Erscheinungsbild des Werkes auf. Insgesamt klingt die Geschichte von Dahlquists Debütroman, als wäre sie selbst einem Roman entsprungen. Angefangen hat alles mit einem Traum, es folgten ein Zwei-Millionen-Dollar-Deal mit dem Verlagshaus |Bantam| und der Verkauf der Filmrechte, und damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Längst hat Dahlquist den zweiten Teil geschrieben, der im nächsten Jahr im englischsprachigen Raum erscheinen wird.
„Die Glasbücher der Traumfresser“ entwickelte sich schnell zum Bestseller, dabei klingt der Plot nicht wirklich so, als würde er Stoff für eine sich millionenfach verkaufende Geschichte liefern. Und wie das Ganze überhaupt verfilmt werden soll … Na ja, warten wir’s ab. Man tut sich schwer, den Inhalt in wenigen Worten zusammenzufassen, denn dafür ist die Handlung teilweise einfach zu abgefahren.
Alles beginnt ganz harmlos, als Celeste Temple, frisch von ihrem Verlobten Roger Bascombe abserviert, selbigem heimlich zu einem Maskenball aufs Land in das noble Anwesen Harshmort House folgt. Eigentlich will sie nur den Grund für Rogers plötzlichen Sinneswandel wissen, doch unversehens findet sich Miss Temple mitten in einer undurchsichtigen Konspiration wieder. In Harshmort House wird sie Zeugin höchst eigenartiger Vorgänge und Orgien, wird obendrein beinahe das Opfer einer Vergewaltigung und entgeht nur knapp einem Mordversuch.
Wenig später trifft Celeste Temple auf zwei unverhoffte Mitstreiter, die ebenso begierig darauf sind, zu erfahren, was in Harshmort House und rund um den merkwürdigen Comte d’Orkancz und die eigenwillige Schönheit Contessa Lacquer-Sforza vor sich geht. Einer der beiden ist ein Auftragskiller, der sich Kardinal Chang nennt. Ein Mann mit vielen Narben und einer Vorliebe für seinen extravaganten und nicht minder auffälligen roten Mantel. Auch er wird durch eine eigentlich unbedeutende Geschichte in die Verwicklungen von Harshmort House gezogen und muss schon bald, wie seine beiden Verbündeten, um sein Leben bangen.
Der Dritte im Bunde ist der Leibarzt des mecklenburgischen Prinzen Karl-Horst. Dr. Adelbard Svenson will eigentlich nur seinen Schützling Karl-Horst vor Schaden bewahren, bevor der sich wieder kopfüber in irgendeine ausschweifende Sache stürzt, die später seinem Ruf und seiner Gesundheit schadet. Doch schon kurze Zeit später wird Prinz Karl-Horst entführt und Svenson schließt sich mit Miss Temple und Chang zusammen, um mit ihnen gemeinsam der Sache auf den Grund zu gehen, denn es scheint ein Zusammenhang zu bestehen zwischen dem Verschwinden von Karl-Horst und den Vorkommnissen in Harshmort House.
Was folgt, ist ein rasantes Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Verschwörern und ihren drei Kontrahenten Miss Temple, Chang und Dr. Svenson. Im Laufe der Zeit finden die drei heraus, dass seltsame Glasbücher, in denen der Comte und seine Gefolgschaft offenbar Träume und Gedanken anderer Menschen konservieren, eine wichtige Rolle spielen. Doch was hat es mit den Glasbüchern auf sich? Und welchem Zweck dienen sie?
Die Geschichte an sich ist eine recht komplexe. Fast 900 Seiten umfasst der Roman, und die Zeitspanne, in der sich die Handlung abspielt, zieht sich über kaum mehr als zwei oder drei Tage. Von Anfang an setzt Dahlquist auf einen straffen Spannungsbogen, der teilweise auch davon lebt, dass der Leser nach Lektüre des Klappentextes keinen Schimmer hat, was ihn eigentlich erwartet. Er wird unvermittelt in den Plot gezogen, folgt neugierig Miss Temple auf den Maskenball und sieht dann erstaunt und ein wenig ratlos, wie die merkwürdigsten Dinge vor sich gehen und Miss Temple ganz unerwartet von einer brenzligen Lage in die nächste stolpert.
Noch nie habe ich einen Roman gelesen, in dem schon im ersten Kapitel dermaßen viel passiert, und dementsprechend vollgestopft sind auch die folgenden neun Kapitel. Stets hält Dahlquist den Spannungsbogen aufs Äußerste gestrafft und gönnt dem Leser kaum eine Verschnaufpause. Das führt mit zunehmender Seitenzahl zu gewissen Ermüdungserscheinungen. Natürlich gibt es Beispiele, in denen ein Autor es schafft, den Spannungsbogen stets auf einem Maximum zu halten, aber solche Romane sind doch eher Ausnahmeerscheinungen, wie z. B. [„Sakrileg“ 184 von Dan Brown. Dahlquists Geschichte aber spielt sich eben nicht auf 400 bis 500 Seiten ab, sondern auf knapp 900, und da scheint der stetig straffe Spannungsbogen dann doch mit der Zeit etwas auszuleiern.
Die Geschichte an sich offenbart einen wilden, eigenwilligen Genremix, der sich jeder Kategorisierung entzieht. Ein großer Schuss viktorianischer Roman, eine Prise Jules Verne, ein Spritzer Gothic Novel, vermengt zu einem blutrünstig-erotisiertem Thriller-Spektakel mit ausgeprägtem Verschwörungs- und Weltherrschaftsaroma – fertig ist die obskure Mischung, die Dahlquist dem Leser serviert.
Romantisch verklärte Bilder des viktorianischen England mischt der Autor mit unheimlichen Ideen voller Alchemie oder gar einer Prise Science-Fiction, und das ist ein Mix, der einen unwiderstehlichen Reiz auf den Leser auszuüben vermag. Inszeniert hat Dahlquist das Ganze als Geschichte einer großangelegten Verschwörung, in der es (natürlich) um nichts anderes als die Weltherrschaft geht.
Die Groschenroman-Optik des Buches täuscht dabei ein wenig über die eigentliche Tiefe des Plots hinweg. Man muss schon konzentriert lesen, um den Faden nicht zu verlieren. Mit jedem Kapitel begleitet der Leser eine andere Figur, mal Miss Temple, mal den Doktor, mal Chang, teilweise kreuzen sich die Wege aller drei Figuren im Laufe eines Kapitels aber auch. Daraus ergeben sich natürlich Sprünge im zeitlichen Ablauf. Man verfolgt eine Szene später oft noch einmal aus dem Blickwinkel einer anderen Figur, mit anderen Einschätzungen und Sichtweisen. Dabei das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren, erfordert schon einige Konzentration, die über die knapp 900 Seiten aufrechtzuerhalten schon eine gewisse Anstrengung darstellt. Eine Straffung hätte dem Buch sicherlich gutgetan, obgleich es vor Erscheinung schon gehörig gestrafft wurde (von 1300 auf die jetzigen knapp 900 Seiten).
Und genau das ist auch die größte Schwierigkeit. Es gibt so viele Namen, so viele undurchsichtige Figuren, deren Rollen von den unterschiedlichen Protagonisten jeweils unterschiedlich eingeschätzt werden. Man kann im Laufe der Zeit wirklich leicht den Überblick verlieren, eben auch deswegen, weil der sich abnutzende Spannungsbogen für gewisse Ermüdungserscheinungen sorgt. Die ganze Geschichte bleibt auch am Ende noch einigermaßen schwer nachvollziehbar, und das schmälert dann doch ein wenig die Freude.
Passend zum viktorianischen Zeitalter bedient Dahlquist sich eines Erzählstils, der die Zeit widerspiegelt: ausgeschmückt, ein wenig altertümlich und mit feinen ironischen Nuancen versehen. Das macht das Buch zu einer angenehmen Lektüre, wenngleich man auch immer wieder über etwas holprige Stellen stolpert. Ob das nun dem Autor selbst oder vielmehr der Übersetzung anzulasten ist, lässt sich ohne Blick in das Original nicht klären.
„Die Glasbücher der Traumfresser“ ist in jedem Fall ein Buch, das seinesgleichen sucht. Man muss als Leser offen und auf alles gefasst sein, ähnlich wie beispielsweise bei den Büchern von Robert Anton Wilson, dann wird man im Großen und Ganzen schon seine Freude an der Lektüre haben. Man muss aber auch stets gleichermaßen konzentriert bei der Sache sein, um im Meer der Figuren und zwielichtigen Gestalten nicht den Faden zu verlieren.
Bleibt unterm Strich festzuhalten, dass Gordon Dahlquist mit „Die Glasbücher der Traumfresser“ ein beachtenswertes Debüt geglückt ist, ein ungewöhnlicher Roman und ein wilder Genremix mit vielen verrückten Einfällen. Zwar bemüht Dahlquist sich, die Spannung von Anfang bis Ende kontinuierlich hoch zu halten, dennoch nutzt sich der Spannungsbogen mit der Zeit ab. Etwas straffer und nachvollziehbarer erzählt, könnte „Die Glasbücher der Traumfresser“ ein echter „Pageturner“ sein. So bleiben aber einzelnen Schwachpunkte in einem faszinierend vielschichtigen Plot, der eine aufgeschlossene Leserschaft sucht.
|Originaltitel: The Glass Books of the Dream Eaters
Originalverlag: Bantam, New York 2006
Aus dem Amerikanischen von Bernhard Kempen
Deutsche Erstausgabe 2007
Paperback, 896 Seiten, 15,0 x 22,7 cm
Luxusausgabe in 10 Bänden in eleganter Geschenkbox|
http://www.gordon-dahlquist.de/
http://www.blanvalet-verlag.de