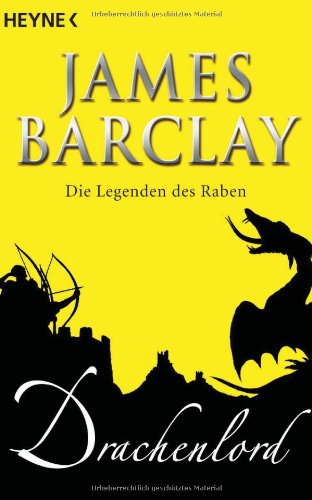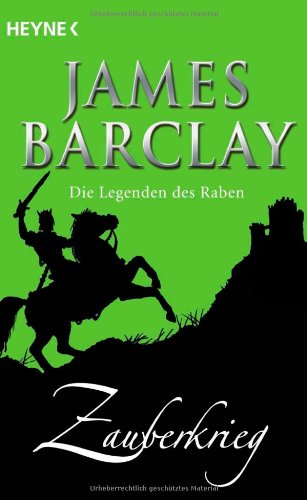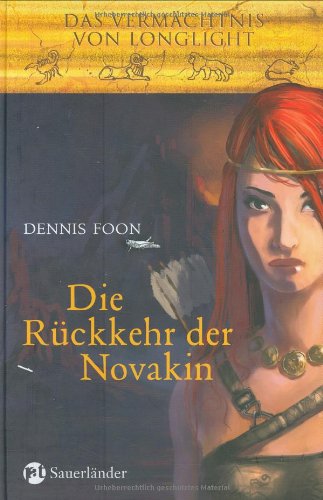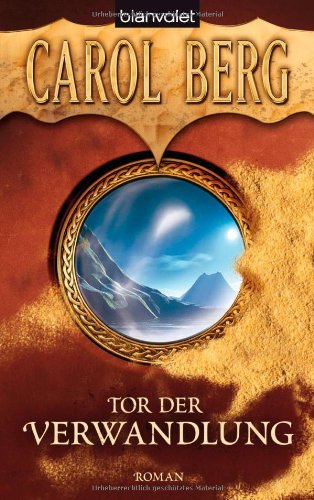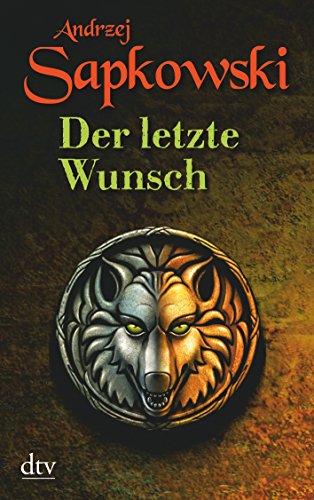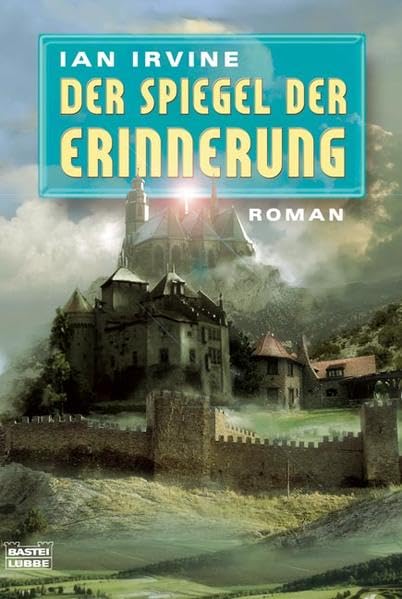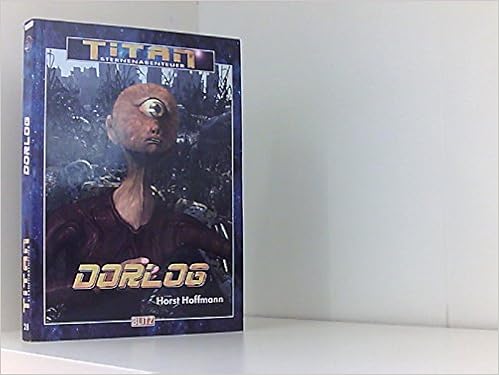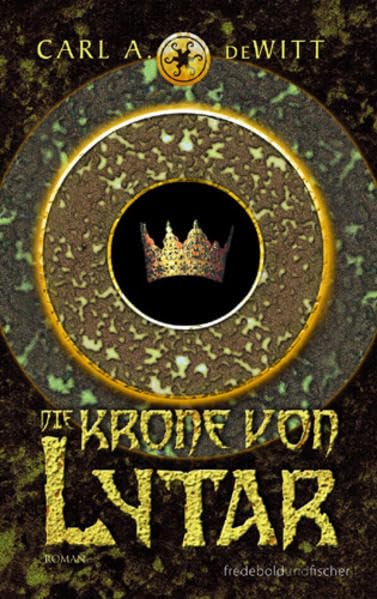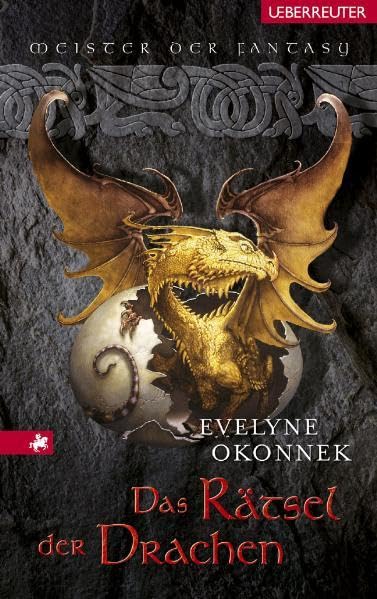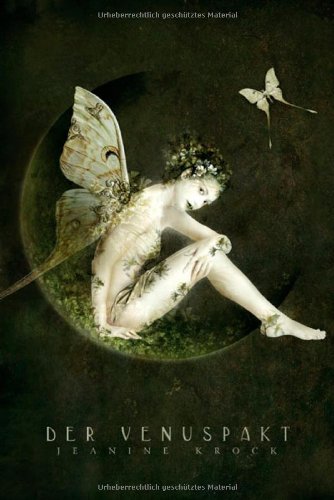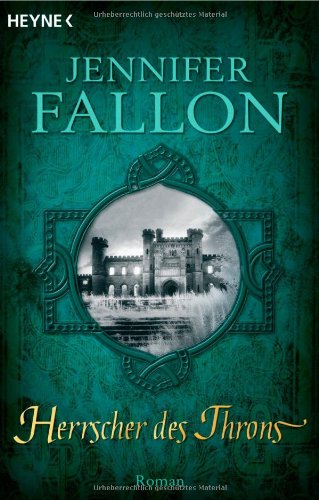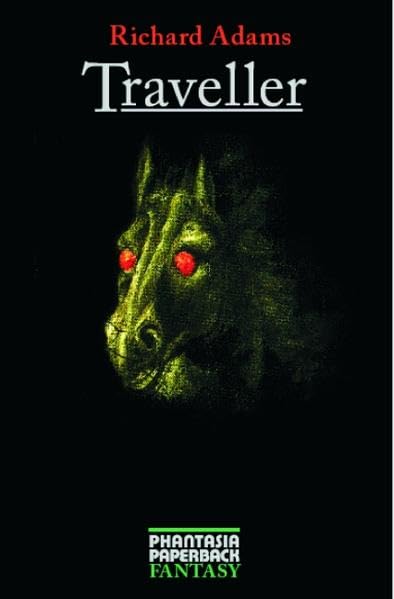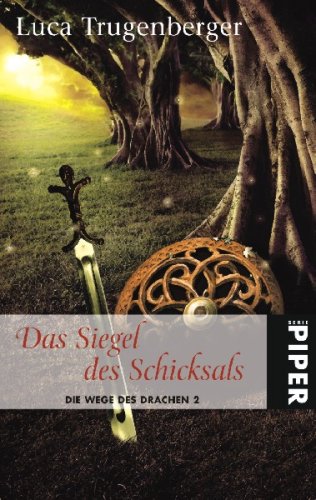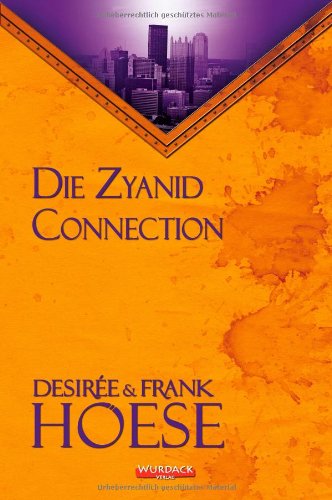|Die Chroniken des Raben|:
[„Zauberbann“ 892
[„Drachenschwur“ 909
[„Schattenpfad“ 1386
[„Himmelsriss“ 1815
[„Nachtkind“ 1982
[„Elfenmagier“ 2262
|Die Legenden des Raben|:
[„Schicksalswege“ 2598
[„Elfenjagd“ 3233
[„Schattenherz“ 3520
[„Zauberkrieg“ 3952
_Story_
Noch während der Rabe sich dazu entschließt, endgültig in den Ruhestand zu treten, greifen die Wesmen nach jahrelanger Abwesenheit wieder an und führen einen vernichtenden Schlag gegen das geschwächte Kolleg von Xetesk aus. Dessen Anführer Dystran sieht sich in verzweifelter Lage dazu genötigt, einmal mehr die Dimensionsmagie zu bemühen, und öffnet in einer letzten Defensivmaßnahme das Portal zur Dimension der Dämonen.
Zwei Jahre später: Ganz Balaia wird von Dämonen heimgesucht; die letzten Überlebenden der Kollegien verschanzen sich in Kalträumen, die sie vor den Seelenräubern schützen und ihnen einen letzten Hort vor der drohenden Vernichtung bieten. Doch die Dämoen werden von Tag zu Tag stärker und konzentrieren das balaianische Mana, um das Land in Kürze zu unterwerfen und die dort lebenden Menschen und Elfen auszurotten.
Hirad, der mit den Elfen nach Calaius gegangen war, erfährt als Erster von der Bedrohung. In einem Traum begegnet er Ilkar und erfährt über dessen Bruder Rebraal vom Schicksal, das selbst der Welt der Toten droht, wenn die Dämonen die Dimension von Balaia übernehmen. Sofort wird ihm klar, dass nur eine Maßnahme zur Rettung Balaias ergriffen werden kann: Der Rabe muss rekrutiert werden und in seiner sicherlich letzten großen Schlacht alle Kräfte des Landes an sich binden, um die Dämonen auszurotten.
_Meine Meinung_
James Barclay vollführt im fünften Band der „Legenden des Raben“ ähnliche Winkelzüge wie einst zur Zeit der sechsteiligen „Chroniken des Raben“. Kurz vor Ende der Serie und in direkter Folge an einen sinngemäß abgeschlossenen Handlungsstrang beginnt er eine Geschichte auf einer gänzlich anderen Ebene und sucht mitunter auch ein wenig künstlich – so scheint es zunächst – nach verbliebenem Futter für die Anhänger seiner berüchtigten Söldnertruppe.
Allerdings schließt sich von nun an endgültig der Kreis, den zu zeichnen der Autor bereits in seinem allerersten Raben-Roman begonnen hatte. Die ersten Begegnungen mit den anderen Dimensionen, die meist nur kurz angedeuteten Mysterien um die Welt der Dämonen, dazu die zuletzt noch unbefriedigende Unordnung im Streit der Kollegien untereinander und natürlich die (hier erst vollzogene) abrupte Auflösung der Rabentruppe verlangten nach weiterer Aufklärungsarbeit, um das gesamte Konstrukt rund zu bekommen.
Jedoch ist der Einstieg dieses Mal besonders schwer; der Rabe scheint seinen Frieden gefunden zu haben und distanziert sich vom Chaos in Balaia. Während Thraun und Hirad den Elfen nach Calis gefolgt sind, ist der unbekannte Krieger gemeinsam mit Darrick, Erienne und Denser in den Schoß seiner Familie zurückgekehrt, wo Erienne erfolgreich mit der Magie des Einen arbeitet und langsam aber stetig lernt, sie zu beherrschen. Als Hirad dann plötzlich auftaucht und von der neuen Bedrohung berichtet, ist man sich uneins, ob man ein letztes Mal für die Rettung Balaias kämpfen soll. Der Wille ist gebrochen, die Routine verblasst und die Ausstrahlung trotz der scheinbar kurzen Zeit von gerade mal zwei Jahren völlig glanzlos abgestumpft.
Doch in der Not bleibt den Rabenkriegern keine Wahl – und so geht es in eine weitere Schlacht, der die Truppe ebenso skeptisch gegenübersteht wie der Leser. Denn dieses Mal kämpft nur noch eine kleine Bastion der Menschen gegen einen schier übermächtigen Feind. Und auch wenn man insgeheim auf die Unterstützung der Drachen hofft und vertraut, so ist das Chancenverhältnis selbst dann, wenn die Kollegien sich doch noch ein letztes Mal vereinen sollten, äußerst schlecht.
Über die Entwicklung des neuen Plots findet man somit langsam wieder zum Glanz alter Tage zurück. Zwar fällt die Identifikation mit dem spürbar gealterten Raben diesmal ungleich schwerer, und darüber hinaus ist die Story in diesem Fall auch ein ganzes Stückchen komplexer, aber sobald der Funke übergesprungen ist und man erst einmal wieder die Tragweite all dessen, was Barclay hier aufgezäumt hat, erkannt hat, ist die Begeisterung sofort wieder geweckt. Und trotzdem: Ein wenig Skepsis bleibt, weil unterschwellig die Meinung haften bleibt, der Autor klammere sich hier an seinen letzten Rettungsanker, um die Faszination um seine nunmehr legendären Söldner aufrechtzuerhalten. Kurz vor Ende der Serie holt er nämlich noch einmal weit aus und kramt einige Ideen hervor, die potenziell Stoff für eine ganze weitere Chronik aufbieten, aber schlussendlich doch in gerade mal zwei Büchern aufgearbeitet werden müssen.
Der bezeichnende Titel des nächsten und bislang letzten Romans „Heldensturz“ lässt daher auch Schlimmes vermuten. Erst einmal gilt es nämlich schon in Kürze, Abschied von den Helden zu nehmen; weiterhin liegt die Furcht nahe, dass es kein schöner Abschluss für die Truppe sein wird, und als Letztes fragt man sich, ob Barclay tatsächlich diesen inhaltlich radikalen Weg einschlagen musste, um das endgültige Finale einzuläuten. Im Grunde genommen verbaut er nämlich somit jegliche Hoffnung darauf, dass der Rabe auch später noch literarisch existieren kann. Und dies nun Schwarz auf Weiß zu erkennen, ist für den seit nunmehr drei Jahren faszinierten, begeisterten Anhänger wahrscheinlich die schlimmste Erkenntnis eines schwer verdaulichen, zu Beginn etwas zwiespältig zu betrachtenden Buches. Aber viel wichtiger ist dennoch die überwiegend positive Seite des mit dem etwas irreführenden Titel „Drachenlord“ bezeichneten Romans, nämlich dass James Barclay einmal mehr beweist, dass er in Sachen phantastischer Dramaturgie nach wie vor unschlagbar ist. Die Art und Weise, wie sich das aktuelle Werk nämlich entwickelt, ist nämlich einfach nur phänomenal!
http://www.heyne.de/