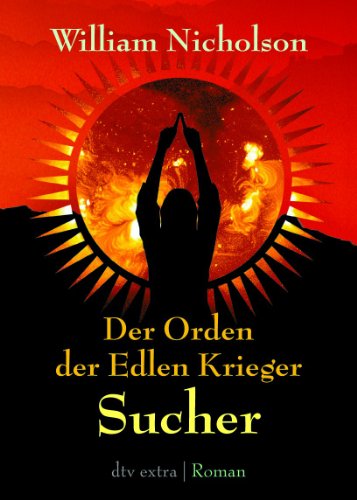
William Nicholson – Sucher (Der Orden der Edlen Krieger I) weiterlesen
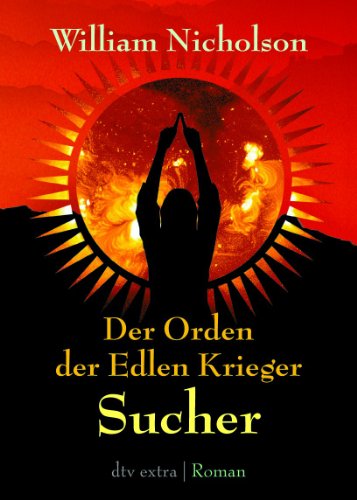
William Nicholson – Sucher (Der Orden der Edlen Krieger I) weiterlesen
Band 1: [„Totentaucher“ 3645
Band 2: [„Die acht Namenlosen“ 3645
_Story_
Atlan reist gemeinsam mit Ohm Santarin nach Sadik, um dort sein Versprechen an den verstorbenen Ältesten der da Onur einzulösen und den Anspruch auf ein einst geraubtes Gebiet wiederherzustellen. Ebenfalls mit an Bord: da Onurs Tochter Aizela, die ihr Leben lang darauf vorbereitet wurde, im Kampf gegen den grausamen Tyrannen Gart da Tromin zu bestehen und das Erbe ihres Volkes zurück zu erkämpfen.
Getarnt erreichen die Gefährten die versklavte Welt und schleusen sich schnell in die Festung de da Tromin ein. Doch Atlan wähnt sich zu rasch auf der Siegerstraße und erleidet nach einem Gefecht mit da Tromin und der darauf folgenden Liaison mit der Mutantin Camara Zaintz schwere Verletzungen. Als er wieder aufwacht, befindet er sich in einem Arbeitslager des Führers von Sadik, in dem Tag für Tag viele Menschen an den Folgen der Sklaverei sterben. Doch ein Ausbruch scheint selbst für Atlan aussichtslos, denn das Gefängnis ist zu gut abgeriegelt und seine potenziellen Helfer sind zu schwach.
Unterdessen haben Ohm und Aizela sich einer geheimen Gruppe von Revoluzzern angeschlossen und versuchen mit jeder erdenklichen Möglichkeit, die Tyrannei der da Tromin endgültig zu stürzen. Das Prinzip Hoffnung funktioniert tatsächlich, und alsbald sind Atlan und seine beiden Mitstreiter wieder vereint, um Artemio Hoffins davor zu bewahren, sich auf Camouflage der Tyarez-Häute zu bemächtigen und ihr Wissen zu erobern. Es kommt zu einem letzten Showdown zwischen dem gesuchten Gangster und dem Lordadmiral. Aber die Befreiung in Camouflage hängt von vielen Schicksalen ab – und von den Eigenschaften der sagenumwobenen Tyarez.
_Meine Meinung_
Die Lepso-Trilogie kommt im dritten Band „Befreiung in Camouflage“ zum ersehnten Abschluss, gleichzeitig aber natürlich auch zu ihrem bisherigen Höhepunkt, der sich in der konstanten Steigerung innerhalb der Serie schon vorab abzeichnete und nun mit einem wirklich überzeugenden, nur noch mit wenigen Schwächen ausgestatteten Roman bestätigt wird.
Wieder einmal begibt sich Atlan auf eine berüchtigte, anrüchige Welt, um am Gefüge der Obrigkeiten zu wackeln und die tyrannische Monarchie zu stürzen. Auf der Suche nach dem Vermächtnis der acht Namenlosen und einer gerechten Lösung für den Clan da Onur begibt er sich nach Sadik und trifft dort auf den gewieften Händler und unbarmherzigen Führer Gart da Tromin. Fast schon zu leicht gelingt es ihm, diesen in der Gestalt des Eli Pattri von einem lukrativen Deal zu überzeugen und eine Audienz in seinen Gemächern gewährt zu bekommen, doch erweist sich die darin gesetzte Hoffnung als Trugschluss.
Atlan gerät in einen weiteren Hinterhalt und kann nur mit Hilfe der Mutantin Camara Zaintz entkommen, die jedoch daraufhin Ansprüche auf den Körper Atlans erhebt. Nachdem sie ihn völlig eingelullt hat, bittet sie zum Liebesakt – und stirbt auf dem Höhepunkt der Erregung. Benommen von diesen Ereignissen, folgt für Atlan auch schon die nächste Gefahr, die den Lordadmiral in ein Gefangenenlager führt, wo er unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten soll. Um ihn herum sterben Kinder und Frauen; auch eine Schwangere wird kompromisslos gescheucht und bei einzelnen Tauchgängen eingesetzt. Atlan nimmt sich ihrer an und sucht nach Möglichkeiten des Ausbruchs. Diese werden ihm schließlich von seinen verschollenen Gefährten geliefert, die im Hintergrund die Ursprünge einer revolutionär eingestellten Gruppierung entdeckt und sie für ihre Zwecke genutzt haben.
Doch damit beginnt das eigentliche Abenteuer erst richtig, denn in Camouflage hat sich bereits der gefürchtete Artemio Hoffins an den Hinterlassenschaften der Tyarez zu schaffen gemacht und plant, ihr umfassendes Wissen zu nutzen, um Imperator Dabrifa zu stürzen und seinen Posten einzunehmen. Überlegen wähnt er sich auf dem Weg zur Macht. Aber da hat Hoffins die Rechnung ohne den Wirt gemacht – und dieser heißt natürlich Atlan.
Die letzte Geschichte der recht unabhängig voneinander lesbaren Trilogie weist innerhalb der gesamten Story den wohl höchsten Spannungsgrad auf, dies jedoch in zwei unterschiedlichen Abschnitten. Grob gesehen muss man „Befreiung in Camouflage“ nämlich in zwei recht losgelöste Parts trennen, nämlich einmal die Handlung auf Sadik und anschließend das Geschehen in Camouflage. Aber insbesondere der Aufenthalt in der Welt der da Tromin ist ein nennenswerter Höhepunkt der bisherigen Reihe. Zwar greift Michael M. Thurner, der dritte Autor im Verbund der „Lepso-Trilogie“, auf einige Ideen zurück, die bereits sein Vorgänger Christian Montillon in „Die acht Namenlosen“ bemüht hat (zum Beispiel die Gefangenschaft in einem Barackenlager), lässt jedoch die spannend voranfließende Action und seine ebenso flüssige, sprachlich sehr kompetente Schreibe in den meisten Fällen für sich sprechen. Dazu gesellen sich frische Elemente wie das Eingreifen der unscheinbaren Camara Zaintz, das wohl als merkwürdigstes Ereignis im Laufe der Gesamtstory haften bleibt.
Weniger erbaulich ist allerdings die etwas strikte Trennung der beiden Handlungsabläufe. Atlans Aufenthalt in Sadik sowie seine Reise und die anschließenden Konflikte in Camouflage mögen zwar durch mehrere Bänder miteinander verbunden sein, doch ist der Übergang zwischen beiden recht hölzern und auch ein wenig rasch vollzogen worden. Ohne besondere Einleitung treten plötzlich fast schon wieder vergessene Charaktere wie Artemio Hoffins in die Handlung ein, ohne dass die Hintergründe zunächst offensichtlich erscheinen. Und so ist generell der Auftakt des Camouflage-Finales ein wenig sprunghaft dargestellt. Thurner lässt sich unverhältnismäßig lange Zeit, um das Finale endlich in die Wege zu leiten, und nimmt so kurzweilig das Spannungshoch raus. Man erfährt stattdessen von den Vorbereitungen auf den Kampf aus der Perspektive beiden Parteien, wartet im Grunde genommen aber nur darauf, dass die Handlungsträger endlich mal zur Aktion schreiten und die Erzählung wieder an Tempo gewinnt. Doch derartige Schönheitsfehler sind aus der „Lepso-Trilogie“ ja schon bekannt und gehen nun, leider, auch nicht an „Befreiung in Camouflage“ respektive Michael M. Thurner vorbei.
Dennoch ist das Resümee, alleine auf diesen letzten Band bezogen, in der Summe positiv. Thurner hat die guten Ideen Montillons auch auf seinen Teil des Plots verlagert und die Geschichte mittlerweile vor jeglicher überflüssigen Komplexität bewahrt. Was dies betrifft, liegen zwischen „Totentaucher“ und „Befreiung in Camouflage“ Welten, so dass eine angenehme Entwicklung auf jeden Fall zu attestieren ist. Weiterhin bringt der Autor des dritten Buches die Geschichte logisch und für alle zufriedenstellend zu Ende, fährt aber nicht bloß auf konventionellen Bahnen. Ein Durchmarsch Atlans scheint zwar vorprogrammiert, doch eröffnet der Erzähler seinem Publikum genügend spannend aufgebaute Hindernisse, die den Abschluss der „Lepso-Trilogie“ zu einem lesenswerten und würdigen Ereignis aus der indirekten Umgebung Perry Rhodans machen. Ich für meinen Teil freue mich, dass die Reihe von Episode zu Episode bzw. von Autor zu Autor besser geworden ist und sich die nach dem ersten Band gesammelten Befürchtungen auch hier nicht mehr einstellen, wenngleich „Befreiung in Camouflage“ noch nicht ganz in der A-Klasse der Science-Fiction angesiedelt ist.
http://www.fanpro.com
http://www.perryrhodan.net/
[Perrypedia]http://www.perrypedia.proc.org/Lepso__%28Zyklus%29
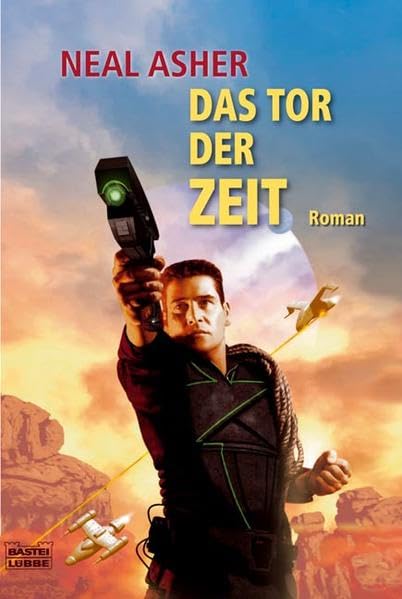
Eines Tages wird die KI „Celedon“, die in einem vergessenen Winkel der Polis eine Raumstation steuert, zu einer unbekannten Sonne beordert. Dort steht die Öffnung eines „Runcibles“ an: Zwei Punkte im All werden durch ein künstliches Wurmloch verbunden, durch das sich gewaltige Strecken in Nullzeit überbrücken lassen. Diese Technik ist kompliziert und nicht ungefährlich, so dass weiterhin die „normale“ Raumfahrt dominiert. „Earth Central“ hält zudem geheim, dass die Runcibles auch Zeitreisen ermöglichen. Die „Celedon“ steuert ein Portal an, durch das eine Reihe von Menschen 830 Jahre in die Vergangenheit reisen.
_Story_
Anake und Cy begleiten „World Market“-Leader Michael Moses bei der Jungfernfahrt seines neuen Luftschiffes, der |Hindenburg II|. Nach einer eindrucksvollen Demonstration der Fähigkeiten seines Schiffes kommt es aber zu einem verheerenden Zwischenfall; das mit geladenen Gästen bemannte Prachtstück wird von einer riesigen Krake angegriffen. Und wieder einmal blickt Moses seinen größten Feinden ins Auge: den Ökoterroristen.
Unterdessen folgen Shalyn und Monja der überraschenden Einladung einer japanischen Studienkollegin der Suuranerin und reisen in eine verlassene asiatische Berglandschaft. Schnell genervt von den ständigen sexistischen Annäherungsversuchen der jungen Michiko, bereut Shalyn alsbald, nach Fernost gereist zu sein. Dann jedoch stößt das von Sir Klakkarakk begleitete Trio auf einen verlassenen Frachter der HNO. Neugierig betrachten Shalyn und Co. das Innere und machen eine unglaubliche Entdeckung. Ein wahrer Brutherd von genmutierten Wesen wurde hier gebildet, und immer schwerer wiegt der Verdacht, dass ihr Auftraggeber Amos Carter und die CRC ihre Finger im Spiel haben.
Inzwischen versucht ein Brüderpaar, die terroristischen Flügel der Ökomaschinerie zu unterwandern und die aktuellen Entwicklungen friedlich zu einem Ende zu bringen. Nichts ahnend spinnen sie eine Intrige gegen ihren Chef und schalten sogar die Medien ein. Dann aber taucht Ingrid, eine Agentin der Organisation |Menschmaschine|, auf und hinterlässt im Lager der Ökoterroristen eine blutige Spur der Verwüstung.
_Persönlicher Eindruck_
Bizarr und eigenwillig wie gehabt wird die Geschichte der „Titan-Sternenabenteuer“ in ihrem bereits 27. Band fortgesetzt und spaltet dabei nicht selten auch die qualitätsbewussten Gemüter des Science- bzw. Social-Fiction-Publikums. In „Krakentanz“ ist es in erster Linie der teils ungewöhnliche und nicht immer angenehme Humor des schon langfristig erprobten Autors S.H.A. Parzzival, an dem sich die Geister scheiden werden. Zunächst einmal wären diesbezüglich die kindischen Annäherungsversuche der japanischen Freundin Shalyns, Michiko, zu nennen. Es mag zwar mittlerweile zur Serie hinzugehören, dass man versucht, mittels unterschwelliger Erotik neue Elemente in die Science-Fiction-Handlung einzuflechten, aber in den ersten Seiten der Begegnung des Trios Michiko, Monjy und Shalyn ist dies ungeheuer anstrengend und mitunter kaum zu ertragen. Das peinliche sexistische Gerede untergräbt teilweise dann auch die Ernsthaftigkeit der Handlung, geprägt auch von den ‚gekränkten‘ Reaktionen der |Titan|-Steuerfrau.
Makaber wird es indes beim blutigen Feldzug der |Menschmaschine|-Agentin Ingrid. Nicht nur, dass ihr unkontrolliertes Handeln nicht immer Sinn ergibt, auch die zynischen Zitate einiger 80er-Pop-Hits (z. B. ‚Tanz den Mussolini‘), die sie bei ihren aggressiven Attentaten bemüht, wirken an den betreffenden Stellen weniger angebracht und sind eher ziellose Provokation als wirklich intelligente Social-Fiction.
Diese Aspekte fallen jedoch weniger ins Gewicht, wenn man einen Blick auf die spannende Handlung wirft, die sich nach einigen schwächelnden Phasen zuletzt langsam wieder berappelt hat und hier in einem neuen Strang wieder aufblüht. Die Story um die Anschläge der Ökoterroristen geht in eine neue, möglicherweise entscheidende Runde und wird dadurch weiter intensiviert, dass die Seiten im Lager der Terrororganisation langsam gespalten und sogar von unbekannten feindlichen Kräften angegriffen werden. Die Frage, wer denn nun wirklich die treibende ‚böse‘ Kraft ist, keimt gleich mehrfach auf und eröffnet der Handlung völlig neue Portale, die es in Zukunft noch zu durchlaufen gilt.
Ein wenig Licht kommt indes endlich auch in die Geheimidentität von Monja. Die Betonung liegt allerdings auf ‚ein wenig‘, doch zumindest offenbart sie in „Krakentanz“ einige Seiten, die bislang verborgen waren, was ihrer Lebensgefährtin Shalyn Shan zunehmend Sorgen bereitet. Dennoch ist es ein glücklicher Zug, die mit ihr verbundenen Ungereimtheiten langsam aber sicher mal eindringlicher zu durchleuchten, um das vergleichsweise anstrengende (und zuletzt auch unmotivierte) Rätselraten wieder etwas spannender zu gestalten. Einige Entwicklungen auf den letzten Seiten sprechen dafür, dass in Kürze eine Auflösung zu erwarten ist.
Insgesamt betrachtet ist „Krakentanz“ sicherlich ein guter Vertreter der Serie, dessen Schwächen einzig und alleine im merkwürdigen Humor sowie den teils sehr merkwürdigen Charakterzeichnungen und -entwicklungen (in erster Linie auf Shalyn bezogen) liegen. Die inhaltliche Entwicklung ist unterdessen begrüßenswert und bringt der Story durch Eröffnung gänzlich neuer Handlungsstränge wieder ein wenig Atemluft.
http://www.BLITZ-Verlag.de
Nachdem im Jahre 2007 eine Pandemie über 60 Prozent der Menschheit auslöschte, hat sich rund 92 Jahre nach dem Ausbruch das Bild der Welt gewandelt: Viele Menschen leben in wenigen – „Habitat“ genannten – Großstädten, in denen das Leben im Wesentlichen wie vor der Seuche verläuft, während andere im dünn besiedelten Wildland außerhalb der Städte ihr Glück versuchen. Neben der notwendigen Neuorganisation der Gesellschaft(en), an der unterschiedlichste Gruppen und Interessenverbände – politische, militärische, wirtschaftliche – mehr oder weniger direkt mitwirken, muss sich die Menschheit mit einem weiteren Erbe der Seuche rumschlagen: immer wieder tauchen Mutanten – Varianten – auf, die zwar in der Regel nicht selbst virulent sind, von denen aber dennoch fast immer ein tödliche Gefahr ausgeht.
Als sein Kollege und Freund Aaron während eines Einsatzes von einer monströsen Variante, einem Xenotaurus, getötet wird, ist Jon Zaatis Karriere bei der City Police beendet. Dieses ist allerdings kein Beinbruch, da er als das letzte überlebende Mitglied der legendären Gunslinger, einer militärisch-experimentellen Eliteeinheit, über einige herausragende physische und psychische Eigenschaften verfügt, die ihn zu einem begehrten Subjekt für Konzern-Headhunter machen.
Daher ist es wenig überraschend, dass Henri Daniels an den Elite-Kämpfer herantritt, um ihm im Namen des CEENEL-Konzerns, welcher das London-Habitat beherrscht, einen Job anzubieten; und zwar in der neu geschaffenen, geheimen Abteilung „Sektion 11“. Nicht zuletzt wegen seiner Kollegin in spe, der ebenfalls frisch angeworbenen, toughen Pilotin Juliette Dsunukkwa, nimmt Jon das Angebot ohne großes Zögern an.
Gleich ihr erster Auftrag führt die beiden Agenten in eine tödliche Konfrontation mit dem Londoner Militär – vertreten durch Major Keyner und seine Synorgs. Als Jon versucht, auf eigene Faust die fragwürdigen Umstände von Aarons Tod zu klären, kommt es für ihn fast zur Katastrophe, denn plötzlich steht er unbewaffnet zwischen einer ganzen Herde der tödlichen Variante auf der einen und den Truppen Keyners auf der anderen Seite.
Nachdem den Xenotauren ein freier Abzug aus dem Habitat zugesichert wurde und sie London in Richtung Wildland verließen, machen sich Jon und Juliette an die Verfolgung. Sie suchen den Führer der Mutanten, um erste Sondierungsgespräche mit dem Ziel einer friedlichen Koexistenz zu wagen. Ihr Weg nach Norden führt sie in ein kleines Dorf, welches sich eines Angriffs einer paramilitärischen Bande erwehren muss, deren Kommandant eine mörderische Rechnung mit den Xenotauren offen hat.
Während die beiden Städter die Dorfbewohner unterstützen, muss sich innerhalb des Habitats Daniels einer politischen Konfrontation stellen. Die EU möchte in London wieder Fuß fassen, was faktisch einer Entmachtung des Konzerns gleichkäme. Dabei zeigen die Politiker ein bemerkenswertes Interesse an den riesigen Bunkern unter der Stadt und senden Major Keyner mit einem kleinen Team aus, diese Anlagen zu inspizieren.
Da der Soldat jedoch scheitert, schickt CEENEL – quasi als Goodwill-Signal – einige Männer und den zwischenzeitlich zurückgekehrten Jon Zaati in den Untergrund, weil dessen „Gunslinger“-Fähigkeiten ihn mit dem Schrecken, der augenscheinlich in dem unterirdischen Labyrinth haust, eher fertig werden lassen sollten.
Juliette hingegen, deren aeronautische Talente in den Katakomben und Gängen nicht wirklich von Nutzen sind, erhält von Daniels den Auftrag, die politische Lage in Prag zu sondieren, denn der Konzern plant, seine Zentrale von London in das tschechische Habitat zu verlegen. Schnell erweist sich Prag als wesentlich heißeres Pflaster als London. Angesichts instabiler Machtverhältnisse und zahlreicher Interessengruppen muss Juliette mehr als nur ihre hübschen Augen zum Einsatz bringen … und auch an Jons Kriecherei ist mehr dran, als auf den ersten Blick scheint.
Obwohl „Varianten“ als Sammelausgabe dreier Heft-Romane erschienen ist und daher fast zwangsläufig Brüche in der Geschichte auftauchen, weil sich der Erzähl-Rhythmus an einem 70-Seiten- und eben nicht an den 220-Seiten-Format orientiert, beeinträchtigt das den Lesefluss überraschend wenig. Allenfalls zwischen „Die Herde“ und „Sprecher der Anderen“ ist der Übergang zunächst etwas holperig. Doch Hoyers lebendiger, angenehm zu lesender Stil und die schließlich doch deutlichen Verbindungen zwischen den beiden Teilen, lassen dieses schnell in Vergessenheit geraten.
Wie nicht anders zu erwarten, liegt der Schwerpunkt der Bände auf der Einführung der Protagonisten, dem Aufbau des Spielfeldes und dem Vorbereiten erster Konflikte, wobei der Leser allerdings wenig Konkretes über die Welt des Jahres 2099 erfährt. Weder erhält er tiefere Einblicke in das Leben der Durchschnittsmenschen oder den gesamtgesellschaftlichen Kontext, noch spielen – mit Ausnahme der sporadisch auftauchenden Synorgs (einer Robocop-Light-Version) – originelle (Hard-)SF- und/oder Horror-Elemente in diesem Stadium der Geschichte eine bedeutende Rolle. Dadurch und aufgrund einiger kleinerer Längen im Mittelteil wirkt „Varianten“ zwar recht konventionell und stellenweise etwas altbacken, jedoch wiegen die sympathischen, gut gezeichneten Charaktere, die lockeren Dialoge und nicht zuletzt das interessante Grundkonzept diesen Mangel fast vollständig auf.
Auch wenn die Serie auf einem Post-Doomsday-Szenario basiert, so ist das Buch weit davon entfernt, ein Endzeitroman zu sein. Der Leser hat zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dem Todeskampf einer dem Untergang geweihten Zivilisation beizuwohnen, sondern, da der Autor eben nicht auf die Düster-Depri-Schiene setzt, den Beginn einer neuen Weltordnung mitzuerleben, wobei deren Entwicklungsrichtung – Utopia oder Dystopia – noch offen ist.
Fazit: Sympathische Charaktere, ein interessanter Background mit viel Potenzial für spannende Abenteuer und ein angenehm zu lesender Stil machen „Varianten“ – trotz kleiner Abzüge in der B-Note – zu einem rundherum empfehlenswerten Lesespaß.
http://www.atlantis-verlag.de/
© _Frank Drehmel_
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Genehmigung unseres Partnermagazins [X-Zine]http://www.x-zine.de/ veröffentlicht.|
Nachdem Neil Gaiman sich schon mit seinem Vorgängerroman [„American Gods“ 1396 über das Leben der alten Götter in der modernen Welt ausgelassen hat, knüpft er inhaltlich mit seinem aktuellen Roman „Anansi Boys“ an diesen Themenkomplex an, wenngleich die Geschichte eine komplett eigenständige ist, die nicht die Kenntnis des Vorgängeromans erfordert.
Während der Leser in „American Gods“ zugesehen hat, wie der mythische Allvater Odin die alten Götter um sich geschart hat, um mit ihnen zusammen in einer letzten großen Schlacht gegen die Götter der Moderne (Fernsehen, Internet und Co.) anzutreten, steht diesmal vor allem eine Gottheit im Mittelpunkt: der afrikanische Spinnengott Anansi, bzw. dessen beiden Söhne Fat Charlie und Spider.
Alles beginnt damit, dass der große Anansi eines Abends auf einer Karaokebühne tot umfällt und damit seinem Sohn Charles (der immer nur Fat Charlie gerufen wird) das Leben schwer macht. Bei Anansis Beerdigung erfährt Charlie, dass sein Vater ein Gott war und er einen Bruder namens Spider hat, der im Gegensatz zu ihm alle göttlichen Eigenschaften des Vaters geerbt hat.
Als Spider kurz darauf Charlie besucht, gerät dessen Leben aus den Fugen. Spider nistet sich bei Charlie ein und bringt alles durcheinander, woraufhin Charlie seinen Job verliert, von der Polizei verhaftet und von seiner Verlobten abserviert wird. Für Charlie ist das zu viel und er will Spider schnellstmöglich loswerden. Doch wie wird man einen lästigen Gott los? Charlie setzt alle möglichen Hebel in Bewegung, was eine ganze Kette von Ereignissen auslöst, deren Ende nicht abzusehen ist …
Neil Gaiman selbst beschreibt „Anansi Boys“ als „Horror-Thriller-Geister-Romantik-Comedy-Familien-Epos“ und das ist trotz des sich hier offenbarenden, etwas obskur anmutenden Genremixes schon eine ausgesprochen treffende Umschreibung. „Anansi Boys“ ist wie so oft bei Gaiman ein Werk der so genannten „Urban Fantasy“, ein Fantasy-Roman, der im Hier und Jetzt spielt, mitten in unserer Realität.
Fat Charlie weiß nichts von Göttern und hat bis zum Tag der Beerdigung seines Vaters auch nicht gewusst, dass sie Teil der Realität sind. Charlie führt ein überaus geregeltes Leben. Er hat eine Verlobte, die er zu heiraten gedenkt. Sein Job als Buchhalter ist eher langweilig und sein Leben verläuft weitestgehend unspektakulär. Das ändert sich schlagartig, als Spider plötzlich vor seiner Tür steht. Mit Spiders Auftreten entwickelt der Plot zunehmend Tempo, Witz und Spannung. Spider stiftet Chaos in Fat Charlies Leben und sorgt damit auch in der Geschichte für so manche unerwartete Wendung.
Das, was sich aus diesen ganzen Verwicklungen dann im Laufe des Romans ergibt, ist zwar nicht unbedingt überraschend und geschieht vor allem zum Finale hin unter inflationärer Verwendung des Faktors Zufalls, aber das mag man Neil Gaiman im Grunde gar nicht übel nehmen. Er konstruiert eine so unterhaltsame und sympathische Geschichte mit so interessanten Figuren, dass so manche Zufälligkeit eigentlich keine störende Rolle spielt.
Zudem lässt sich nach „American Gods“ wieder eine eindeutige qualitative Steigerung feststellen. Krankte „American Gods“ noch an seinem voluminösen Umfang und schien Gaiman sich gerade bei den Nebensträngen der Handlung hier und da zu verzetteln, so jongliert er bei „Anansi Boys“ gekonnt mit den unterschiedlichen Figuren und Handlungsebenen. Der Plot ist straffer und gradliniger, als es noch bei „American Gods“ der Fall war. Wer dort noch so manche Länge im Plot kritisieren mochte, darf sich bei „Anansi Boys“ wieder auf einen äußerst unterhaltsamen und flotten Gaiman-Roman freuen.
Natürlich dürfte Neil Gaiman wieder vorrangig eine Fantasy-Leserschaft anziehen, dennoch spielt er erneut so schön an den Grenzen des Genres, dass „Anansi Boys“ sicherlich auch darüber hinaus seine Leser finden wird. Nicht umsonst hat das Buch es auf Platz 1 der New-York-Times-Bestsellerliste geschafft. Es ist keine lupenreine Fantasy, die Gaiman mit „Anansi Boys“ abliefert. Er blickt über die Grenzen des Genres hinaus und würzt seinen Roman gleichermaßen mit Belletristik-, Thriller- und humoristischen Elementen. Gaiman versteht sich darauf, diese so unterschiedlichen Komponenten wohldosiert zu einem großen Ganzen zusammenzufügen. Trotz des Genremixes ist „Anansi Boys“ ein Roman aus einem Guss.
Erzählerisch ist es Neil Gaiman also nach dem etwas schwächeren „American Gods“ gelungen, ein absolut überzeugendes Werk abzuliefern. Mit Wortwitz erzählt er seine Geschichte, lässt seine sympathischen Hauptfiguren agieren und die Bösewichte intrigieren und lässt dabei so manchen schrägen Einfall einfließen. Damit schafft er einen Plot, der in gleichem Maße unterhaltsam wie spannend ist. „Anansi Boys“ wird dadurch zu einem Buch, das man eher widerwillig aus der Hand legen mag und bei dessen Lektüre die Zeit wie im Flug vergeht. Dass Gaiman für „Anansi Boys“ mit dem |British Fantasy Award| 2006 für den besten Fantasy-Roman ausgezeichnet wurde, ist durchaus verdient.
Bleibt unterm Strich also nur Lob für Neil Gaimans aktuellen Roman. Schräge Ideen hatte er schon immer, aber mittlerweile hat er sich auch als Erzähler zu einem echten Könner entwickelt. „Anansi Boys“ ist ein fein durchkomponierter Roman, der hochgradig unterhaltsam, witzig und spannend ist. Für Gaiman-Fans und Freunde der „Urban Fantasy“ ohnehin Pflichtlektüre, aber auch für Neueinsteiger in Sachen Neil Gaiman ein feiner Leckerbissen, der Lust auf mehr macht.
http://www.neilgaiman.de/
http://www.heyne.de
_Neil Gaiman bei |Buchwurm.info|:_
[„American Gods“ 1396
[„Sternwanderer“ 3495
[„Sandman: Ewige Nächte“ 3498
[„Die Wölfe in den Wänden“ 1756
[„Coraline – Gefangen hinter dem Spiegel“ 1581
[„Keine Panik! – Mit Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis“ 1363
[„Die Messerkönigin“ 1146
[„Verlassene Stätten“ 2522 (Die Bücher der Magie, Band 5)
[„Abrechnungen“ 2607 (Die Bücher der Magie, Band 6)
_Handlung_
Der Ritter Yvon und die Amme Xaragitte werden aus der belagerten Burg Lord Gruethrists geschickt, um das Baby ihres Herrschers, dessen Sohn Claye, vor den Belagerern in Sicherheit zu bringen. Auf der Flucht sind sie gezwungen, unter dem Heerbanner des verfeindeten Baron Culufres zu reisen. Als sie aber erfahren, dass ihr Ziel auch das Ziel der Angreifer ist, müssen sie ihre Pläne ändern und verstecken sich in den Bergen.
Dort fällt das Kind in die Hände der Trollin Windy und ihres Gefährten Ambrosius. Da Windys Kind gerade verstorben ist beschließt sie, das Baby als ihr eigenes großzuziehen. Dies stößt ihrem Partner und ihrer Sippe sauer auf, und Claye bekommt den Namen Made verpasst.
Die Jahre vergehen und Made sieht sich immer wieder Anfeindungen der anderen Trolle ausgesetzt. Also beschließt er, diesen den Rücken zu kehren und zu den Menschen zu gehen, um ein Weibchen zu finden. Doch die Gesellschaft der Trolle unterscheidet sich gänzlich von jener der Menschen und Made wird in einen Krieg hineingezogen, ohne zu wissen, was das eigentlich ist.
_Der Autor_
Charles Coleman Finlay lebt mit seiner Familie in Columbus, Ohio, wo er für das John Glenn Institute arbeitet. Seine Erzählungen erscheinen seit 2001 regelmäßig im |Magazine of Fantasy & Science Fiction| und wurden in zahlreichen „Best-of“-Anthologien abgedruckt. Einige standen zudem auf den Auswahllisten mehrerer Literaturpreise des Genres. Unter dem Titel „Wild Things“ ist ein Band mit Kurzgeschichten von Coleman Finlay erschienen. „Der verlorene Troll“ ist sein Debütroman.
_Mein Eindruck_
Obwohl „Der verlorene Troll“ beileibe kein schlechtes Debüt ist, hinterlässt er nach der Lektüre doch sehr zwiespältige Gefühle, da das Werk teilweise unter großen Qualitätsschwankungen leidet.
Aber widmen wir uns zuerst den positiven Aspekten. Finlay ist es gekonnt gelungen, Trolle zu erschaffen, die sowohl menschliche als auch tierische Züge in sich vereinen. Dies resultiert daraus, dass er die „klassischen“ Trolle mit einem starken Demokratiesinn ausstattet und sich bei ihrem sonstigen Verhalten und ihren Gesten an Primaten orientiert hat, wobei hier wohl besonders Gorillas Paten gestanden haben dürften. Nicht nur deswegen erinnert der ganze Stoff an „Tarzan“, die von Edgar Rice Burroughs erdachte Figur, die erstmals 1914 in Buchform erschien. Dadurch bedient sich Finlay ebenfalls der literarischen Tradition vom Helden, der von Tieren aufgezogen wurde, welcher neben „Tarzan“ etwa Mogli aus „Das Dschungelbuch“ von Rudyard Kipling oder „Romulus und Remus“, die legendären Gründer von Rom, die von einer Wölfin aufgezogen wurden, angehören.
Dieses altbekannte Motiv setzt er in einen Fantasy-Kontext und fertig ist „Der verlorene Troll“. Die Welt, die Finlay für seinen Roman erdacht hat, erinnert mich ein wenig an das von Robert E. Howard („Conan“) erdachte Hyperboreanische Zeitalter, gemischt mit einem Schuss nordamerikanischer, sprich indianischer Mythologie. Diese Mischung ist ihm vortrefflich gelungen, denn die verschiedenen Aspekte verbindet er geschickt zu einem sehr ansprechenden Gesamtbild.
Der Charakter von Made besticht einerseits durch seinen tierischen Habitus, aber auch durch seine sehr moderne Denkweise, was sein Verhalten zu Krieg und zur Natur betrifft. Finlay hat damit seiner Hauptfigur den Pathos des edlen Wilden verpasst, der diesem recht gut steht. Doch auch die Einfachheit seiner tierischen Erziehung bringt er gut zur Geltung. Als Beispiel hierfür ist besonders Mades erster Versuch, ein Menschenweibchen für sich zu gewinnen, geeignet. Man kann sich ausmalen, dass ein trollisches Werberitual nicht unbedingt gut bei der durchschnittlichen Frau ankommt. Ebenso sind die Verständnisprobleme und die daraus resultierenden Missverständnisse, die manchmal amüsant aber manchmal auch sehr gefährlich sind, sehr schön dargestellt. Made wird dabei nicht als Klischeewilder oder Dummkopf dargestellt, sondern Finlay erreicht mit dessen Darstellung vielmehr die Entlarvung von Widersprüchen und Kuriositäten im täglichen Sprachgebrauch. Hier überzeugt er mit vielen originellen und witzigen Ideen. Sehr gut gefällt übrigens auch die Aufmachung des Buches, bei der das Coverbild von Thomas Thiemeyer („Medusa“, „Reptilia“, „Magma“) heraussticht.
Leider hat der Roman auch einige Schwächen. Zuallererst nimmt das erste Kapitel, in dem die Flucht Yvons und Xaragittes beschrieben wird, knapp ein Viertel des Buches ein. Dieser Teil ist zwar durchaus kurzweilig und interessant geschrieben, doch ist er eigentlich für die weitere Handlung der Geschichte ziemlich uninteressant. Negativ fällt hier auch das größtenteils nicht nachvollziehbare Verhalten der Amme Xaragitte auf, die dem Leser eigentlich durchgehend auf die Nerven geht, so dass man richtig froh ist, sie irgendwann loszusein.
Im darauf folgenden Kapitel ‚Ein Junge im Kreis von Wölfen‘, in dem sich Made dann bei den Trollen befindet, steigert sich Finlay allerdings erheblich und kann dort seine literarischen Stärken wie das Einfühlungsvermögen in seine Figuren und seinen Humor gut zur Geltung bringen. Leider ist dieser Teil des Buches wiederum viel zu kurz, was manchmal den Eindruck vermittelt, das Buch sei eine Aneinanderreihung von Novellen, zumal zwischen den Kapiteln teilweise Jahre vergehen.
Als sich Made dann zu den Menschen begibt und in den Krieges hineingezogen wird, werden Finlays Beschreibungen, gerade bei Kampfszenen, häufig schwer nachvollziehbar und sind oft verwirrend beschrieben, was den Lesefluss doch deutlich verlangsamt und den Leser quasi zum nochmaligen Nachlesen zwingt. Besonders sauer aufgestoßen ist mir die teilweise haarsträubende deutsche Übersetzung. Wenn aus Timerwolves und Direwolves (urzeitlicher |Canis dirus|, wörtl. „Schreckens- oder Düsterwölfe“) nach der Übersetzung Timberwölfe (Amerikanische Grauwölfe) und Direwölfe werden, kann das nicht Sinn der Sache sein.
_Fazit_
„Der verlorene Troll“ ist zwar ein durchwachsenes, aber trotzdem lesenswertes Romandebüt von Charles Coleman Finlay. Der Autor offenbart ein großes erzählerisches Talent, das Hoffnung macht, zeigt dies aber leider noch zu wenig. Um zu den etablierten Größen des Fantasy-Genres aufzusteigen, fehlt daher noch ein gutes Stück Weg.
|Originaltitel: The Prodigal Troll, PYR Prometheus Books, New York 2005
Aus dem Englischen von Anja Hansen-Schmidt
Klappenbroschur, 444 Seiten
ISBN: 978-3-608-93786-2|
http://www.hobbitpresse.de/
[„Die Nebelsängerin“ 635
[„Die Feuerpriesterin“ 2017
[„Der Schrei des Falken“ 2136
_Story_
Nach langer Zeit herrscht in Nymath wieder Frieden. Das Volk hat sich nach der letzten Schlacht mit den kriegerischen Uzoma versöhnt und betreibt mittlerweile sogar Handel mit den einstigen Feinden. Auch Ajana steht kurz davor, ihren persönlichen Frieden zu finden. Die Rückkehr in ihre Heimat steht kurz bevor, doch der Abschied aus Nymath und besonders die Trennung vom Falkner Keelin fällt ihr schwerer als erhofft.
Als die beiden schließlich einen furchtbaren Streit austragen, bereitet die Nebelsängerin jedoch zügig ihre Abreise vor. Geplagt von düsteren Visionen von ihrer zurückgelassenen Familie, will sie in den nächsten Tagen den Ulvar aufsuchen und mittels seiner magischen Kraft wieder in die alte Welt zurückkehren. Doch ihre Pläne werden auf grausame Weise durchkreuzt. Der Ulvar wird vollkommen zerstört und die Heimkehr nur noch durch das ferne Weltentor in Andaurien möglich.
Gemeinsam mit Abbas bricht sie zu einer weitere beschwerlichen Reise auf und wird ein weiteres Mal in tiefste Finsternis gerissen. In der Wüste Andauriens herrscht nämlich die totgeglaubte Feuerpriesterin Vhara, fest entschlossen, die alten Götter eines Tages doch noch nach Nymath zurückzubringen. Nun ist es an Ajana, die letzte Schlacht in der fremden Welt zu schlagen, Vhara endgültig in die Schranken zu weisen und die Rückkehr der alten Götterkräfte mit aller Macht zu verhindern. Andernfalls ist ihre Hoffnung auf eine künftige Heimkehr für immer zunichte.
_Meine Meinung_
Nun, um es gleich vorweg zu sagen: Von den bisherigen drei Romanen unter dem Serientitel |Das Erbe der Runen| (von denen dieser hier vermutlich auch der letzte ist) ist „Die Schattenweberin“ mit Abstand das beste Werk von Monika Felten. Eigentümlicherweise gelingt es ihr aber auch im Schlussepos ihrer Saga um die Nebelsängerin Ajana nicht, auch nur im Ansatz ihrer Kollegin Osanna Vaughn das Wasser zu reichen, deren zwischenzeitlich veröffentliche „Runen“-Romane „Der Schrei des Falken“ und „Im Auge des Falken“ im Vorbeigehen offenbarten, wie viel Potenzial in dieser Fantasy-Welt steckt, wie leichtfertig man es aber auch wieder verschenken kann, wenn man – wie Felten – nicht dauerhaft dazu imstande ist, eine derartige Story auch in einen mitreißendes, sphärisches Setting einzubetten.
Andererseits sind darauf bezogen aber zumindest in „Die Schattenweberin“ einige deutliche Fortschritte zu erkennen, was sicher auch darauf zurückzuführen ist, dass man mit der grundlegenden Thematik und den einschlägigen Protagonisten bereits vertraut ist und man überhaupt schon eine Beziehung zu Ajana, Keelin und Co. aufgebaut hat. Durch die Änderung der Umgebung – „Die Schattenweberin“ spielt hauptsächlich in Andaurien und kaum mehr in Nymath – öffnen sich währenddessen auch einige erfrischende Möglichkeiten, welche die Autorin weitestgehend nutzt, um das breits im zweiten Band angestaubte Szenario neu zu gestalten.
Allerdings besteht hierin leider auch wieder eine elementare Schwierigkeit, weil jeglicher Raum zur ausufernden Ausschmückung willkommen scheint und es nicht selten vorkommt, dass zu viele Nebensächlichkeiten die Handlung bevölkern. Ständig werden unbekannte Charaktere in den Strang aufgenommen, manche davon jedoch ohne besonderen Wert, und weil sich die Umgebung durch die zahlreichen Wendungen der Geschichte ebenfalls stetig verändert, ist es oftmals nicht wirklich leicht, Elementares und Belangloses zu differenzieren. Letztgenanntes tritt zwar vergleichsweise selten auf, doch in manchen Passagen, so stellt sich später heraus, werden Freiräume schon dafür verwendet, ein wenig von der Haupthandlung abzuschweifen. So viel zu den Rahmenbedingungen.
Rein inhaltlich ist „Die Schattenweberin“ indes ein Roman mit anständigem Potenzial und vielen interessanten, gut ausgeprägten Ideen. Zwar bleiben diverse Aspekte vorhersehbar, wie zum Beispiel die Entwicklung der Beziehung zwischen Ajana und Keelin sowie auch das durchaus spannend inszenierte Ende, aber schneller als noch zuvor ertappt man sich dieses Mal dabei, wie man mit den Protagonisten und ihrem individuellen Schicksal mitfiebert.
Die Hauptdarstellerin hat sich derweil zu einer echten Sympathieträgerin gemausert und trägt die erforderlichen Wesenszüge einer Fantasy-Heldin noch prägnanter in sich. Ihr Mut scheint ungebrochen, ihre Verzweiflung artet nie in Hoffnungslosigkeit aus, und durch ihre manchmal trotzige Haltung bewahrt sie sich ein angenehmes Stück Menschlichkeit. Auch die Darstellung des Bösen ist recht gut gelungen. Phrasen und Klischees sind weder in den Dialogen noch im erdachten Erscheinungsbild anzutreffen, was man aber auch direkt auf das gesamte Buch übertragen kann, welches sich diesbezüglich bis auf die eine oder andere berechnende Szene vornehm zurückhält.
Was am Ende bleibt, ist sicherlich Feltens bester Beitrag zu dieser Reihe und nach den eher bescheidenen vorherigen Episoden dennoch ein würdiger Abschluss einer inhaltlich interessanten, leider aber nicht immer bis ins letzte Detail durchdachten Fantasy-Geschichte. Wer der Autorin und ihren Figuren bis hierhin treu geblieben ist, wird also doch noch für manche Ungereimtheit entschädigt.
http://www.daserbederrunen.de/
http://www.piper-verlag.de/fantasy
Band 1: [„Schwarzer Montag“ 3719
Eigentlich hatte Arthur gedacht, dass er jetzt, wo er Herrn Montag besiegt und die Seuche gebannt hatte, für die nächsten Jahre Ruhe hätte. Aber schon am nächsten Morgen, der sinnigerweise ein Dienstag ist, klingelt das Telefon, welches das |Vermächtnis| ihm aufgedrängt hat! Arthurs Herrschaftsbereich, |Das Untere Haus|, ist sozusagen bankrott, und nun droht der Gläubiger, nicht nur das gesamte Vermögen des Unteren Hauses zu beschlagnahmen, sondern auch alles, dessen er in Arthurs Welt Herr werden kann, vornehmlich natürlich das Eigentum von Arthurs Familie. Und natürlich ist der Gläubiger kein anderer als der |Grimmige Dienstag|!
Arthur bleibt nichts anderes übrig als in |Das Haus| zurückzukehren. Doch das ist gar nicht so einfach. Nicht nur, dass Arthur angegriffen wird, kaum dass er die Nase aus der Tür gesteckt hat, er muss auch erst einmal einen Eingang finden, und das ohne die Hilfe des Uhrzeigers, den er dem |Vermächtnis| überlassen hat. Prompt erwischt er eine Einwegtür, die ihn genau da hinführt, wo er am allerwenigsten hin will …
_Dramatis personæ_
Arthurs Gegner ist diesmal etwas hartgesottener als im ersten Band. Während Herr Montag ein schlapper Faulpelz war, der die meisten Anstrengungen seinen Untergebenen überließ und nur dann selbst etwas tat, wenn es absolut unumgänglich war, ist Lord Dienstag ein höchst geschäftiger Kerl. Sein Herrschaftsgebiet hat er in jahrhundertelanger Arbeit nahezu komplett ausgehöhlt auf der Suche nach Nichts. Die Rohstoffe, Maschinen und Kunstwerke, die er daraus erschafft, verkauft er an die anderen Wochentage für gutes Geld oder Arbeitskräfte. Dienstag ist ein Sklaventreiber der übelsten Sorte. Gleichzeitig ist er ziemlich unfähig. Er kann nichts Neues erschaffen, nur bereits Existierendes kopieren, was ihn ziemlich wurmt. Umso gieriger rafft er alles an sich, was er erreichen kann.
Natürlich hat auch Lord Dienstag ein Stück des Vermächtnisses versteckt. Dieser zweite Vermächtnisteil in Gestalt eines Bären ist allerdings nicht so aktiv wie der erste, der sich selbst befreit hat. Einerseits ist er träge, andererseits feige. Entscheidungen zu treffen, ist nicht sein Ding, es sei denn, er ist nach allen Seiten abgesichert. Aber Risiko? Bloß nicht! Lieber geht die Welt unter! Abgesehen davon ist er ziemlich hochnäsig.
Der verbale Schlagabtausch zwischen dem Vermächtnisbären und Arthur samt Freunden ist wirklich hochamüsant zu lesen. Und auch sonst ist Garth Nix wieder einiges eingefallen. Flügel hatten wir ja bereits, nur handelt es sich diesmal um eine besondere Form, die ausschließlich aufsteigen kann, also auch nicht bremst, wenn man oben ist, was zu einigem Stress führt. Außerdem gibt es magische Saugnäpfe, eine verselbständigte Augenbraue, die zur haarigen Riesennacktschnecke geworden ist, einen glasummantelten Gefängnisturm mit Wetterhahn, eine Zahnschmerzen verursachende Harpune und eine Sammlung von Buddelschiffen, von denen eines ein Raumschiff ist, sowie ein paar neue Formen von Nichtlingen.
_Die Handlung_ ist diesmal allerdings nicht ganz so turbulent wie im ersten Band. Möglicherweise liegt das daran, dass der Leser sich inzwischen ein wenig auskennt, sodass Das Haus nicht mehr ganz so chaotisch wirkt wie zu Anfang. Auch Arthur kennt sich besser aus, hat weniger Fragen und weiß diesmal, wo er Antworten herbekommt. Andererseits hatte ich doch auch den Eindruck, dass diesmal alles ein wenig glatter ging als bisher. So kamen Susi und Arthur erstaunlich problemlos bis zur Spitze von Dienstags Turm. Da hätte ich mehr Schwierigkeiten erwartet, zumal im Prolog extra erwähnt wurde, wie gefährlich das Fliegen in den Fernen Weiten ist.
Dafür hat der Autor diesmal einen interessanten Ausblick auf die Fortsetzungen eröffnet. Die Tatsache, dass da irgendwo ein Nichtling herumkraucht, der zur Hälfte wie Arthur aussieht, birgt enorm viele Möglichkeiten für Verwicklungen und Verzwickungen, und außerdem würde ich allmählich doch gern erfahren, zu wem diese beiden besonders akkurat gekleideten Herren gehören, die in den Prologen beider Bände auftauchten, und was ihr Auftraggeber für ein Ziel verfolgt. Das alles natürlich zusätzlich zu der Tatsache, dass der nächste Wochentag zur Abwechslung eine Frau ist, deren Gebiet offenbar ein Meer ist! Welche Form wohl ihr Schlüssel besitzt? Klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend!
_Kurzum_: Ich habe auch den zweiten Band der |Schlüssel zum Königreich| mit dem gleichen Vergnügen gelesen wie den ersten. Und ich bin jetzt schon neugierig auf die Fortsetzung.
_Garth Nix_ ist gebürtiger Australier und war nach dem Studium in den verschiedensten Bereichen der Buchindustrie tätig, ehe er selbst zu schreiben begann. „Schwarzer Montag“ ist der erste Band des Zyklus |Keys to the Kingdom|, der im englischen Original inzwischen bis Band fünf gediehen ist. Außerdem stammt |Seventh Tower|, ein weiterer Jugendbuchzyklus, aus Nix‘ Feder sowie die Trilogie |Das alte Königreich|.
http://www.ehrenwirth.de/
|Siehe ergänzend dazu:|
[„Schwarzer Montag“ 3719 (Keys to the Kingdom 1)
[„Schwarzer Montag“ 3172 (Hörbuch)
[„Sabriel“ 1109 (Das alte Königreich 1)
[„Lirael“ 1140 (Das alte Königreich 2)
[„Abhorsen“ 1157 (Das alte Königreich 3)
_Story_
Um sein Land während der phyrexianischen Invasion zu schützen, war der Weltenwanderer Teferi gezwungen, seine Heimat zu destabilisieren. Doch sein Werk hinterließ schwerwiegende Folgen für ganz Dominaria. Die beiden verschobenen Kontinente Zhalfir und Shiv drohen nun, nach Dominaria zurückgeschoben zu werden und ganze Landmassen unter sich zu begraben. Und auch die allerorts entstandenen Zeitrisse scheinen auf Teferis Schutzmaßnahme zurückzuführen, so dass sich der große Magier alsbald zum Handeln gezwungen sieht.
Gemeinsam mit seiner Verbündeten Jhoira bricht er auf, um die Geheimnisse hinter den Zeitrissen zu ergründen, doch schon im Wolkenwald stößt er auf ersten Widerstand. Freyalise, eine konkurrierende Weltenwanderin, will sich seinen Plänen nicht anschließen und verwehrt ihre Hilfe. Lediglich mit größtem Geschickt gelingt es Teferi, sie für ihre Zwecke zu gewinnen, ebenso wie die keldonische Kriegerin Radha, die einen Pakt mit Teferi schließt und mehr oder weniger unfreiwillig seiner Reise folgt.
Mit einer Handvoll Gefährten nähert sich Teferi schließlich den merkwürdigen Phänomenen und bereitet sich auch schon auf die Rückkehr Shivs vor. Doch seine unwissenden Begleiter, die der Weltenwanderer nur bedingt über seine Pläne informiert hat, sind nicht bereit, ihrem Anführer ständig blind zu folgen. Die Erkundung Dominarias und die Vertreibung der finsteren Mächte werden für das Gespann immer dramatischer, denn letztendlich handelt es sich bei fast allen Verbündeten um sturköpfige Einzelgänger. Wird es Teferi nichtsdestotrotz gelingen, Dominaria vor der bevorstehenden Zerstörung durch die Zeitrisse und ihre Begründer zu beschützen?
_Meine Meinung_
Beinahe zeitgleich zur neuen Edition des „Magic: The Gathering“-Sammelkartenspiels erscheint nun auch der erste Teil des neuen Roman-Zyklus und begleitet damit die Ereignisse, die auch im Spiel thematisiert werden. Allerhand bekannte Gestalten tauchen wieder auf, was alleine deswegen schon nicht verwunderlich ist, weil die Handlung nach längerer Abstinenz wieder in Dominaria spielt. Man trifft auf den alten Haudegen Teferi und seine stetige Begleiterin Jhoira, bekommt es einmal mehr mit der sturen Freyalise zu tun, erfährt einiges über die Vergangenheit des Handlungsschauplatzes (unter anderem in einer kurzweiligen Zeitreise zur Mitte des Buches) und wird schlussendlich mit den Folgen der phyrexianischen Invasion konfrontiert.
Scott McGough, der ja im „Magic“-Kosmos längst kein Unbekannter mehr ist, bettet die neue Geschichte auch sofort in ein wirklich tolles Setting ein und beginnt die Story mit Teferis Ersuchen nach neuen Gefährten auch sehr vielversprechend. In Windeseile findet man Zugang zum Ausgangsszenario und den darin auftauchenden Helden, so dass bereits nach wenigen Seiten der Grundstein für einen spannenden Fantasy-Roman gelegt ist. Alles gut so weit?
Tja, leider verliert sich der Autor nach dem fulminanten Auftakt ganz schnell in einer allzu belanglosen Erzählung, die es irgendwie kaum vermag, überhaupt Akzente oder Highlights zu setzen, die als prägendes Element in den Gedanken haften bleiben. Teferis Reise ist während der gesamten Geschichte ein stetiger Fluss mit netten Erfahrungsberichten und einigen weniger interessanten Begegnungen, bei dem man aber nie den Eindruck bekommt, seine Erzählgeschwindigkeit könnte irgendwann mal plötzlich auf ein wünschenswertes Maß ansteigen. Selbst scheinbar unspektakuläre Ereignisse wie Teferis Auseinandersetzung mit Freyalise werden daher schon schnell zum Höhepunkt, während auf den ersten Blick Entscheidendes wie die zahlreichen Kämpfe mit den Gathanern, einem Drachen und später gegen die Orks und Goblins eher pflichtbewusst als ambitioniert wirken.
Selbiges gilt auch für die Darstellung von Teferis Kontrapart, der wilden Radha, die sich immerzu als Rebellin gibt, fast schon penetrant nervig gegen den Strom zu schwimmen versucht und dabei die Handlung ebenso wenig weiterbringt wie ihr ungeliebter Kollege, der Weltenwanderer.
Und so wartet der Leser schließlich, dass sich die Dinge irgendwie ergeben, ohne dass man überhaupt dazu angeregt wird, Erwartungen zu hegen oder allgemein mitzufiebern. Teferi wird’s schon richten, und wenn er schon in Bedrängnis gerät, dann gibt es dort immer noch die aus dem Hintergrund agierende Jhoira, die unbändige Radha oder einen ihrer anderen Verbündeten, welche die Kohlen aus dem Feuer holen werden. Das hört sich nun mit Sicherheit ziemlich platt und oberflächlich an, beschreibt aber ziemlich genau die Beziehung, die der Leser im Laufe des Romans zu den beteiligten Charakteren entwickelt.
Dass am Ende doch noch das Tempo angezogen wird, kauft man dem Autor dann auch nicht mehr ab. Zu widersprüchlich scheint die Entwicklung der Story, zu aufgesetzt das gute, aber unglaubwürdige Finale. Das Erwecken einzelner Nostalgiegefühle, weil man wieder auf bekannte Schauplätze und Figuren zurückgegriffen hat, ist somit der wohl einzig prägende Eindruck, den der ersten Band der „Zeitspirale“ hinterlassen hat. Und ob die Fortsetzung dieses vernichtende Urteil über den neuen Zyklus noch einmal wird geradebiegen können, darf man auch schon mal anzweifeln. Wenn nämlich so viel gute Ideen und das zweifellos hohe Potenzial einer Geschichte so leichtfertig verschenkt und zugunsten einer flachen, kaum spannenden Handlung geopfert werden, dann ist die Hoffnung, dass die Buchreihe auch nur annähernd mit dem brillanten Trading-Card-Äquivalent mithalten kann, äußerst gering. Wirklich schade!
http://www.paninicomics.de
http://www.magicthegathering.de/
http://www.universal-cards.com
http://www.wizards.com/
|Siehe ergänzend dazu:|
[Magic: The Gathering 9. Edition – Schnelleinstieg 3335
[Magic: The Gathering – Haupt-Set – Themendeck »Armee der Gerechtigkeit« 3337
[Magic: The Gathering – Haupt-Set – Themendeck »Schon wieder tot« 3370
[Magic: The Gathering – Haupt-Set – Themendeck »Luftige Höhen« 3591
[Magic: The Gathering – Haupt-Set – Themendeck »Welt in Flammen« 3592
[Magic: The Gathering – Zeitspirale – Themendeck »Remasuri-Entwicklung« 3371
[Magic: The Gathering – Zeitspirale – Themendeck »Kreuzritter der Hoffnung« 3372
[Magic: The Gathering – Zeitspirale – Themendeck »Pelzige Pilzwesen« 3667
[Magic: The Gathering – Zeitspirale – Themendeck »Realitätsbruch« 3670
[Outlaw 1864 (The Gathering: Kamigawa-Zyklus, Band 1)
[Der Ketzer 2645 (The Gathering: Kamigawa-Zyklus, Band 2)
[Die Hüterin 3207 (The Gathering: Kamigawa-Zyklus, Band 3)
[Die Monde von Mirrodin 2937 (Magic: The Gathering – Mirrodin #1)
Band 1: [„Der Hofmagier“ 3529
_Story_
Nach dem Tode Kaiser Retos wird dessen Sohn Hal Kaiser des Neuen Reiches. Gaius Cordovan Eslam Galotta bleibt auf Wunsch Retos Hofmagier und wichtiger Berater des neuen Kaisers. Schon bald offenbart sich, dass der verträumte und schwache Kaiser Hal eine Gefahr für das Kaiserreich ist, das Galotta am Bett des sterbenden Kaisers Reto zu beschützen schwor. Galotta entschließt sich somit, seine Forschungen zur Erschaffung einer mächtigen magischen Waffe verstärkt voranzutreiben.
Doch als die mächtige Magierin Nahema am Kaiserhofe auftaucht und ihre Prophezeiung verwirklicht sehen will, wendet sich das Blatt gegen Galotta. Vor dem versammelten Hofstaate überlistet und lächerlich gemacht, muss er schließlich vom Hofe fliehen und schwört Kaiser Hal blutige Rache.
„Der Feuertänzer“ ist der zweite Teil der Biographie aus dem Leben des G. C. E. Galotta.
_Meine Meinung_
Nachdem im ersten Band der Biographie Galottas, „Der Hofmagier“, die Figuren auf dem Brett verteilt und vorgestellt wurden, kommt es nun zur Verwebung der einzelnen Handlungsstränge und zur Eskalation der schwelenden Konflikte.
Alles beginnt mit dem Tode des alten Kaisers. Reto, der Galotta an den Hof holte und ihn protegierte, wird durch seinen Sohn Hal beerbt. Der ist allerdings ein genaues Gegenteil von Reto. War dieser noch ein gefürchteter Kämpfer und konsequenter Politiker, so interessiert es Hal eher, wie er an Ansehen beim Volke gewinnen kann, und er umgibt sich mit allerlei fragwürdigen Beratern.
Hier zeigt sich nun die große Stärke von Kathrin Ludwig und Mark Wachholz, nämlich die Zeichnung der Charaktere. Man kann sich sofort in die einzelnen Personen hineinversetzen und hat die Illusion, die Handlung hautnah mitzuerleben. Ein weiterer interessanter Aspekt, der sich schon beim „Hofmagier“ erkennen ließ, ist der, dass man die Charaktere auch einmal von einer anderen Seite kennen lernt. Sei es Kaiser Hal, der des Öfteren schon fast tragisch weltfremd wirkt, oder Answin von Rabenmund, der zwar sehr drastische Mittel anwendet, aber in der Hauptsache zum Wohle des Kaisereiches arbeitet.
Dies gilt natürlich auch und im Besonderen für den Protagonisten, G. C. E. Galotta. Man möchte schon beinahe Mitleid mit ihm haben, wie Stückchen für Stückchen seine Welt auseinanderbricht. Seine Liebschaft mit der Kaiserin geht in die Brüche, Saldor Foslarin verweist ihn der Weißen Gilde, und dann wird er schlussendlich zum „Feuertänzer“. Der Titel des Buches umschreibt in makaberer Weise das zentrale Handlungselement des Buches: den Scharlachkappentanz. Die Magierin Nahema bringt Galotta nach und nach dazu, ihre Prophezeiung ihn betreffend selbst zu erfüllen, wobei sie für ihre Rache an Galotta sogar Kaiser Hal einspannt.
Von diesem Zeitpunkt an wird der Niedergang des Proagonisten eindrucksvoll geschildert: die wispernden Stimmen, die ihn fortan begleiten, das schwarze Tier, das seine Töchter bei oder sogar in ihm sehen. Es bleibt hier der Phantasie des Lesers überlassen, ob er sich darunter das Schwarze Auge Galottas, die Weit Widerhallende Stimme oder die Dämonen, die langsam Besitz von ihm ergreifen, vorstellen möchte.
Ein weiterer Pluspunkt ist die Beschreibung der elfischen Ziehtöchter Galottas. Sie wirken hier im Gegensatz zum „Hofmagier“ mehr in die Handlung eingepasst und weniger austauschbar, sondern helfen entscheidend zur Charakterisierung des Magiers. Und formal gefallen die, ebenfalls im Vergleich zum „Hofmagier“, fehlenden Tippfehler.
_Fazit_
„Der Feuertänzer“ führt spannend und temporeich die Geschichte des G. C. E. Galotta fort. Das Buch gefällt durch sehr gelungene Chrakterisierungen der Personen und gelegentliche Déjà-vu-Erlebnisse aus der aventurischen Geschichte. Sehr empfehlenswert.
http://www.fanpro.com/
Eigentlich darf Arthur keinen Sport treiben, denn er ist Asthmatiker. Aber irgendwie kommt seine Erklärung beim Lehrer nicht ganz an, jedenfalls findet Arthur sich kurz darauf bei einem Geländelauf wieder. Und natürlich hat er binnen kurzem den erwarteten Anfall! Das heißt – nicht ganz …
Denn der seltsam gekleidete Mann, der da plötzlich auftaucht, geschoben in einem seltsamen Vehikel von einem noch seltsameren zweiten Mann, drückt ihm einen scharfen Gegenstand in die Hand, der aussieht wie ein Uhrenzeiger, und erwartet nun offenbar, dass Arthur innerhalb der nächsten paar Sekunden den Löffel abgibt! Als Arthur ihm den Gefallen nicht tut, geraten sich der Mann und sein Schiebediener in die Haare, und als Ende vom Lied hat Arthur plötzlich nicht nur den seltsamen Zeiger in der Hand, sondern auch noch ein grün eingebundenes Notizbuch!
Seither scheint er eine Menge Dinge wahrzunehmen, die äußerst seltsam sind, und die außer ihm offenbar niemand sehen kann. Und zu allem Übel gehört zu diesen seltsamen Dingen auch eine Horde von Verfolgern, die den Zeiger und das Notizbuch unter allen Umständen zurückhaben wollen …
_Der Held dieser Geschichte_ hat mit der Legende des Helden schlechthin zwar den Namen Arthur gemein, ansonsten jedoch ist er in jeder Hinsicht durchschnittlich. Er will weder die Welt retten noch die Schöpfung wieder in Ordnung bringen. Sein alleiniges Ziel ist es, die Seuche loszuwerden, die seine Verfolger auf der Suche nach ihm in seine Welt eingeschleppt haben! Und obwohl er anfangs noch eine Menge Hilfe braucht, zeigt er sich der Sache schon bald gewachsen. Sehr zum Leidwesen seiner Ratgeber …
Der erste wird allgemein nur das Vermächtnis genannt. Genau genommen ist es nur eines von sieben Fragmenten eines Papiers, aber es besitzt ein ziemliches Eigenleben. Es ist nicht nur irgendwie aus seinem Gefängnis ausgebrochen, es kann auch andere beeinflussen, und das tut es ziemlich vehement. Denn es will unbedingt die übrigen sechs Fragmente befreien, damit |Das Vermächtnis| als solches eintreten kann. In der Verfolgung dieses Zieles ist es ziemlich rigoros, und auch nicht immer ganz ehrlich. Schließlich ist es auf Arthur angewiesen, der allerdings nicht vorhat, sein Leben der Erfüllung des Vermächtnisses zu widmen …
Der andere ist Montags Abenddämmerung, dem zu trauen allerdings riskant erscheint. Denn Montag ist eigentlich Arthurs Gegner, der Mann, der unbedingt den Zeiger zurückhaben will! Und außerdem hat Abenddämmerung kein Wort über seine eigenen Ziele verloren, während man vom Vermächtnis wenigstens weiß, was es will!
Die einzige Zuverlässige scheint Susi Türkisblau zu sein, eine kleine unbedeutende Arbeiterin in dieser befremdlichen Welt, in die Arthur da geraten ist. Sie kennt sich aus, führt Arthur durch das Labyrinth von Gängen und Aufzügen und unterstützt ihn in jeder Hinsicht. Und dazu gehört eine ganze Menge Mut und Zähigkeit.
Nix hat alle seine Charaktere, ob Haupt- oder Nebenrolle, treffend und klar skizziert, ohne dabei besonders ins Detail zu gehen. Herausgekommen sind Figuren von nicht gerade überwältigender Tiefe, aber dennoch sympatisch und frei von Stereotypen.
_Das Hauptaugenmerk liegt auf der Handlung_ und der Welt, in der sie spielt. Und da ist einiges geboten:
Der Uhrzeiger, der natürlich magisch ist, lindert nicht nur Arthurs Asthma, er führt ihn letztlich auch in eine chaotische und äußerst turbulente Paralleldimension: ein überdimensionales Büro, das entweder zu einem Konzern mit enormem Wasserkopf oder zu einem Amt vom Umfang der UNO oder größer gehören könnte und dementsprechend jede Menge Stoff für Seitenhiebe gegen Bürokratie und Pedanterie bietet.
Gleichzeitig wird hier mit den Dimensionen gespielt. So steht |Das Haus|, der Ort, an den der Uhrzeiger Arthur letztlich führt, mitten in einem Wohnblock in Arthurs Stadt, und Arthurs Gegner Montag trägt seinen Namen nicht von ungefähr. Der Alte, ein mächtiger Riese, ist an eine Uhr gekettet, und ein Raum voller Uhren führt Arthur auch zurück in seine Welt. Die |Unwahrscheinliche Treppe| schließlich setzt dem Ganzen die Krone auf.
In diese Umgebung, in der die Grenzen zwischen Raum und Zeit verwischen, hat Nix eine Menge magischer Artefakte gesetzt, angefangen vom Vermächtnis selbst, das ganz offensichtlich magisch ist und vorerst einen grünen Jadefrosch belebt, über den Uhrzeiger, der eigentlich einer von sieben Schlüsseln ist und öffnen und schließen, binden und lösen kann, bis hin zu Aufzügen, die mal groß, mal klein sind, und einer Einbahnbrücke in Form eines selbstauflösenden Spinnenfadens.
Belebt wird das Ganze von Wesen, die nicht sterblich sind und nur ungerne etwas an dem derzeitigen chaotischen Zustand ändern möchten, aus welchen Gründen auch immer. Sie gebieten sowohl über die Bürokraten und kleinen Arbeiter, wie Susi einer ist, als auch über eine ziemlich hirnlose Art von Polizisten und Wachhunden.
Und zu guter Letzt gibt es noch die Nichtlinge, boshafte Kreaturen, die aus irgendwelchen Gründen immer wieder mal auftauchen und andere angreifen.
_Ganz klar_, dass es in diesem Wirrwarr keine klare Linie geben kann außer der, dass Arthur alle Nase lang in Schwierigkeiten gerät. Egal, wohin er kommt, er wird verfolgt, hängt die Verfolger ab, wird eingeholt, mogelt sich raus, wird doch geschnappt, kommt wieder frei … Turbulent geht es zu in diesem Zyklus! Und natürlich denkt der Autor gar nicht daran, Arthurs Fragen alle sofort zu beantworten.
Heraus kam eine rasante Mischung aus Rätselei, Verfolgungsjagd, Magie und Humor, die den Leser kaum zu Atem kommen lässt. Und natürlich ist klar, dass am Ende des Buches der Montag zwar um ist, aber unmittelbar von einem Dienstag gefolgt wird! Nach dem, was Garth Nix für den Anfang bereits alles eingefallen ist, dürfte der Folgeband noch eine Menge skurriler Überraschungen bereithalten!
_Garth Nix_ ist gebürtiger Australier und war nach dem Studium in den verschiedensten Bereichen der Buchindustrie tätig, ehe er selbst zu schreiben begann. „Schwarzer Montag“ ist der erste Band des Zyklus |Keys to the Kingdom|, der im englischen Original inzwischen bis Band fünf gediehen ist. Außerdem stammt |Seventh Tower|, ein weiterer Jugendbuchzyklus, aus Nix‘ Feder sowie die Trilogie |Das alte Königreich|.
http://www.ehrenwirth.de
|Siehe ergänzend dazu:|
[„Schwarzer Montag“ 3172 (Hörbuch)
[„Sabriel“ 1109 (Das alte Königreich 1)
[„Lirael“ 1140 (Das alte Königreich 2)
[„Abhorsen“ 1157 (Das alte Königreich 3)

Fredric Brown – Die grünen Teufel vom Mars weiterlesen
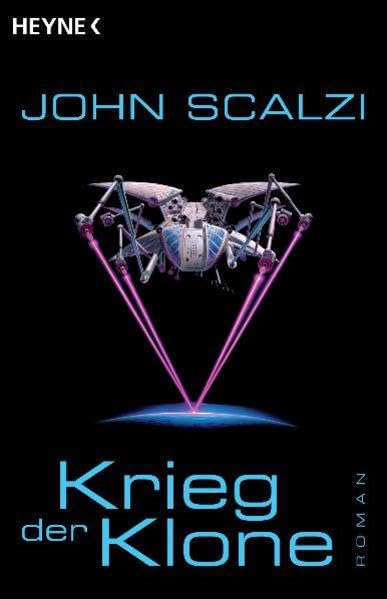
John Scalzi – Krieg der Klone weiterlesen
Band 1: [„Totentaucher“ 3348
_Story_
Noch immer ist Atlan den Hintermännern des Mords an seinen Doppelgänger auf der Spur und sucht dabei weitere Informationen über das Volk der Tyarez. Die USO stellt ihm mit Ohm Santarin hierzu einen erfahrenen Agenten zur Seite, der gerade erst Opfer einer Hinterlist geworden ist, die offenbar vom verschwundenen und längst für tot erklärten Ex-Thakan Flakio Tasamur inszeniert wurde. Gemeinsam begeben sich Santarin und Atlan mit einem gemieteten Gleiter auf den Weg zum Volk da Onur, dessen Vertreter selber den Doppelgänger Atlans gemimt hat, der vor wenigen Wochen tot aufgefunden wurde.
Doch auf dem Weg dorthin gerät das Duo in einen plötzlichen Wirbelsturm und stürzt ab. Stunden später wachen sie in einem berüchtigten Wüstengefängnis wieder auf, in dem ein fehlerhafter Roboter das Regiment übernommen hat und mit Willkür über die sehr unterschiedlichen Gruppen der Gefangenen herrscht. Auch Tsamur ist dort, in der Schweißöde, gefangen und führt eine interne Rebellentruppe an, mit denen Atlan alsbald Kontakt knüpft. Tatsächlich gelingt es mit einer List und den Teleportationskräften des ehemaligen Thakan, wieder auszubrechen und den Weg zum Volk da Onur fortzusetzen. Doch dort angekommen, erweist sich Tasamur alles andere als vertrauenswürdig. Es kommt zum folgenschweren Eklat, infolge dessen der Patriarch tödlich verletzt wird. Doch dabei kann ausgerechnet nur er Atlans Fragen beantworten.
_Meine Meinung_
Im zweiten Teil der Lepso-Trilogie kommt ein neuer Autor zum Zuge und löst den eher schwächelnden Wim Vandemaan damit an seiner Position ab. Und dieser Wechsel hat der Mini-Serie merklich gut getan, denn Christian Montillon kommt in seinen Schilderungen innerhalb der Weltraumsaga wesentlich schneller auf den Punkt und hat es somit auch nicht nötig, inhaltliche Unzulänglichkeiten hinter einem allzu komplexen Aufbau zu verstecken – was ja im ersten Band noch ein wesentlicher Kritikpunkt war.
Dennoch ist auch Band 2 nicht makellos. Es ist zwar von enormem Vorteil, dass die Geschichte linear und an gewissen Stellen auch sehr flott vorangetrieben wird, aber dabei hält sich auch Montillon an vielen Nebenschauplätzen auf und schmückt diese in einem Ausmaß aus, welches das bisweilen wirklich rasante Erzähltempo wieder gehörig eindämmt. Die Szenerie in der Schweißöde zum Beispiel hätte man eventuell auch etwas kürzer fassen können, weil sie bis auf die Begegnung mit Flakio Tasamakur keine wesentlichen Inhalte mehr für den Hauptplot bereithält. Stattdessen werden hier diverse moralische Zwiste ausgetragen, deren Erscheinungen indes nie so recht berühren und für den weiteren Verlauf – so hart das auch klingen mag – nicht mehr als schmückendes, grundsätzlich belangloses Beiwerk sind. Von der freizügigen Verwendung einiger Klischees mal ganz abgesehen.
Andererseits erfreut es, dass man der Story mittlerweile ohne weiteres leicht folgen kann. Der Autor hat einen wesentlichen sympathischeren Schreibstil als kürzlich noch Vandemaan, wirkt aber keinesfalls plump oder oberflächlich. Man hat jederzeit das aktuelle Geschehen im Blick und bekommt bei der Ergründung einzelner Mysterien keine Steine in den Weg gelegt. Gerade dies war im Auftaktband noch ganz anders und mitunter auch der Schwerpunkt der Kritik, nachdem die Geschichte infolge dessen gehörig gelähmt wurde.
Montillon hat nun die Weichen für ein rasantes Finale gestellt, gerade nach den spannenden Ereignissen der letzten Seiten von „Die acht Namenlosen“. Endlich erfährt man, was es mit dem ominösen Titel auf sich hat und wer sich hinter dieser Kleingruppe verbirgt. Ebenfalls dringen Atlan und Co. tiefer in die Geheimnisse der Tyarez ein, erfahren mehr über die Historie des Stammes der da Onur und bekommen letztendlich zumindest eine Idee, warum ausgerechnet der Lordadmiral höchstpersönlich in einen verzwickten Völkerzwist geraten ist, von dem Atlan bis dato nicht einmal die leiseste Ahnung hatte.
Kurz gefasst: Es geht aufwärts mit dieser Trilogie; in Sachen Spannung, Aufbau und Inhalt hat Christian Montillon mit dem zweiten Band wieder einiges an verlorenem Boden gutmachen können und zumindest teilweise Entschädigung für den enttäuschenden Auftakt erbracht. Von Begriffen wie Science-Ficion-Hochgenuss möchte ich in diesem Zusammenhang zwar absehen, weil auch „Die acht Namenlosen“ noch mit diversen Längen und Schönheitsfehlern gespickt wurde, aber gerade für diejenigen, die nach dem ersten Roman der „Lepso-Trilogie“ schon das Handtuch geschmissen haben, hat der Autor trotz allem genügend Überzeugungsarbeit geleistet, um die Treue an der neuen Serie aufrechtzuerhalten – was man insgesamt betrachtet dann auch als Erfolg werten darf.
http://www.fanpro.com
http://www.perryrhodan.net/
Im Alter von 75 Jahren meldet sich John Perry bei der KVA (Koloniale Verteidigungsarmee). Seine Frau ist tot, und auch John Perry fühlt, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Doch die Armee bietet Senioren eine einmalige Chance: Eine vollständige Verjüngung – für zehn Jahre Militärdienst und der Auflage, nie wieder auf die Erde zurückkehren zu dürfen. Strenge Quarantänegesetze sollen die Urheimat der Menschheit schützen, für ihre Dienste erhalten die Soldaten der KVA ein Stück Land auf einer der hart umkämpfen Kolonialwelten. Denn die Menschheit ist nicht allein im Weltall, blutige Kriege sind an der Tagesordnung.
_Der Autor_
John Scalzi (* 10.05.1969, Kalifornien) begann seine Karriere in der Blogger-Szene. „Krieg der Klone“ (im Original: „Old Man’s War“) erschien bereits 2002 in Fortsetzungen im Blog seiner Website, bis Patrick Nielsen Hayden, Senior Editor von |Tor Books|, auf ihn aufmerksam wurde. Womit dieser ein ausgezeichnetes Gespür bewiesen hat: Scalzis Debüt war gleichzeitig auch sein Durchbruch, das Buch verkaufte sich in den USA ausgezeichnet und kam bei den Lesern gut an. Als Sahnehäubchen wurde es 2006 mit dem |John W. Campbell Award| ausgezeichnet und für den |Hugo Award| nominiert. Scalzis „Krieg der Klone“ musste gegen Werke etablierter Autoren wie George R. R. Martin, Charles Stross und Ken MacLeod antreten, und sich nur dem überragenden [Spin 2703 von Robert Charles Wilson geschlagen geben.
_Mehr als eine Hommage an „Starship Troopers“ und „Der ewige Krieg“_
„Krieg der Klone“ ist Military Science Fiction, keine Frage. Das Szenario ist stark an Robert A. Heinleins „Starship Troopers“ angelehnt, doch Scalzi wäre ein Narr, wenn er dessen Ideologie und Pathos im Jahr 2007 reanimieren würde. Stattdessen positioniert er sich zwischen Heinlein und dem oft als Anti-Starship-Troopers gelesenen [„Der ewige Krieg“ 488 von Joe Haldeman.
Derber, sarkastischer Humor und John Perry als sympathischer, menschlicher Held geben dem Roman eine eigene Note. Wo Heinlein im Vorwort von [„Starship Troopers“ 495 das Hohelied auf Technologie und Fortschritt in Form des Kampfanzugs der Mobilen Infanterie singt, Haldeman die Gefahren moderner Technologien heraufbeschwört, zeigt sich in „Krieg der Klone“ der spezielle Scalzi-Humor. Die alten Männer, die dem Tod von der Schippe springen wollen, wissen nicht, worauf sie sich eingelassen haben. Ihr neuer Körper ist ein geklonter und verbesserter Alien-Mensch-Hybrid ihrer selbst, mit grüner Haut, fähig zur Photosynthese, Katzenaugen für Nachtsicht und nanotechnischem SmartBlood anstelle echten Blutes. Der Schock ist groß, aber auch die Freude: Denn der neue Körper ist jung, stark und schön. Hier neigt der Roman eher in Richtung von Haldemans „Der ewige Krieg“, denn natürlich wollen die älteren Herren und Damen ihre neuen Körper recht bald ausgiebig „testen“ …
Die Ausbildungssituation ist ähnlich wie in „Starship Troopers“, allerdings ohne jeglichen ideologischen Ballast. Ähnlich wie Johnnie Rico macht auch John Perry eine Blitzkarriere, dennoch gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den beiden. Rico akzeptiert im Laufe seiner Karriere immer mehr das System, in dem er dient und erzogen wird, Perry hingegen zweifelt immer mehr an den hehren Zielen der KVA, je länger er in ihren Kriegen kämpft. So auch an den Quarantänegesetzen; sie scheinen eher dazu zu dienen, die Menschen der Erde als unerschöpflichen Rekrutierungspool in Unwissenheit zu halten und auszubeuten. Auch die Kriegsziele werden angezweifelt. Oft findet sich die KVA in der Rolle des Aggressors; Strafexpeditionen gegen nur fingerlange Aliens, bei denen die Soldaten wie Godzilla mit bloßen Stiefeltritten ihre Städte zerstören, sollen hier als Beispiel dienen.
Bei der Charakterisierung der Aliens ist Scalzi alles andere als homogen. So bedient er sich bei Stereotypen für einige eher billige Lacher, sein Humor ist leider oft doch etwas zu plump. Hässliche Monster mit Tentakeln und riesigen Fangzähnen in sabbernden Mäulern werden als die besten und treuesten Verbündeten der Menschheit dargestellt, während Aliens mit Bambiaugen menschliche Frauen in Farmen halten, künstlich schwängern und ihre Babies als Delikatesse frittieren! Hier spielt Scalzi zu oft mit dem BEM-Klischee (Bug-Eyed Monster) der Science-Fiction.
Tiefschürfend ist das Buch selten, allerdings darf man sich von solchen Passagen nicht irritieren lassen. Flach und „nur“ unterhaltend ist dieser Roman nicht. Scalzis Stil ist nicht homogen; wie man auch in seinem Blog lesen kann, ist er stets um ein Späßchen bemüht, was auch seine Hauptfigur John Perry auszeichnet. Wenn John Perry über dies und das sinniert, liest sich der in der Ich-Perspektive geschriebene Roman am besten. Hier spricht Scalzi aus Perry, er schreibt, wie er denkt, wie in seinem Blog. Und das gibt Perry Leben und Authentizität, er kann mit seinen Gedanken überzeugen.
Scalzi ist kein Technomane, er beschreibt meistens Near-future-Technologie und ist in dieser Hinsicht sicher kein Visionär. Er ist an den Einflüssen auf den Menschen interessiert; hier bietet er im letzten Drittel des Romans einige Denkanstöße. Perry begegnet den Soldaten der „Geisterbrigaden“, geklont aus der DNA Freiwilliger, die starben, bevor sie in die Dienste der KVA traten und ihr Bewusstsein transferiert werden konnte. Ihre Körper wurden noch gravierender verändert, sind effizienter und stärker, ihre Persönlichkeit nahezu völlig neu erschaffen. Einer dieser Elitesoldaten rettet Perry, der in ihm jemanden wiedererkennt, den er einmal sehr gut kannte.
Anstelle von Ideologie tritt bei Scalzi Humor – blanke Gewalt und Action satt gibt es jedoch auch in seiner Form der Military Science Fiction. Scalzi hat eine besonders ausgeprägte Gabe, Bilder in den Köpfen seiner Leser zum Leben zu erwecken. Egal wo John Perry im Einsatz ist, diese Welten sind lebendig und faszinierend fremd. Oft sogar sind diese Welten und ihre Bewohner so fremd, dass sie ein Mensch nicht wirklich verstehen kann. Selbst das Oberkommando rätselt oft über die Motivationen bestimmter Rassen; man befindet sich in Kriegen und weiß nicht, wie man sie beenden kann, da man nicht einmal weiß, was genau sie ausgelöst hat. So wird der kriegerische Konflikt als die häufigste Form der Kommunikation und Problemlösung im Universum dargestellt.
In der deutschen Fassung findet sich als Epilog noch die Kurzgeschichte „Fragen an einen Soldaten“, in der interessanterweise John Perry unter anderem von der seltenen friedlichen Einigung mit einer anderen Spezies berichtet. Gut und Böse liegen in Scalzis Universum nahe beieinander, oft muss man eine Aktion im Nachhinein ganz anders bewerten, aufgrund neuer Informationen, die man zuvor nicht hatte:
|“Mein Gott, das tut mir natürlich sehr leid“, sagte Bender. „Das hätte ich nicht sagen sollen. Aber ich wusste ja nichts davon.“ „Natürlich nicht, Bender. Und genau darauf wollte Viveros hinaus. Hier draußen wissen Sie von nichts. Sie wissen |gar| nichts.“| (S. 221)
_Fazit:_
John Perry ist ein interessanter Charakter, aus dessen Sicht Scalzi dem Leser seine Welt sehr plastisch in starken Bildern vor Augen führt, trotz oder gerade wegen der Ich-Perspektive, in welcher der Roman geschrieben ist. Die Übersetzung von Bernhard Kempen ist in Stil und Ton gut gelungen, auch wenn einige Wendungen und relaxte amerikanische Umgangssprache, wie sie in den Dialogen vorherrscht, mir im Original einfach besser gefallen haben.
Ein bemerkenswertes Debüt, in meinen Augen eine unserem Zeitgeist entsprechende Version von „Starship Troopers“. Viel leichter verdaulich für unseren heutigen Geschmack, spielt Scalzi mit Klischees und lässt Ideologien außen vor; sein Roman ist deutlich geprägt von Ideen der Postmoderne, Skepsis ist angebracht, die Dinge sind oft nicht so, wie sie zu sein scheinen. Mir persönlich gefiel Scalzis staubtrockener, sarkastischer Humor, allerdings könnte er anderen Lesern als viel zu banal und derb erscheinen. Mit „The Ghost Brigades“ und „The Last Colony“ sind bereits Fortsetzungen erschienen, die hoffentlich bald auch in Übersetzung für den deutschen Markt vorliegen.
Homepage des Autors:
http://www.scalzi.com/
|Originaltitel: Old Man’s War
Übersetzt von Bernhard Kempen
Taschenbuch, 432 Seiten|
http://www.heyne.de
Band 1: [„Die Seuche“ 2883
_Story_
Nach dem Tod ihres Mannes Kao Torin befindet sich Cherijo auf der Flucht vor den Söldnerschiffen der Liga, die im Auftrag ihres Vaters Joseph Grey Veil das Universum nach der gentechnisch modifizierten Heilerin durchkämmen. An Bord der |Sunlace|, dem Schiff der Joreianer, findet sie Schutz und verdient sich an der Seite der Obersten Heilerin erste Sporen in ihrem neuen Hausclan und schließlich auch Respekt und Bewunderung.
Doch die friedliche Idylle täuscht, denn nach wie vor wird Cherijo mit Konflikten jedweder Art konfrontiert und in ihrem Job als praktizierende Ärztin bis aufs Äußerste gefordert. Als schließlich eine Mordserie die |Sunlace| erschüttert, gerät die Heilerin in Verdacht, daran beteiligt zu sein. Besonders die skeptischen Vertreter des Clans Torin trauen der exzentrischen Ärztin nicht über den Weg, und als schließlich mehrere Fährten in ihr Quartier führen, sieht sie sich zum Handeln gezwungen. Erneut tritt sie in den Gedankenaustausch mit dem Obersten Linguisten Duncan Reever, um der Ursache der Morde auf den Grund zu gehen. Doch je tiefer sie in ihr eigenes Bewusstsein eindringt, umso bedrohlicher wirkt der Feind.
Als wäre dies nicht schon genug, wird Cherijo auch ständig von Kaos Clanbruder Xonea belästigt; der mächtige joreianische Krieger will die Nachfolge seines Bruders antreten und die Heilerin zu seiner Gattin erwählen. Diese jedoch zeigt kein Interesse am launischen Vertreter Jorens, der daraufhin auch vor Gewalt nicht zurückschreckt. Gerade als die beiden Frieden miteinander geschlossen haben und die Vielzahl der Bedrohungen abklingt, wird Cherijo dann wieder an die jüngste Vergangenheit erinnert. Joseph Grey Veil fordert nach wie vor das Recht auf seinen Besitz, seine konstruierte Tochter, und dazu sind dem berüchtigten Wissenschaftler alle Mittel recht.
_Meine Meinung_
Im Gegensatz zum ersten Teil, der eigentlich erst nach der Hälfte der Zeit so richtig durchstartete, beginnt die eigentliche Action in „Der Klon“ schon im ersten Kapitel. Wobei Action in diesem Fall nicht auf klassische Art und Weise verstanden werden sollte. Es ist vielmehr so, dass von Beginn an mächtig Trubel herrscht, die Hauptfiguren von einem Chaos ins nächste stürzen und besonders Cherijo viele Prüfungen bestehen muss, um ihren neuen Verbündeten und vor allem sich selbst zu beweisen, was wirklich im Körper der flüchtigen Terranerin steckt. Dabei hat die vorlaute Heilerin zahlreiche Grabenkämpfe auszutragen, beginnend mit dem Machtkampf um die Nachfolge der Obersten Heilerin der |Sunlace|, den sie mit ‚Spliss-Lippe‘ Squillip austrägt, bis hin zum permanenten Familienzwist mit ihrem Clanbruder Xonea, der sein Recht einfordert und Cherijo ehelichen will, von seiner Erwählten jedoch nicht als Gatte akzeptiert wird. Ständig geraten die beiden aneinander, bekämpfen und beschimpfen sich und gehen dabei bis ans Äußerste ihrer Substanz – und darüber hinaus.
Neben den vielen Beziehungsdramen, die in „Der Klon“ einen wesentlichen Teil übernehmen, steht indes eine Mordserie im Mittelpunkt, bei der viele Indizien dafür sprechen, dass Cherijo darin verwickelt ist. Immerzu befinden sich am Tatort Spuren, die auf eine Beteiligung der angehenden Obersten Heilerin schließen lassen, und stets muss sich die begabte Ärztin wieder aus der daraus entstehenden Bredouille befreien. Weil die wichtigsten Zeugen nach und nach auf mysteriöse Weise ausgelöscht werden, sieht sich Cherijo dazu gezwungen, selber verdeckt zu ermitteln und sich von aller Schuld freizusprechen. Doch ihr Gegner scheint mächtiger als alles, was sie bislang erlebt hat.
Natürlich wird auch die Jagd auf die gentechnisch auf Perfektion programmierte Tarranerin näher beleuchtet. Jede kurze Abweichung von der Norm der Schiffsroute bringt die Liga-Truppen wieder auf den Plan, und immer wieder greifen einzelne Söldner an, um Cherijo in die Obhut ihres Vaters zurückzubringen. Dabei müssen viele unschuldige Joreianer sterben, unter anderem auch Personen, zu denen die Heilerin eine ganz spezielle Beziehung hatte, wie etwa Tonetka, die einem plötzlichen Söldnerangriff zum Opfer fällt. Immer wieder wird Cherijo an die Zwickmühle erinnert, in der sie sich befindet, denn nur wegen ihrer Existenz muss ein ganzes Volk in Angst leben. Mehrfach äußert sie das Bedürfnis, sich Dr. Grey Veil auszuliefern, eventuell auch zu sterben, um ihre Gefährten von dieser Geißel zu erlösen. Doch das Volk Jorens steht nach alldem, was Cherijo für die Angehörigen der einzelnen Clans getan hat, vollends hinter seiner Adoptivtochter. Und so kommt es wie es kommen musste: Ein Aufeinandertreffen der ganz besonderen Art wird unfreiwillig arrangiert – und mündet in ein Finale, das selbst Hartgesottene vollkommen überraschen wird.
Nach dem fulminanten Ende von „Die Seuche“ hatte ich an „Der Klon“ große Erwartungen, die letzten Endes auch ausnahmslos erfüllt wurden. Die Geschichte wird rasant fortgesetzt, auf nahezu allen Handlungsebenen vertieft und intelligent ausgedehnt und hinsichtlich Action und Dramaturgie noch einmal um ein Vielfaches gesteigert. Dabei mag zwar hier und dort mal eine Tatsache unrealistisch erscheinen – so zum Beispiel, dass Cherijo nach beinahe jedem stressigen Erlebnis in Ohnmacht oder sogar ins Koma fällt – aber weil dies meist dazu beiträgt, das Mysterium um die wirklich faszinierend dargestellte Hauptfigur zu bekräftigen, geht das voll und ganz in Ordnung.
Apropos Cherijo Grey Veil bzw. Torin: Der Charakter, den die Autorin hier entworfen hat, ist schlichtweg genial. Rebellisch, einfühlsam, exzentrisch, egoistisch, aggressiv, behutsam, ruhig, gelassen, hysterisch, hasserfüllt: Es gibt keinen einzigen Wesenszug, den die Heilerin im Laufe der Geschichte nicht zeigt, was nicht nur ihr, sondern auch dem Roman selber einen großen Teil seiner Unberechenbarkeit beschert, die ihn über die gesamte Dauer auszeichnet. Man fühlt mit der außergewöhnlichen Dame, verliebt sich mitunter in sie und lernt sie im nächsten Moment wieder zu verachten. Solche Figuren sind im Science-Fiction-Genre äußerst rar, aber dringend erforderlich, um das Niveau des Genres aufrechtzuerhalten.
In diesem Sinne, und speziell dank solch genialer Charakterzeichnungen, wie man sie in „Der Klon“ zuhauf vorfindet, kann und muss man beim zweiten Band der „Stardoc“-Saga von einem furiosen, atemberaubenden und dazu auch noch enorm eigenständigen Roman sprechen. Die Weichen für eine rasante Fortsetzung sind ebenfalls schon gestellt, so dass die Begeisterung auch noch eine Zeit lang anhalten wird. Aber erst einmal gilt es, diesen besonderen Roman bzw. dessen Inhalt auszukosten. Der dritte Band, „Die Flucht“, erschien im Sommer 2006 bei |Heyne|.
http://www.heyne.de
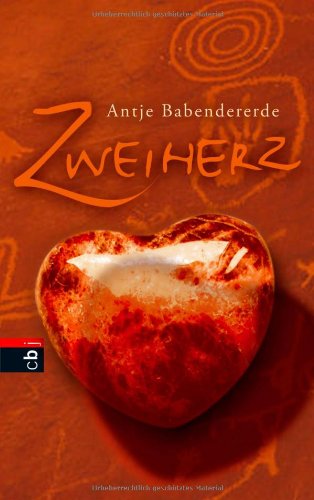
Es herrscht Krieg. In einer großen Schlacht besiegt Haradons Heer das der Myrdhanen.
Alasar sitzt wie jeden Sonnenaufgang in den letzten Tagen auf einem hohen Felsen und hält Ausschau nach den Rückkehrern aus der Schlacht, nach seinen Eltern und Brüdern. Doch was er an diesem Morgen heranziehen sieht, ist das Heer der Haradonen! Eilig holt Alasar seine Schwester Magaura und alle Einwohner seines Dorfes, die bereit sind, ihm zu folgen, und führt sie hinauf in die Höhlen der Berge, während die Feinde hinter ihm alles in Schutt und Asche legen. Doch was er mit den Flüchtlingen, die wie er fast ausschließlich Kinder sind, aus dem Nichts aufbaut, ist kein Neuanfang …
Ardhes ist die Prinzessin von Awrahell, die personifizierte Hoffnung der Elfen auf eine Zukunft in dem Land, das einst ihnen gehörte, und aus dem die Menschen sie immer weiter verdrängen. Doch Königin Jale, gebürtige Haradonin, verabscheut die Elfen und hat den Elfenkönig Octaris nur um der Macht willen geheiratet. Sie drängt ihre Tochter dazu, einen Menschen zu heiraten und zu Ende zu führen, was sie selbst begonnen hat: die endgültige Vertreibung der Elfen. Da beobachtet Ardhes zufällig ihre Mutter mit einem Geliebten!
Revyn hat für Krieger und Soldaten nichts als Verachtung übrig. Doch um seiner dunklen Vergangenheit zu entfliehen, schließt er sich ihnen an und lässt sich in Logond, der Hauptstadt Haradons, zum Drachenreiter ausbilden. Der Umgang mit den schönen, mächtigen und unsagbar traurigen Wesen ist der einzige Lichtblick in seinem düsteren Leben. In kürzester Zeit hat er sich einen Namen als begnadeter Drachenzähmer gemacht. Einziger Wermutstropfen ist die Tatsache, dass immer wieder Drachen einfach spurlos verschwinden. Eines Nachts gelingt es einem Mädchen, nahezu sämtliche Drachen zu befreien und aus der Stadt zu führen. Revyn beteiligt sich an der Verfolgung, doch nicht, um das Mädchen einzufangen, sondern um das Rätsel der verschwundenen Drachen zu lösen…
In einem Sog, dem sich keiner der drei entziehen kann, treiben sie aufeinander zu, und ihr Zusammentreffen wird die Welt unwiederbringlich verändern. Denn sie sind Ahirah, Kinder von Ahiris, dem Gott des Schicksals …
Wie schon „Nijura“, so zeigt auch „Das Drachentor“, dass Jenny-Mai Nuyen eine große Begabung für Charakterzeichnungen hat.
Alasar ist der geborene Anführer. Er weiß, wie man andere überzeugt, wie man die Begeisterung in ihnen weckt, die nötig ist, um auch Aufgaben von herkulischem Ausmaß erfolgreich durchzuziehen. Unter seiner Führung hätten die Höhlenkinder zu einer blühenden Gesellschaft werden können. Doch der Krieg hat ihn vergiftet. Verlustängste und der Wunsch nach Rache bestimmen all sein Tun, und sie werden umso stärker, je älter er wird. Er ignoriert die Tatsache, dass die Höhlenkinder erwachsen werden, auch Magaura. Selbst den vernünftigsten Argumenten seines besten Freundes Rahjel ist er schließlich nicht mehr zugänglich, Kritik wird als Verrat gewertet. Alasar ist auf dem besten Weg, ein grausames, kaltherziges Ungeheuer zu werden.
Ardhes ergeht es ähnlich. Jale ist verlogen, intrigant und machthungrig, Octaris dagegen besitzt zwar mächtige Gaben, lässt aber alles um sich herum einfach widerstandslos geschehen. Ardhes verachtet sie beide. Sie fühlt sich ungeliebt und benutzt und reagiert darauf zunächst mit Verweigerung, dann mit Trotz. Dabei verschwendet sie keinen einzigen Gedanken an die Folgen ihres Tuns für andere. Von allen drei Ahirahs zeigt Ardhes am stärksten das Verhalten einer noch unreifen Heranwachsenden, was wiederum nicht verwundert, da sie als Einzige zumindest relativ behütet und sicher aufgewachsen ist.
Revyn dagegen ist ein Kind ohne Wurzeln, nirgendwo fühlt er sich zuhause. Er verabscheut sowohl den Alkohol als auch das Töten, doch sich selbst verabscheut er auch. Erinnerungen und Gewissensbisse verfolgen ihn überall hin. Alles, was er sich wünscht, sind Friede für seine Seele und ein Ort, an den er gehört. Aber all seine Bemühungen, das Richtige zu tun, all seine Versuche der Sühne und Wiedergutmachung scheinen zu seiner wachsenden Verzweiflung nur immer weiter in die Katastrophe zu führen!
Eine gute Portion Einfühlungsvermögen hat diese drei so glaubhaft und lebendig werden lassen, dass man sie förmlich vor sich zu sehen meint. Aber auch die Nebencharaktere wie Königin Jale, König Octaris oder Revyns Kriegskameraden Twit und Capras sind ungemein plastisch und in sich stimmig ausgeführt. Selbst dem König der Myrdhanen, der nur in ein paar kurzen Szenen auftaucht, hat die junge Autorin dieselbe Aufmerksamkeit und Sorgfalt angedeihen lassen wie ihren Hauptfiguren, ohne sich dabei in Details zu verlieren.
Die Geschichte selbst braucht ein wenig Anlaufzeit. Es ist nicht von Anfang an ersichtlich, was die Drachen mit dem Krieg zwischen Haradon und Myrdhan zu tun haben. Erst als zum ersten Mal ein Drache verschwindet, wird dem aufmerksamen Leser die Verbindung deutlich.
Das Hauptaugenmerk des Geschehens liegt zunächst auf einer Prophezeiung, von der Octaris Ardhes erzählt. Wobei Prophezeiung wahrscheinlich nicht unbedingt das richtige Wort ist. Vielmehr handelt es sich um Visionen. Octaris ist ein Seher. Und wenn er nachts zu den Sternen hinaufstarrt, sieht er die Zukunft der Welt, in der die Ahirah eine entscheidende Rolle spielen. Ardhes lauscht diesen Visionen ihres Vaters. Doch wie es bei Visionen oder Prophezeiungen üblich ist, sind sie nicht in klare, eindeutige Worte gefasst. Ardhes ist nicht die Einzige, die aus den Worten ihres Vaters falsche Schlüsse zieht.
Das hört sich jetzt nicht unbedingt neu an. Ist es auch nicht. Aber es ist mit viel Engagement und Herzblut erzählt. Und eines ist tatsächlich ungewöhnlich: Hier gibt es keinen Tyrannen, Zauberer oder finsteren Gott, in dem sich alles Böse konzentriert und den es zu besiegen gilt. Deshalb hat das Buch auch kein Happyend. Es hat überhaupt nur ein halbes Ende, insofern, als der Leser erfährt, was aus zweien der drei Ahirah geworden ist. Doch ein Schicksal bleibt offen.
Auch die Handlung als solche hat nicht den sonst üblichen Abschluss erhalten. Nicht nur, dass der drohende Untergang nicht aufgehalten werden konnte; da es kein personifiziertes Böses gibt, das hätte besiegt werden können, gibt es auch keinen strahlenden Helden, der nach der Schlacht mit dem Wiederaufbau beginnen könnte. Jenny-Mai Nuyen erzählt hier das Ende einer Epoche, ohne einen Blick auf einen Neuanfang zu werfen.
Insofern ist „Das Drachenauge“ für einen Fantasy-Roman unerwartet realistisch. Das Böse ist kein Fremdkörper, der von außen in die bis dahin heile Welt eindringt und mit Heldenmut und Opferbereitschaft wieder vertrieben werden kann. Gut und Böse sind Teil der Welt, waren es immer und werden es immer sein. Sie bleiben von Umwälzungen, von Aufstieg und Fall, völlig unberührt. Trotzdem hat das Buch kein negatives Ende. Denn einer der drei Hauptcharaktere hat eine Wandlung durchgemacht und wirft zumindest ein kleines Hoffnungslicht auf den düsteren Weg ihrer Welt, auf den die Autorin einen Ausblick gegeben hat.
Um es kurz zu machen: Jenny-Mai Nuyen hat die Hoffnungen, die ich in ihr neuestes Buch setzte, voll erfüllt. Ihre Sprache ist nach wie vor bildhaft und ausdrucksstark, sowohl was Stimmungen als auch Landschaften betrifft; ihre Charaktere agieren nicht nur glaubhaft und nachvollziehbar, sie sind voller Leben, als hätte ich sie persönlich gekannt; und auch ihre Ideen, vor allem im Zusammenhang mit der Welt der Drachen, haben mir sehr gut gefallen, auch wenn der Gedanke von Fell bei einem Drachen etwas ungewöhnlich erscheint.
Jemand, der sich langweilt, sobald der Held der Geschichte nicht ununterbrochen von einer unermesslichen Gefahr in die andere stolpert, sollte besser die Finger von dem Buch lassen. Wer dagegen mehr als rasante Action im Sinn hat, dem kann ich das Buch wärmstens empfehlen. Jenny-Mai Nuyen schreibt nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit ihrer Seele. Das ist deutlich zu spüren. Zur Abwechslung mal finde ich das vollmundige Lob von Verlag und Presse, für das ich normalerweise überhaupt nichts übrig habe, durchaus gerechtfertigt.
Jenny-Mai Nuyen stammt aus München und schrieb ihre erste Geschichte mit fünf Jahren. Mit dreizehn wusste sie, dass sie Schriftstellerin werden wollte. „Nijura“, ihr Debüt, begann sie im Alter von sechzehn Jahren. Inzwischen ist sie neunzehn und studiert Film an der New York University. Ihr neuester Roman „Nocturna – Die Nacht der gestohlenen Schatten“ ist für Juli dieses Jahres angekündigt.
Taschenbuch, 576 Seiten
ISBN-13: 978-3-570-30388-7
www.jenny-mai-nuyen.de/
www.randomhouse.de/cbjugendbuch/index.jsp
Der Autor vergibt: 



_Handlung_
Die Kobolde Brams, Riette, Rempel Stilz und Hutzel sind im Wechselbalggewerbe aktiv. Das heißt sie klauen Menschen und tauschen diese gegen einen garstigen Wechselbalg aus. Ihre Aufträge erhalten sie vom Krämer Moin, der sie dann in die Menschenwelt schickt, um das gewünschte Exemplar zu holen. Vom Koboldland-zu-Luft-und-Wasser kommen sie mittels ihrer Gehilfin Tür in die Menschenlande. Doch nachdem es mit der Tür Ärger gab, lässt diese die armen Kobolde einfach in der Menschenwelt zurück. Aber Kobolde wären nicht Kobolde, wenn sie sich nicht gleich auf die Suche nach einem Rückweg machen würden. Sie sind jedoch nicht unentdeckt geblieben, so dass sie schon bald von verschiedenen Fraktionen verfolgt werden, die ihrer habhaft werden wollen.
_Der Autor_
Karl-Heinz Witzko, geboren 1953, ist diplomierter Statistiker und hat zahlreiche-Romane voller Wortwitz und schillernder Phantasie geschrieben. Am bekanntesten sind seine Romane zum Rollenspiel „Das Schwarze Auge“ (DSA) wie „Westwärts, Geschuppte!“ oder die „Dajin-Trilogie“ und seine „Gezeitenwelt“-Romane.
Seine skurrilen Einfälle holt sich der Autor während ausgedehnter Spaziergänge im Teufelsmoor bei Bremen. Und vor einigen Jahren machte er dort seine erste Bekanntschaft mit Kobolden – als sein Jagdhund einen solchen von einem Ausflug wohlbehalten nach Hause brachte.
_Mein Eindruck_
Im Bezug auf Karl-Heinz Witzko schlagen zwei Herzen in meiner Brust: Einerseits hat er meinen absoluten Lieblings-DSA-Roman „Westwärts, Geschuppte!“ geschrieben, andererseits hat mir die „Dajin“-Trilogie überhaupt nicht gefallen. Witzko pflegt einen manchmal etwas sperrigen Schreibstil, der es nicht immer einfach macht, ihm zu folgen, so dass man manche Sachen zwei- bis dreimal nachlesen muss, um sie zu verstehen. Dies mag vor allem für den weniger geübten Leser schnell frustrierend wirken. Andererseits ist Witzko aber mit einem Gespür für Wortwitz und Situationskomik ausgestattet, wie ich es bisher bei nur sehr wenigen anderen Autoren gelesen habe. Genau diese Stärke bringt er bei „Die Kobolde“ mustergültig zur Geltung. Denn dieser Roman bringt den Leser bei jeder der über 400 Seiten mindestens einmal zum Schmunzeln oder zum Lautloslachen.
Genau wie bei „Westwärts, Geschuppte!“ versetzt Witzko seine Kobolde in eine fremde Welt und Kultur und lässt sie sich dort mit jeder Menge Wortwitz und skurriler Situationskomik richtig austoben. Der Handlungsstrang ist einfach und schnell erzählt: Die Kobolde wollen nach Hause, und die halbe Welt verfolgt sie.
Dabei beschreibt er die Welt immer wieder aus der Sicht der Kobolde, was natürlich zu reichlich Verwirrung führen kann. Die Kobolde an sich sind etwa kindsgroß und begnadete Handwerker, was allerdings für die Menschen nicht immer zum Vorteil ist. So mag eine Lanze, die so präpariert ist, beim Turnier schneller zu brechen, noch von Vorteil sein, bei anderen Waffen allerdings kann das schon ganz schön lustig werden.
Mit den Charakteren nimmt es Witzko allerdings nicht so genau, denn eigentlich sind nur die vier Kobolde richtig im Vordergrund und durchdacht. Alle anderen bilden eine Kulisse, nicht mehr aber auch nicht weniger. Dass er seine Nebencharaktere alle mit einem Augenzwinkern gestaltet, zeigen auch deren Namen, wie zum Beispiel die Hexe Holla („Frau Holle“), der Ritter Gottkrieg vom Teich oder Dinkelwart von Zupfenhausen. Bei den meisten anderen Autoren würde mich das stören, bei Witzko hingegen wirkt das charmant. Die Charaktere der Kobolde sind eigentlich ganz klar verteilt. Brams ist der Anführer, Riette ist eine koboldische Furie, Rempel Stilz ist der Mann fürs Grobe („Hauptsache alles ist richtig verfugt!“) und Hutzel ist der Listige.
Sehr unterhaltsam sind die Running-Gags, für die Witzko ja auch schon bekannt ist. So ändert sich etwa ständig Hutzels Name, von Hutzelhauser über Hutzelheimer bis zu Hutzelbauer. Brams hängt ständig seinen Tagträumen nach, Rempel Stilz repariert andauernd Dinge und wird nie müde darauf hinzuweisen, dass jetzt alles viel besser verfugt sei, und Riette erzählt aus ihren Kindertagen. Auch die Fähigkeit der Kobolde, Tieren und Gegenständen das Sprechen beizubringen, bringt den Leser ein ums andere Mal zum Schmunzeln; so können etwa fast alle Dinge im Koboldland-zu Luft-und-Wasser sprechen. Lustige Konservationen mit Hühnern oder Schnittlauch sind da vorprogrammiert.
Also fassen wir das Ganze einmal zusammen: Witzko nimmt seine Geschichte nicht ganz so ernst; wer also epische Fantasy sucht, ist hier nicht ganz an der richtigen Stelle. Allerdings würde das wohl auch nicht wirklich zu Kobolden passen, daher macht Witzko das einzig Richtige: Er bringt den Leser permanent zum Lachen, sei es durch Situationskomik oder Wortwitz. Hierbei legt Witzko eine solche Kreativität an den Tag, dass es niemals aufgesetzt oder gezwungen wirkt.
_Fazit_
„Die Kobolde“ ist sicher einer der witzigsten Romane des Jahres. Witzko bietet zwar keine klassische Fantasy wie etwa seine Kollegen Heitz oder Hardebusch, dafür bombardiert er uns mit einer über 400 Seiten langen Humorbombe. Wer auf lustige Fantasy à la Terry Pratchett steht, der kann hier blind zugreifen.
http://www.piper-verlag.de/fantasy/