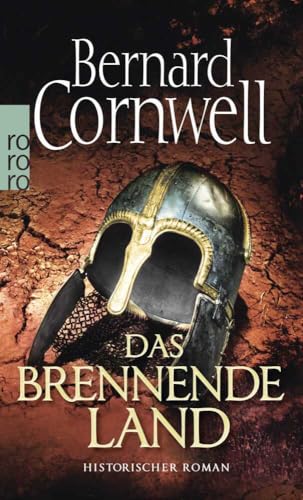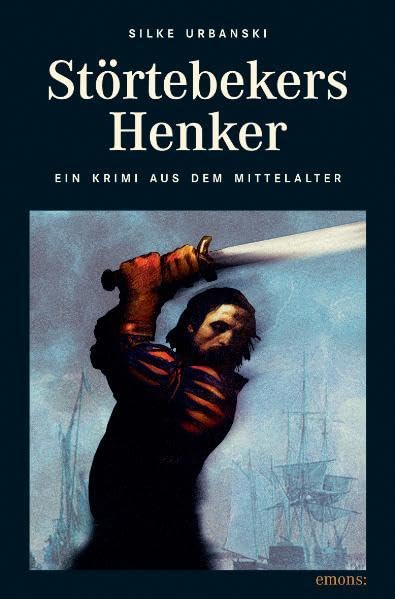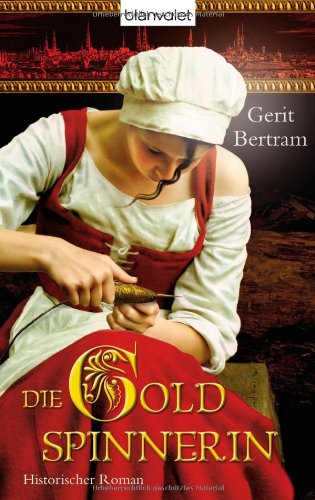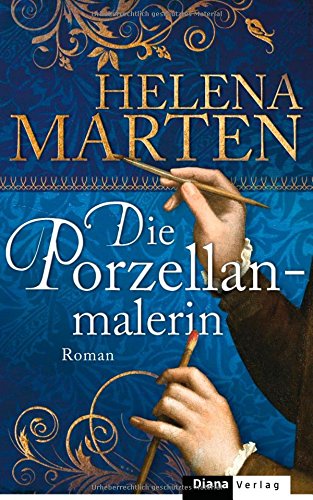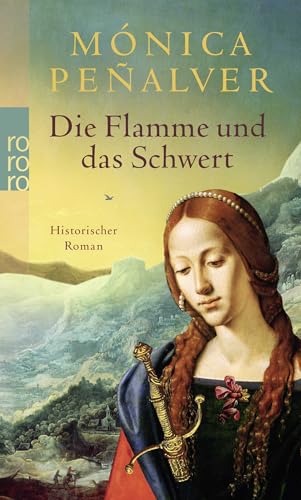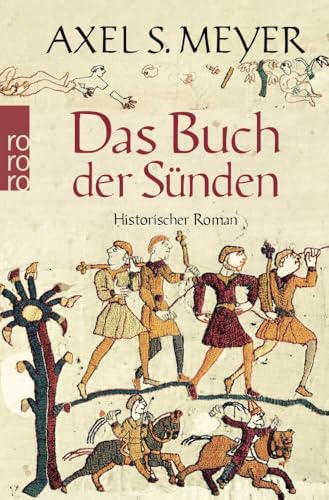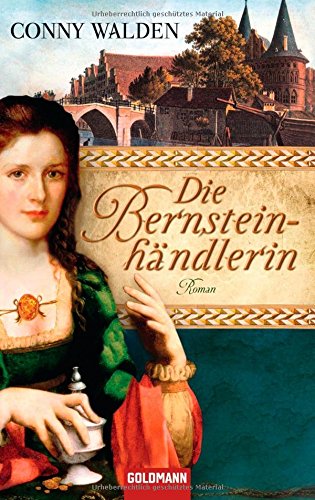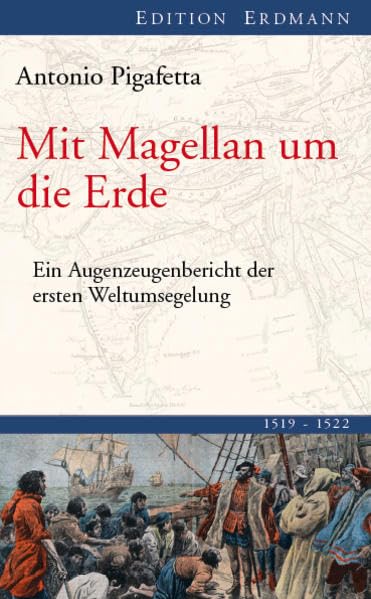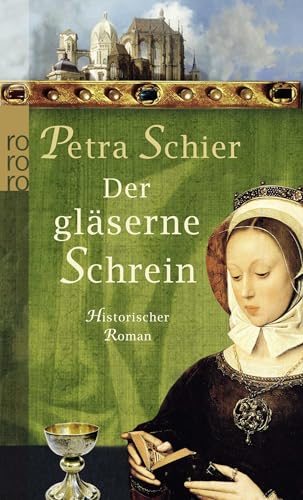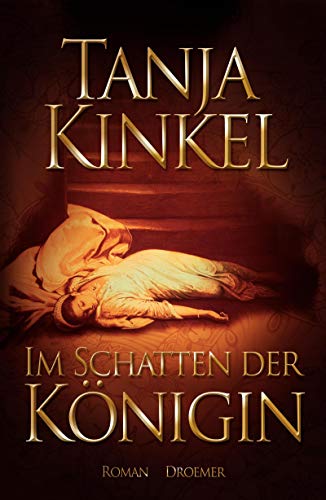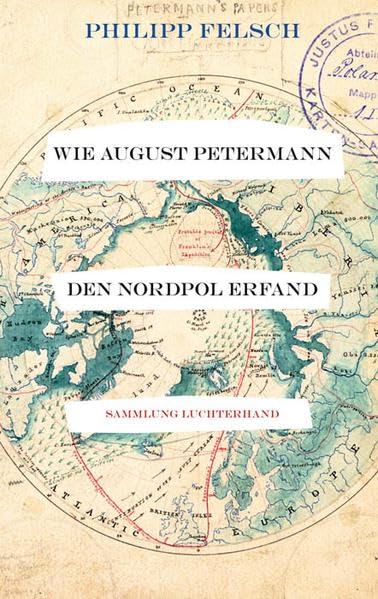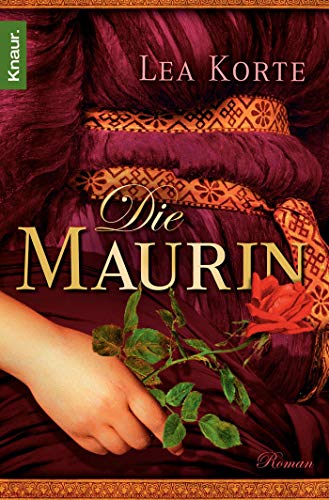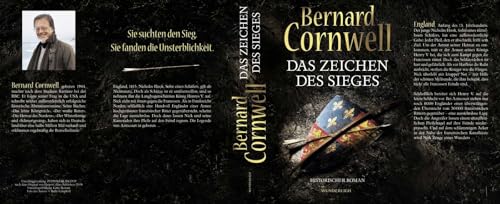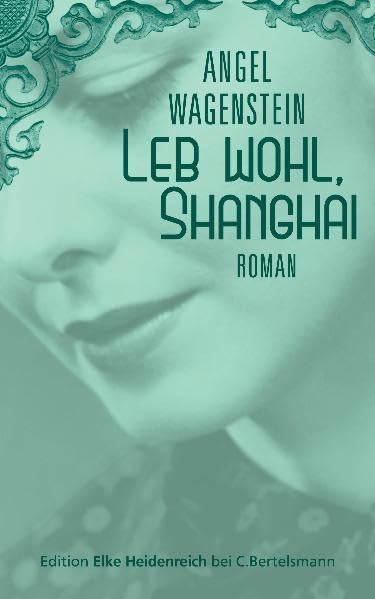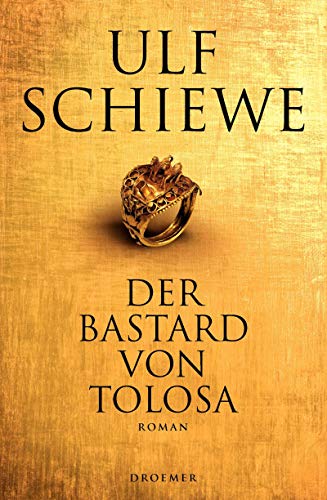Wenn man sich durch das umfangreiche (und immer weiter wachsende) Werk von Bernard Cornwell arbeitet, dann ist anzunehmen, dass man nach erfolgter Lektüre viel schlauer ist als zuvor. Zumindest, was englische Geschichte, Politik und Kriegshandwerk angeht, denn dies sind Cornwells Leidenschaften, die in seinen Romanen immer wieder das Grundgerüst bilden.
In „Das brennende Land“ entführt Cornwell seine Leser in das England des 9. Jahrhunderts, wobei es jedoch vermessen wäre, hier schon von „England“ zu sprechen. Stattdessen bedecken die Länder Wessex, Northumbrien und Mercien große Teile der Landschaft, die wir heute als England kennen. Held (im wahrsten Sinne) der Geschichte ist Uthred, ein Kriegsherr, dessen Eid ihn an König Alfred von Wessex bindet. Damit ist er jedoch weniger glücklich, denn Alfred ist ein Christ und umgibt sich mit einer stattlichen Anzahl von Mönchen, die auf den Heiden Uhtred herab blicken. Dieser wiederum hält das Christentum für eine lächerliche Religion, lässt es sich jedoch nicht nehmen, in brenzligen Situationen nicht nur zu seinen eigenen Göttern, sondern auch zu diesem ans Kreuz genagelten Christus zu beten. Man kann schließlich nie wissen …
Alfreds Hofstaat provoziert einen Eklat, der Uthred dazu bringt, seinen Eid auf Alfred zu brechen und stattdessen nach Norden zu gehen. Eigentlich will er mit Wessex auch gar nichts zu tun haben. Viel lieber würde er Bebbanburg, seine Heimat im Norden, wieder einnehmen. Doch dazu braucht er Gold und Männer – in dieser Reihenfolge. Also plant er, Skirnir zu überfallen, da er erfahren hat, dort solle sich ein Schatz befinden. Der Überfall gelingt zwar, doch fällt die Beute weit weniger reichlich aus als erhofft, und so steht Uthred immer noch am Anfang seines Plans. Bevor dieser jedoch weiter gedeihen kann, ruft ein anderer Eid ihn über Umwege zurück an Alfreds Seite und er muss ein weiteres Mal dessen Reich vor einfallenden Feinden schützen.
Bei „Das brennende Land“ handelt es sich um den fünften Band in Cornwells |Uthred|-Serie. Zwar kann man sich auch ohne Vorkenntnisse auf den Roman einlassen, doch wird man mehr aus der Lektüre mitnehmen, wenn man auch die Vorgängerbände kennt. So sind die politischen Verwicklungen, die Cornwell beschreibt, durchaus kompliziert und bei den unzähligen fremdartigen Namen wird es ohne Vorkenntnisse noch schwerer, den Überblick zu behalten, wer mit wem verbandelt, verfeindet oder verbündet ist. Eine kleine Hilfestellung bei der Orientierung bieten eine Karte, eine Liste mit Ortsnamen (und ihrer zugehörigen englischen Entsprechung) und ein Stammbaum der Wessex’schen Königsfamilie. Gerade die Liste der Ortsnamen ist eine echte Hilfe, da man ohne sie kaum erraten würde, wo man sich geographisch gerade befindet: Dass Cent der alte Name für die Stadt Kent ist, ist noch naheliegend. Aber wer käme schon darauf, hinter der Ortsbezeichnung Eoferwic das heutige York zu vermuten?
Den Großteil der auftauchenden Personennamen muss man sich jedoch selbst merken, wobei nur eine Handvoll davon wirklich wichtig ist. Cornwell konzentriert sich hauptsächlich auf seinen Protagonisten (darum ist der Roman wohl auch in der Ich-Form geschrieben) und arbeitet Nebencharaktere eher uninspiriert ab. Die Krieger in Uthreds Diensten bleiben, bis auf ein oder zwei Ausnahmen, durchweg farblos, und selbst der großen Gegenspielerin des Romans, der ambitionierten Skade, vermag er kaum Profil zu verleihen. Als machthungrige Schönheit hängt sie sich jeweils an den Mann, der den meisten Erfolg verspricht, und lässt ihn in dem Moment fallen, in dem ein besseres Exemplar vorbeireitet. Sie ist kaltherzig, berechnend und grausam. Doch mehr als pure Machtlust um ihrer selbst willen mag Cornwell ihr als Motivation nicht zugestehen. Es ist ein wenig schade, dass ein Charakter, der so viel Profil vermuten lässt, im Roman dann fast nichts davon einlöst.
Was Cornwell jedoch bei seinen Nebencharakteren einspart, das verwendet er samt und sonders auf Uthred, der als schillernder Kriegsheld gezeichnet wird und doch nicht eindimensional bleibt. Er ist ein echter Macher, ein Pläneschmieder und furchteinflößender Kämpfer. Kurzum, er ist ein echter Mann, der andere Männer nur dann schätzt, wenn sie mit seiner Kraft und Potenz mithalten können (darum wohl auch seine Abneigung gegen das Christentum, da ihm alle Christen als verweichlicht erscheinen). Er ist großspurig und neigt etwas zum Protzen, doch selbst diese Eigenschaften machen ihn nicht unsympathisch, sicherlich, weil der Leser realisiert, dass Uthred genügend Grund zur Eitelkeit hat. Und doch: Selbst er findet sich wiederholt als Opfer verschiedener Ränkespiele wieder und muss sich in Situationen ergeben, die sich seiner Einflussnahme entziehen. So findet er sich gänzlich gegen seinen Willen auf Alfreds Seite wieder, hat aber keine andere Möglichkeit, als zu versuchen, in der Situation etwas Positives zu finden. Ihr entfliehen kann er ohnehin nicht.
Ebenso interessant wie Uthred ist Cornwells Beschreibung des Konflikts zwischen dem aufkommenden Christentum und den alten Göttern. Uthred hängt dem nordischen Götterkreis an und wird am christlichen Hof Alfreds eigentlich nur noch geduldet, weil er so ein erfolgreicher Heerführer ist. Dass der Kampf der Religionen durchaus blutig geschlagen wurde, während andererseits in vielen Fällen auch ein friedliches Nebeneinander möglich war, das will Cornwell beschreiben. Und es gelingt ihm eindrücklich.
„Das brennende Land“ ist ein Roman für alle, die an der frühen Geschichte Englands interessiert sind und die sich – lesend, selbstverständlich – auch gern ein wenig ins Schlachtengetümmel werfen. Denn eins ist klar: Ohne eine ordentliche Schlacht lässt Cornwell keinen seiner Romane enden!
|512 Seiten, broschiert
ISBN-13: 978-3499254147
Originaltitel:| The Burning Land|
Übersetzung: Karolina Fell|
http://www.rowohlt.de
http://www.bernardcornwell.net
_Bernard Cornwell auf |Buchwurm.info|:_
[„Stonehenge“ 113
[„Die Galgenfrist“ 277
[„Der Bogenschütze“ (Auf der Suche nach dem Heiligen Gral 1) 3606
[„Der Wanderer“ (Auf der Suche nach dem Heiligen Gral 2)]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=3617
[„Der Erzfeind“ (Auf der Suche nach dem Heiligen Gral 3) 3619
[„Sharpes Feuerprobe. 1799: Richard Sharpe und die Belagerung von Seringapatam“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=5208
[„Sharpes Sieg. 1803: Richard Sharpe und die Schlacht von Assaye“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=5829
[„Das Zeichen des Sieges“]http://buchwurm.info/book/anzeigen.php?id__book=6223