
Im 26sten Jahrhundert – die Menschheit hat sich über die Galaxien ausgebreitet und ferne Planeten kolonialisiert – hat die Wissenschaft erreicht, was Religionen nur in Aussicht stellen konnten: |das ewige Leben|.

Im 26sten Jahrhundert – die Menschheit hat sich über die Galaxien ausgebreitet und ferne Planeten kolonialisiert – hat die Wissenschaft erreicht, was Religionen nur in Aussicht stellen konnten: |das ewige Leben|.
„Rabenherz“ stellt den dritten Roman des |Rigante|-Zyklus von David Gemmell, einem der führenden Autoren der Heroic Fantasy, dar. Die Geschichte spielt im feudalen Mittelalter, nicht mehr zur Zeit des alten Roms und seiner Kaiser; ein gewaltiger Zeitsprung.
Seit Kelten-Hochkönig Connavar und sein Bastardsohn Bane in den beiden Vorgängern die Armeen von Stone (Rom) besiegten, sind 800 Jahre vergangen.
Nun ist ein Zeitpunkt gekommen, an dem ähnlich der realen Geschichte nicht mehr die Römer, sondern die Engländer, in diesem Falle die „Varlish“, über die Riganten herrschen. Eine Ironie des Schicksals … Die Riganten werden unterdrückt und ihrer eigenen Kultur beraubt, von den Besatzern wird aus ihrem legendären König Connavar „Con of the Vars“ gemacht, ein angeblich varlischer Prinz …
Die Kultur und Geschichte der besiegten Rigante wird systematisch absorbiert, verändert oder verleugnet. Die Keltoi, jetzt Highlander, werden als minderwertig angesehen, benachteiligt und unterdrückt.
Die druidische Religion der naturverbundenen Rigante wird vom Christentum, hier der „Quelle“, nach und nach verdrängt, die Magie des Landes geht zurück und nur wenige Rigante besitzen noch druidische Gaben.
So etwas schreit geradezu nach einem Aufstand à la Braveheart – der Kessel beginnt zu kochen …
_Der Rigante-Zyklus im Überblick_
Spätantike
Band 1: [Die Steinerne Armee 522 (Sword in the Storm)
Band 2: [Die Nacht des Falken 169 (Midnight Falcon)
Mittelalter
Band 3: Rabenherz (Ravenheart)
Band 4: Stormrider – noch nicht übersetzt
_Freiheitsliebende Highlander und gerissene Landlords_
Befreiten sich die Rigante, der führende Stamm der Highlander in Gemmells alternativem Britannien, im Vorgänger von den Römern, ist die Lage 800 Jahre später wesentlich düsterer:
Varlische (britische) Landlords herrschen über die Highlander-Stämme, ihre ruhmreiche Geschichte wird umgeschrieben oder verleugnet, die enge Verbindung der Highlander zu den „Sidhe“ genannten Naturgottheiten und ihrer Magie ist ebenfalls nicht mehr gegeben.
Der gewaltigste Unterschied ist jedoch: Es fehlt der große Nationalheld, es gibt keinen Connavar oder Bane, der die Highlander eint und die Invasoren vertreibt. Denn Lanovar, ein ferner Nachfahre der Linie Connavars, wurde von dem „Moidart“ genannten Landlord von Burg Eldacre verraten und ermordet, als er Frieden schließen wollte. Allerdings hatte dieser einen guten Grund zum Grollen: Lanovar hat den Moidart mit seiner Frau Rayena betrogen, und diese ist nun schwanger – ob vom Moidart oder Lanovar, das weiß keiner …
Lanovar stirbt, ohne seinen illegitimen Sohn jemals gesehen zu haben. Seinem zweiten Sohn, Kaelin, einem reinrassigen Rigante, gibt er den Seelennamen „Rabenherz“ und bittet seinen hünenhaften Freund Jaim Grymauch, für ihn zu sorgen.
Die Reiter des Moidart überfallen die Rigante, es kommt zu Blutvergießen, Kaelins Mutter wird getötet, er selbst von seiner Tante Maev gerettet. Derweil arrangiert der Moidart selbst ein Attentat auf seine eigene treulose Frau und tötet sie, schiebt die Schuld Rigante-Attentätern zu. Seinen Sohn bringt er nicht um – er hat zwar die grün-goldenen Augen Lanovars, jedoch hatte die Großmutter des Moidart ebenfalls solche Augen … ungewiss, ob der kleine Gaise sein Sohn ist, lässt er ihn leben.
Liebe oder Zuneigung wird er jedoch nicht erfahren, der Moidart wird ihn alleine aufwachsen lassen und ihm jegliche Anerkennung verwehren. An und für sich schon ein grausamer und kaltblütiger Mann, wird der Moidart zum Fluch für die Riganten, denen in den Städten das Tragen von Waffen und ihren Clanfarben verboten ist. Einzig die „Schwarzen Riganten“ in den nördlichen Highlands sind stark genug, die Durchsetzung des Gesetzes auf ihrem Gebiet durch die Truppen des Moidart zu verhindern.
Kaelin und Grymauch müssen bald Eldacre verlassen, denn Kaelin hat die Soldaten, die seine Freundin Chara vergewaltigten und ermordeten, getötet und verstümmelt, Jaim bei den Hochlandspielen den varlischen Box-Champion besiegt. So fliehen sie in die Highlands, zu den gesetzlosen Schwarzen Riganten, mit deren Anführer Call Jace Kaelin bald Bekanntschaft machen wird …
_Starke Charaktere, aber keine abgeschlossene Handlung_
Eine klassische Konfliktsituation, die geradezu nach einem Volksaufstand und einem Freiheitshelden schreit – auf diesen wird man jedoch vergeblich warten, denn im Gegensatz zu den in sich abgeschlossenen Vorgängern ist „Rabenherz“ nur in Verbindung mit dem zum Zeitpunkt dieser Rezension noch nicht übersetzten „Stormrider“ eine wirklich abgeschlossene Geschichte.
So schafft „Rabenherz“ vielmehr die Grundlagen und führt die wichtigsten Figuren wie den Moidart, Maev und Kaelin sowie Jaim Grymauch ein. Diese Figuren geben dem Buch auch weitgehend seinen Charme und Charakter. Jaim Grymauch zum Beispiel ist ein riesiger Highlander, hat ein Herz wie ein Bär und ist sowohl bei Rigante als auch einigen Varlish sehr beliebt, obwohl er ein Säufer, Viehdieb und Rumtreiber ist. Maev Ring ist Jaims heimliche Liebe, eine Highlander-Geschäftsfrau, die so erfolgreich ist, dass ihr Erfolg sie zum Objekt des Neids und der Willkür der Varlish machen wird – denn keinem Rigante ist viel Besitz erlaubt.
Die wohl faszinierendste Figur ist jedoch der „Moidart“ genannte Herr von Burg Eldacre: Der raffinierte und kaltblütige Landlord ist ein faszinierender Bösewicht. Hart, aber nicht ungerecht, grausam und zugleich ein begnadeter Künstler. Das klingt recht 08/15, nicht wahr? Ist es aber nicht, der Moidart offenbart viele Facetten im Laufe des Buches, und im abschließenden Band der Rigante-Saga legt er noch einmal zu, soviel sei vorab versprochen.
Kaelin Ring wird im Laufe des Romans einen „kleinen“ Aufstand starten. Wie er sich zum neuen Anführer der Rebellen aufschwingt und wie er seit frühester Jugend bereits in der Schule gegen die Varlish rebelliert, stellt den Kern der gerne in den Hintergrund tretenden Rahmenhandlung dar. Denn sein Halbbruder Gaise Macon, der uneheliche Sohn Rayenas und Lanovars, wird erst in „Stormrider“ zusammen mit ihm zum Kampf gegen den Moidart und neue Feinde blasen, die erst gegen Ende dieses Romans auftauchen werden. Die Saga nimmt hier einige überraschende und gelungene Wendungen, die man nach dem sehr linearen und relativ handlungsarmen „Rabenherz“ nicht erwarten würde.
_Nur die erste Hälfte der Geschichte_
Die Figuren und die Geschichte sind mitreißend, Spannung satt wird geboten. Mystische Elemente sind in „Rabenherz“ im Gegensatz zu den Vorgängern weniger vertreten. Interessant auch der erfrischende Zeitsprung, Ähnliches hat Gemmell im |Stones of Power|-Zyklus mit dem unerwarteten Wechsel vom arthurianischen Britannien zu einem postapokalyptischen Wilden Westen schon einmal getan. Mir persönlich gefiel das antike Szenario des Rigante-Zyklus besser, jedoch haben Gemmells mittelalterliche Riganten-Charaktere ihren eigenen Charme und sind, insbesondere der Moidart, differenzierter und interessanter gezeichnet. Der Freiheitskampf-Gedanke wird hier wesentlich deutlicher hervorgehoben, eine gewisse Anlehnung an „Braveheart“ ist gegeben, die jedoch in „Stormrider“ zu einer unerwarteten Wendung und einem völlig anderen Szenario und Finale führt, das mir gut gefiel.
Das große Problem von „Rabenherz“ ist: Der Roman ist nur ein Auftakt, zwar ein furioser, aber ohne „Stormrider“ nur halb so gut. Trotzdem ist der Roman so spannend, dass man ihn in einem Stück verschlingen kann, und mit „Stormrider“ wird noch einmal ein Scheit mehr in das Feuer geworfen. Zum Glück ist die Vater-Sohn-Beziehung zwischen dem Moidart und Gaise Macon keine Neuauflage der Probleme zwischen Connavar und Bane, wie ich befürchtete!
Die Übersetzung ist Irmhild Seeland wieder einmal sehr gut gelungen, einige schwer zu übersetzende Eigennamen, wie die der Landlords (Moidart, Pinance), wirkten jedoch stets ein wenig unpassend auf mich.
Der Roman ist emotional ausgesprochen mitreißend, kann so den Mangel an äußerer Handlung kompensieren und dafür mit hervorragenden Charakterisierungen glänzen und die Grundlage für ein packendes Finale des |Rigante|-Zyklus legen.
_Der Rigante-Zyklus im Überblick_
Band 1: [„Die Steinerne Armee“ 522
Band 2: [„Die Nacht des Falken“ 169
Band 3: [„Rabenherz“ 498
Band 4: [„Sturmreiter“ 2961
Eigentlich hat es den Künstleragenten Texas Jimmy Balaban nur in die tiefste Provinz verschlagen, weil er mit seiner neuesten Eroberung auf der Flucht vor dem Privatdetektiv seiner Noch-Ehefrau ist. Während der abgrundtief schlechten Talentshow des ortsansässigen Hotels bemerkt er den Komiker Ralf, der nicht nur durch einen sicheren Auftritt und gutes Timing aus der Masse hervorsticht – Ralf behauptet, er stamme aus der Zukunft, nur habe ihm sein Manager versprochen, ihn im Jahre 1969 in Woodstock aus der Zeitmaschine treten zu lassen.
Balaban nimt den seltsamen Kauz unter Vertrag, der sich bald zum Star mausert und mit „Ralfs Welt“ eine eigene TV-Show zur besten Sendezeit bekommt. Der Science-Fiction-Autor Dexter Lampkin lässt sich überreden, Texte für die Show zu schreiben. Er entwickelt die Details der düsteren Zukunft, aus der Ralf zu stammen behauptet.
Lampkin hat vor Jahren mit dem Roman „Die Transformation“ sein idealistisches Hauptwerk geschrieben, in welchem die Menschen Signale von einer unwesentlich weiter entwickelten extraterrestrischen Spezies empfangen, die ihre Probleme mit der Umweltzerstörung, Atomkraft und Gentechnik nicht in den Griff bekommen hat. Es scheint ein allgemeines Phänomen zu sein, dass Zivilisationen in einem gewissen Entwicklungsstadium sich selbst durch die eigene Unvernunft zerstören. Einige Wissenschaftler fassen da den Plan, der Menschheit dieses Schicksal zu ersparen und entwerfen eine falsche Aliengottheit, die der Allgemeinheit den Weg in die lichte Zukunft weisen soll. Der Roman war ein Verkaufsflop, aber Lampkin ist der Glaube geblieben, Science-Fiction könne die Welt verändern.
Zweite wichtige Person in der Kreativzone der Show ist Amanda Robin, eine New-Age-Anhängerin, die in Ralf eine Manifestation des Zeitgeistes sieht. Beide, Lampkin und Robin, meinen mit „Ralfs Welt“ Einfluss auf die Menschen nehmen zu können. Ralf selbst wirkt fast wie eine leere Leinwand, auf die sie ihre Vorstellungen projizieren können: Ralf ist ebenso sehr Abgesandter einer kaputten Zukunft, der die Menschheit auf den richtigen Weg führen will, wie auch Avatar des Zeitgeistes, ein neuer Messias, der x-te Versuch nach Prometheus, Jesus Christus und JFK – oder vielleicht auch nur ein durchgedrehter Provinzkomiker.
Richtig klar wird dies nie. Eine Zeitlang funktioniert die Sendung gut, erfüllt Ralf die unterschiedlichen in ihn gesetzten Erwartungen – bis er immer mehr über seine Rolle hinauswächst.
Spinrad hat mit „He walked among us“, so der Originaltitel, ein sehr ambitioniertes Werk verfasst, das weit mehr als andere Bücher, die dieses Etikett aufgeklebt bekommen haben, die Bezeichnung „Roman des neuen Jahrtausends“ verdient. Es ist ein großer Rundumschlag, den Stand der modernen Zivilisation betreffend. Die ökologischen und wirtschaftlichen Probleme sind ja schon oft thematisiert worden, Spinrad geht allerdings noch weiter, indem er hinterfragt, was für den Einzelnen überhaupt Realität ist.
Deshalb ist „Die Transformation“ auch wieder ein Medienroman – und ähnlich wie Spinrads letztes Werk dieser Art, „Bilder um 11“, ist er bei allen brillant gestalteten Szenen doch etwas anstrengend. Voraussetzung für das Lesen ist der Glaube, eine solche Einpersonensendung wie „Ralfs Welt“ könne wirklich eine größere Menge von Menschen bewegen. Spinrad packt eine Menge kluger und auch streitbarer Ideen in seinen sehr umfangreichen Roman, den man gern hier und da etwas kürzen dürfte. Gerade in der Phase, bevor sich Ralfs Wandel vom Komiker aus der Zukunft zu einer ernsthafteren und undurchschaubareren Person ganz vollzieht, ist „Die Transformation“ ziemlich zäh. Man kann Spinrad auch eine gewisse Selbstverliebtheit in seinem Roman nicht absprechen. Neben dem Gehalt an Ideen fällt überdies wieder einmal Spinrads Fähigkeit auf, glaubhafte und auch sehr unterschiedliche Charaktere zu schaffen.
Ein zweites großes Thema sind die Science-Fiction und ihr Fandom. Hier ist Spinrad richtiggehend gallig: Lampkin erträgt Cons, wie die meisten Autoren, nur in einer Mischung aus Bekifft- und Betrunkensein. Die meisten Fans sind zwar überdurchschnittlich intelligent, fallen aber sonst durch unglaubliche Körperfülle, eng beieinanderstehende Augen, seltsame Aufmachung und pure soziale Inkompetenz auf. Auf den Conventions kann ein Autor sich kaum vor Groupies retten. Andererseits glaubt auch ein Dexter Lampkin an die Macht der Literatur, glaubt er, mit seinen Büchern, mit Science-Fiction die Menschen nicht nur zum Nachdenken sondern auch zum Handeln zu bringen.
Das Buch ist nichts für Zartbesaitete: Gerade in der Nebenhandlung um Lotter Lotti, die von Crack abhängig wird und am Tiefpunkt ihrer Existenz im Gewirr der New Yorker U-Bahn-Tunnel eine Begegnung der dritten Art mit Ratten hat, geht es sowohl im Inhalt als auch im Stil äußerst heftig zur Sache.
Wer sich auf die Reise in „Ralfs Welt“ einlässt, kann etliche faszinierende Stunden mit Spinrads Roman verbringen. Man muß sich jedoch einige Erholungspausen gönnen; der Wiedereinstieg wird einem durch die etwas redundante Art des Erzählens, bei der etliche Einzelheiten an späterer Stelle noch einmal wiederholt werden, erleichtert. Und man sollte auch als Fan das Fandom nicht nur mit größtem Ernst betrachten können.
Übrigens ist „Die Transformation“ eine Originalausgabe – bis jetzt hat sich kein amerikanischer Verlag für das Manuskript finden lassen. In englischer Sprache wurde der Roman dann zwar 2003 veröffentlicht, aber auch nur im eBook-Format. Sehr lobenswert, dass der |Heyne|-Verlag sich nicht scheut, auch kontroverse und schwierige Romane zu veröffentlichen, denen aber wohl leider (wie Lampkins „Transformation“) ein breites Publikum versagt bleiben wird; bislang gab es auch, wie bei vielen Werken Spinrads, keine weiteren Auflagen des Romans.
_Andreas Hirn_ © 2002
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Unterstützung und Genehmigung unseres Partnermagazins [Buchrezicenter.de]http://www.buchrezicenter.de/ veröffentlicht.|
Nach dem Fortschreiten der globalen Erwärmung herrschen in der Mitte des 21. Jahrhunderts katastrophale Zustände auf der Erde. In Libyen gelingt es Monique Calhoun, für das |Brot & Spiele|-Syndikat, dessen Angestellte und Bürger-Aktionär sie ist, ein weitaus besseres Geschäft mit (vordergründigen) Bewässerungsanlagen abzuschließen, als zu erwarten war. |B&S| schickt sie daraufhin nach Paris, wo sie für die diesjährige UNACOCS den VIP-Service betreuen soll. Diese UN-Konferenz beschäftigt sich mit dem Problem der globalen Erwärmung und den Möglichkeiten, das Klima wieder an das gewohnte Maß anzupassen.
Doch auch hier gibt es zwei Seiten; denn zwar gehören Afrika und Südamerika zu den Verlierern des Klimawandels, und auch die USA haben etwas verloren – Florida und Louisiana nämlich -, doch gibt es auch Gewinner. Paris zum Beispiel hat nun einen ganzjährigen Bilderbuchsommer, und auch den Nordeuropäischen Staaten und Sibirien kommt inzwischen eine ganz andere Bedeutung zu. Eine Bedeutung, die die Gewinner des Klimawandels nicht so einfach wieder hergeben wollen.
So entwickelt sich ein anscheinend undurchschaubares Intrigenspiel um die Möglichkeit eines Venuseffekts, der vielleicht von einem eventuell vorhandenen perfekten Klimamodell vorausgesagt werden könnte …
Mit dem „tropischen Millennium“ (naja, über die Qualität eines deutschen Titels kann man trefflich streiten …) beweist Norman Spinrad wieder einmal, dass er zum Besten gehört, was die internationale SF-Szene zu bieten hat. Dieses Gedankenspiel einer möglichen Zukunftsvariante ist hochinteressant, politisch brisant und teilweise mit einem bösem Sarkasmus behangen, wie ihn wohl nur Spinrad so meisterhaft beherrscht.
Gerade dieser Zynismus ist es, der diesen Roman höchst lesenswert macht. Hier gibt es nirgendwo ein Gut und Böse, kein Schwarz und Weiß. Alles versinkt in einem übergreifenden Grau. Die Syndikate sind internationale Konzerne, Aktiengesellschaften gleich, die je nach Satzung ihre Mitarbeiter zu sogenannten „Bürger-Aktionären“ und somit zu Anteilseignern machen. Soweit ist das ja nichts unbedingt Neues – doch die Syndikate haben es in sich. So gibt es zum Beispiel ein |Böse Buben|-Syndikat, das angeblich aus der Mafia und ähnlichen Vereinigungen heraus entstanden sein soll. Zu Anfang in Libyen plant man dann auch gleich, die angeblichen Bewässerungspläne der Wüste zum Hasch- und Marihuana-Anbau zu nutzen, ganz so, wie man dies von einer solchen Vereinigung erwarten sollte. Ebenso auch die Auftragsmorde. Doch hier trügt der Schein, verwischt das Schwarz zu Grau (dies genauer auszuführen würde bedeuten, einiges vom Lesespaß des Romans vorwegzunehmen).
Auch auf der anderen Seite, bei den Syndikaten, die die Erderwärmung bekämpfen wollen, ist nicht alles eitel Sonnenschein. Die vermeintlich Guten wandeln sich zu den Bösen – oder vielleicht doch wieder zu den Guten?!? Das allumfassende Grau schlägt auch hier wieder zu. Dabei lässt Spinrad den Leser niemals längere Zeit in dem Gefühl, er wüsste nun, wer denn hier die „Guten“ sind und wer die „Bösen“. Geschickt hält er selbst seine Protagonisten in dieser Grauzone gefangen und entwickelt um sie eine furiose Handlung um Moral und Ethik – und der unterschiedlichen Sichtweisen hierzu.
„Das tropische Millennium“ ist dabei auch ein hochgradig politischer Roman, ohne wirklich Politiker als Charaktere zu schildern oder sie gar als Hauptpersonen anzubieten. Unwillkürlich fühlt sich der Leser an die reale Politik erinnert, wenn er bei dem einen Syndikat mal mit dem einen Aspekt sympathisiert und beim anderen halt mit dem anderen, ohne dass eines der Syndikate wirklich eine allumfassend vertretenswerte Stellung bezöge.
Dies alles verpackt Spinrad ein einen höchst interessanten und atemberaubend spannenden Roman – ohne dass er großartig irgendwelche Action-Elemente einsetzen müsste. Der Autor interessiert sich rein für die gesellschaftlichen Aspekte seiner Handlung – und reißt den Leser damit wesentlich mehr mit, als dies mit einer actionlastigen Handlung überhaupt möglich gewesen wäre. Es ist jedenfalls verdammt schwierig, diesen Roman aus der Hand zu legen, bevor man ihn beendet hat. Und wenn auf dem Klappentext die |San Diego Tribune| mit „Ein Roman, wie er aktueller nicht sein kann. Lesen Sie ihn, bevor der Meeresspiegel ansteigt“ zitiert wird, so habe ich dem eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Dieser Roman gehört eindeutig in das Bücherregal eines jeden Lesers anspruchsvoller SF! Und derjenige, der sich sonst mit gesellschaftspolitischen Schilderungen nicht so anfreunden kann, sollte zumindest einmal einen Blick in „Das tropische Millennium“ werfen.
Fazit: Ein weiteres Meisterwerk Norman Spinrads. Dieser sarkastisch-zynische Blick auf eine Gesellschaft, die innerhalb des nächsten halben Jahrhunderts zu einem Grau-in-Grau mutiert ist, sollte in keinem Bücherregal fehlen. Zumal man sich die Frage stellt, wie weit die jetzige Gesellschaft von dieser Schilderung noch entfernt ist…
_Winfried Brand_
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Unterstützung und Genehmigung unseres Partnermagazins [Buchrezicenter.de]http://www.buchrezicenter.de veröffentlicht.|
Ein tödliches, sich global verbreitendes Virus hat die Menschheit in zwei Gruppen gespalten. Infizierte, die mit stark verkürzter Lebensdauer in heruntergekommenen Vorstadtghettos ein von Gewalt und Willkür geprägtes Leben fristen, und Nichtinfizierte, mit Privilegien ausgestattet und von den Aussätzigen weitestgehend isoliert in Luxus schwelgend. Da mit Hilfe eines Blutaustausches Infizierte geheilt werden könnten, ist die einzig wirklich zählende Währung Blut. Daran haben jedoch die elitären Bonzen kein Interesse und horten stattdessen ihr selbst gespendetes oder auch zusätzlich erworbenes Blut in gigantischen Depots.
Dallas, ein Computer- und Sicherheitsexperte, entwickelt komplexe und trickreiche Verteidigungsanlagen, um diese Blutbanken zu schützen. Als klar wird, dass seine Tochter an einer schweren genetischen Erbkrankheit leidet, die nur mit kontinuierlichen Bluttransfusionen gemildert werden kann, erklärt ihn sein Arbeitgeber zum Sicherheitsrisiko. Er würde für die Behandlung seiner Tochter mit der Zeit mehr Blut konsumieren als er sich leisten kann. Die Firma setzt den Killer Rimmer auf ihn an. In einer gnadenlosen Jagd gelingt es Dallas zunächst zu entkommen, doch Rimmer tötet seine Familie. Dallas schwört Rache und schmiedet einen Plan, die größte Blutbank auf dem Mond auszurauben. Dazu muss er den Supercomputer Descartes überlisten und, wie Theseus den Minotaurus, einen Roboter in einem finsteren und voll böser Überraschungen steckenden Labyrinth überwinden.
In großen Teilen erfreulich anspruchsvoll liest sich der Roman des Schotten und hebt sich im Niveau wohltuend von denjenigen seiner amerikanischen Kollegen ab, nicht zuletzt durch die zahlreichen Anspielungen auf klassische Philosophie beziehungsweise auf die griechische Mythologie und die Apokalypse. Den Titel „Der zweite Engel“ hat Kerr vermutlich der Johannes-Offenbarung entlehnt:
|“Und der zweite Engel goß aus seine Schale ins Meer; und es wurde zu Blut wie von einem Toten, …“| (Joh. Offb. 16,3; Luther-Fassung von 1984).
Etwas ermüdend können zwar die zahlreichen Anmerkungen wirken, in denen Kerr die wissenschaftlichen Hintergründe zu erklären versucht, doch die fein durchdachte Geschichte mit der richtigen Dosis Spannung, faszinierenden Spekulationen in Richtung Nanotechnik und Quantenphysik, interessanten technischen Spielereien und einem überraschenden Schluss vertreibt die zähen Passagen zuverlässig und schnell. Dabei kann man auch gelassen über manche biologische Unstimmigkeiten hinwegsehen. Die Vermischung zwischen Fiktion und Realität mag zwar hin und wieder zu einer schwer nachvollziehbaren Logik führen, ist aber sehr unterhaltsam.
Eine Stelle, etwa in der Mitte des Buches, als sich der rachedurstige Dallas mit seiner Crew Richtung Mond aufmacht, um die |First National Blood Bank| auszurauben, erscheint sehr schwach. Der Stil verflacht hier merklich, die Dialoge zwischen den Hauptpersonen sind ziemlich banal und die Spannung kommt erst wieder, als sich der Bösewicht Rimmer eindrucksvoll zurückmeldet.
Hin und wieder mag man starke Ähnlichkeiten zu Dicks „Blade Runner“, „Total Recall“ und Gibsons „Neuromancer“ entdecken, doch auch wenn Kerr hier Vorbilder hatte, gelingt es ihm vortrefflich, sie mit seinen eigenen Ideen zu einem runden Gesamtbild zu verflechten. Ein prächtiges Buch, das in jeder guten SF-Sammlung einen Platz verdient hat:
„Seid guten Blutes“.
_Jim Melzig_
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Unterstützung und Genehmigung unseres Partnermagazins [X-Zine]http://www.x-zine.de veröffentlicht.|
Nachtrag: „Der zweite Engel“ erscheint derzeit zusammen mit „Game Over“ in einem Band bei |Wunderlich| zum Einzelbuchpreis. Zugreifen!
Drachenerzählungen finden wir in allen Kulturen der Erde, und sie geben nach wie vor den Märchenforschern und Mythenkundlern Rätsel auf, die nicht eindeutig geklärt sind. In der christlichen Kultur vor allem mit dem Teufel gleichgesetzt, sieht es mit dem Drachen in anderen Kulturen – vor allem in China – ganz anders aus. C. G. Jung sah den Drachen als das Unbewusste und intuitiv Weibliche. Diesem Gesichtspunkt schließen sich viele an, indem sie dem Drachen das Dunkle zurechnen und die zahlreichen Drachentöter, wie den Heiligen Georg oder Siegfried, den Sonnen- und Lichtkräften zuordnen. Seit |Tiamat|, der ältesten Überlieferung einer drachenartigen Urgöttin Babylons, zieht sich die Geschichte der Drachen in verschiedensten Ausprägungen durch die Zeiten bis heute zu uns. Im deutsch-germanischen Sprachschatz ist der Begriff |Drache| dabei gar nicht mal so alt. Wir sprachen vom |Lindwurm|, ein Name, der sich vom althochdeutschen |lint| (= weich, zart, biegsam) und |wurm| (=Wurm, Schlange) ableitet.
Die beiden Autoren des „Drachenbuches“ bieten einen Einblick in die wundersame Welt der Drachen, der sich vor allem an eine jüngere Leserschaft richtet. Für Märchenfreunde, Hobbyritter und Fantasyfans ist es eine wahre Fundgrube.
Natürlich kommt der bekannteste Drachenkämpfer Siegfried auch nicht zu kurz und ist Gegenstand eines eigenen Kapitels. Für Leser in Worms ist dies deswegen interessant, da die verschiedenen Versionen der Sage detailliert dargestellt sind. Hier heißt bekannterweise der Drache |Fafnir|, der den Schatz der Nibelungen hütet. Neben dem Nibelungenlied gibt es mehrere Lieder der älteren |Edda|, den Völsungen, die Thidrekssage, das Lied des Hünen Seyfried, das zwar erst Jahrhunderte später aufgezeichnet wurde, aber in manchen Teilen genauso alt wie die altnordischen Dichtungen ist, sowie das umfangreiche Volksbuch von dem gehörnten Siegfried. Ausgerechnet im Nibelungenlied wird – anders als etwa in Wagners |Ring des Nibelungen| – Siegfrieds Drachenkampf nur am Rande erwähnt.
Neben den Mythen aus allen Kulturbereichen unserer Welt kommen auch die Randgebiete zur Sprache, wie zum Beispiel die Drachenadern, hierzulande eher als „geomantische Leylinien“ bezeichnet, die Dinosaurierforschung, der alchemistische Drache als Symbol des Zustands der unvollkommenen Materie, Drachen in Wappen, Kunst und Literatur. Lohnenswert ist die Aktualität, welche die Autoren in ihrem durchgehend und reichhaltig illustrierten Werk berücksichtigten, wodurch die modernsten Varianten in der Kinderliteratur von Michael Endes „Jim Knopf“, in dessen Gefolge Astrid Lindgrens „Die Brüder Löwenherz“ in den siebziger Jahren eine Flut von Kinderbüchern mit Drachen auslöste, bis hin zu den Drachen in der Fantasy ebenso Beachtung finden. Auch durch Filme wie „Dragonheart“ und die zahlreichen Fantasy-Rollenspiele bewirken Drachen noch heutzutage unverändert eine magische Faszination. Es gibt sie noch und sie sind erneut aus ihrem Teufelsloch, in dem sie so lange sitzen mussten, herausgekommen.

Der Autor
Robert A. Heinlein – Starship Troopers – Sternenkrieger weiterlesen
Obwohl der Autor Vernor Vinge (* 10. Oktober 1944) der modernen Space-Opera entscheidende Impulse geben konnte, ist er doch eher unbekannt, zumindest in Deutschland. Unverdient, aber aus einleuchtendem Grund, ist er doch nicht gerade ein Vielschreiber, seine beiden bekanntesten Werke sind „Ein Feuer auf der Tiefe“ (1992) und „Eine Tiefe am Himmel“ (1999), diese beiden leicht merkwürdig betitelten Romane bürgen jedoch für Qualität: Beide gewannen jeweils einen |Hugo Award| und wurden für den |Nebula| nominiert, hierzulande gewann „Eine Tiefe am Himmel“ zudem den renommierten Kurd-Laßwitz-Preis.
Der Mathematiker und Computerwissenschaftler Vinge dozierte bis zum Jahr 2002 an der |San Diego State University|, seitdem konzentriert er sich ganz auf seine schriftstellerische Tätigkeit. Man kann also für die Zukunft viel von ihm erwarten.
Seine Konzeptionen eines möglichen Cyberspace, sowie seine Theorien zu technologischer Singularität (d.h. Fortschritt maschineller Intelligenz zu einem Grad, den der erschaffende Mensch geistig nicht mehr erfassen kann), Nanotechnologie und lernfähigen Netzwerken, bis hin zur künstlichen Intelligenz, aber auch menschlicher Evolution und gesellschaftlicher Entwicklung bis hin zur Transzendenz stellen den Kern seines Werkes dar.
Dabei mischt Vinge bekannte Elemente, zum Beispiel die Newsgroups des Usenet, mit phantastischen Elementen seiner Erzählung und schafft so eine oft lehrreiche Verbindung von Bekanntem mit neuen Konzepten.
_Die Entdeckung neuer Welten und Zivilisationen_
„Eine Tiefe am Himmel“ spielt 20.000 Jahre vor dem Vorgänger „Ein Feuer auf der Tiefe“, den man |nicht| kennen muss, beide Romane sind vollständig unabhängig voneinander lesbar.
Die Menschheit hat noch nicht die notwendigen Voraussetzungen für überlichtschnelles Reisen entwickelt, und so fliegen Raumschiffe und ihre im Kälteschlaf liegenden Besatzungen Jahrhunderte zwischen den Sternen. Zahlreiche menschliche Zivilisationen sind während vieler Jahrtausende entstanden und untergegangen, zurückgefallen in die Barbarei und wieder aufgestiegen zur Raumfahrt. Doch eine Zivilisation ist etwas Besonderes, die Händlerzivilisation der |Dschöng Ho|. Gegründet von einer Händlerin und einem ehemaligen Barbarenprinzen des Mittelalters, dem legendären Pham Nuwen, stellt diese eine Ausnahmeerscheinung dar: Die Flotte der Dschöng Ho, benannt nach einem chinesischen Entdecker, sendet Wissen in einer Art galaktischen Wikipedia aus, überall wo Dschöng-Ho-Schiffe den Weltraum durchkreuzen.
So erreichen Zivilisationen, sobald sie den Funk entwickelt haben, schneller ein raumfahrendes Niveau, raumfahrende Zivilisationen erfahren Nachrichten aus der ganzen Galaxis und gewisse Standardtechnologien werden so weiterverbreitet und bewahrt – gemäß dem Traum Pham Nuwens, dessen Meinung nach eine intergalaktische Zivilisation nur auf lange Frist bestehen kann, wenn sie Hilfe von „außen“ erhält, genauso wie gestrandete Raumfahrer nur mithilfe einer Zivilisation und deren Industrie den Keim der Technik bewahren können.
Bis auf Spuren einer untergegangenen Rasse, und eine in frühen Entwicklungsstadien befindliche, hat die Menschheit aber noch keinen Kontakt mit extraterrestrischer Intelligenz gehabt. So ist es eine Sensation, als man vom fernen „EinAus-Stern“ fremdartige, nichtmenschliche Funksignale empfängt. Ein Familienclan der Dschöng Ho macht sich sofort auf den Flug zum fernen Stern, der schon vorher Beachtung fand, da er regelmäßig für Jahrzehnte hell erstrahlt, um dann für eine fixe Periode zu erlöschen.
Bei der Ankunft erwartet die Dschöng Ho jedoch eine nicht ganz so freudige Überraschung: Eine in Nähe zum EinAus-Stern, zwischenzeitlich in die Barbarei zurückgefallene Zivilisation ist ebenfalls nahezu zeitgleich eingetroffen – auf einem niedrigeren technologischen Stand, aber mit viel mehr Ausrüstung und Personal. Ironischerweise haben die sogenannten „Aufsteiger“ sich das überall im Menschenraum verbreitete Wissen der Dschöng Ho angeeignet, ebenso die menschliche |lingua franca|.
Kommunikation ist somit kein Problem, nur traut man einander kein bisschen: Die Aufsteiger und ihr Anführer Tomas Nau gehören vermutlich, so kann man den bekannten Daten über sie entnehmen, einer faschistisch orientierten Sklavenhaltergesellschaft an. Höchste Vorsicht ist geboten, doch die Aufsteiger haben einen Trumpf in der Hinterhand, mit dem die Dschöng Ho nicht rechnen können …
Der Coup der Aufsteiger gelingt, auch wenn in einer Raumschlacht beide Flotten sich schwersten Schaden zufügen und die überlebenden Dschöng Ho in den Dienst der Aufsteiger gepresst werden müssen. Sie sabotieren die Pläne des „Hülsenmeisters“ Tomas Nau, doch dieser spielt mit ihnen und kann schließlich sogar Nutzen aus den Anschlägen ziehen: Gezielte Fälschung von Tatsachen und Fakten und seine „Geheimwaffe“ machen es möglich.
„Fokus“ ist es, was die Aufsteiger zu einer Sklavenhaltergesellschaft gemacht hat. Eine im Heimatsystem der Aufsteiger wütende Krankheit, Geistesfäule genannt, wurde bezwungen und ihre einzigartigen Möglichkeiten entdeckt: Entsprechend konditionierte Menschen werden auf dem jeweiligen Fachgebiet zu Spezialisten, die ihre ganze Kapazität nur noch auf einen Bereich konzentrieren. Ein normaler Mensch wird zum Spezialisten, ein begabter Mensch oder gar ein Genie wird durch „Fokus“ zu übermenschlichen Leistungen befähigt, bedarf aber der Koordination durch normale Menschen.
So wurde die Gesellschaft der Aufsteiger geboren, die Hülsenmeister wurden Herren und Meister effizienter und stets gehorsamer Sklaven.
Aufsteiger und Dschöng Ho haben sich gegenseitig so schwer geschädigt, dass man auf Hilfe der Spinnenwesen angewiesen ist, die in Kürze erwachen werden: Gemäß den Theorien Pham Nuwens können sie sich ohne die technische Unterstützung einer Zivilisation nicht mehr selbst helfen.
Während überlebende Dschöng Ho in einer Atmosphäre der perfekten Überwachung und nahezu totalen Kontrolle verzweifelt einen Aufstand planen, ist Hülsenmeister Tomas Nau schon am überlegen, wie er die Spinnenwesen täuschen, unterwerfen und seinen Zwecken dienlich machen kann …
_Die Spinnen in ihren Tiefen_
Während sich im Weltraum ein Drama abspielt, erwacht die Spinnheit und macht dank ihres Universalgenies Scherkaner Unterberg gewaltige Fortschritte: Er ist ein Mix aus Armstrong, Oppenheimer, Einstein, Hawking und Hannibal. Als erster Spinn bezwang er das „Dunkel“ und bewegte sich an der Oberfläche der Welt während der „Aus“-Phase der Sonne voran, sabotierte Versorgungsdepots hinter der Front und entschied so einen Krieg.
Die Entdeckung der Kernkraft ermöglicht es zukünftigen Generationen, auch während des Dunkels zu leben und nicht in Winterschlaf verfallen zu müssen, was eine ganze Reihe sozialer und religiöser Probleme auslöst: So kommt es zum Eklat, als Scherkaners zur „Unzeit“ geborene Kinder in seiner populären Radiosendung „Die Kinderstunde der Wissenschaft“ auftreten – diese Kindersendung gibt den Menschen übrigens am meisten Aufschluss über Sprache und Technologie der Spinnen. Kinder während der Ein-Phase des Sterns zu zeugen, ist moralisch nur bei deren Beginn angebracht, damit die Kinder fertig ausgebildet sind und den Kälteschlaf der kommenden Dunkelphase überstehen können. Doch nicht nur Gutes geht mit der Kerntechnik einher: Viele Nationen können Grundlagen erbeuten, aber nicht genug, um ebenfalls Kernreaktoren zu bauen, doch für Atombomben reicht das Wissen bereits aus …
Konflikte zwischen fundamentalistischen Staaten und Unterbergs Nation werden gezielt von den Aufsteigern geschürt. Unterberg ist mittlerweile alt und senil geworden, seine Freunde haben keine Ahnung von der Gefahr, Wissenschaftler und Personen, die außerirdischen Einfluss vermuten, werden für verrückt erklärt …
Derweil tut sich auch bei den Menschen einiges: Tomas Nau würde es wohl nicht glauben, aber sein großes Vorbild, der legendäre Pham Nuwen, ist einer der versklavten Dschöng Ho. Nuwen erkennt den Nutzen des Fokus, würde ihn gerne für seine Zwecke gebrauchen, er hat einige Trümpfe in der Hinterhand, um das perfekte System auszuschalten, die er raffiniert zu nutzen weiß …
_Liebenswerte Spinnen und faszinierende Ideen_
Vinge beweist viel Phantasie – seine Ideen einer kosmischen Zivilisation und sein Held Pham Nuwen konnten mich begeistern. Phams Geschichte ist nur eine von vielen, aber mit Abstand die interessanteste: Als Barbar auf dem mittelalterlichen Planeten Canberra geboren, wurde er Liebhaber der älteren raumreisenden Händlerin Sura Vinh und gründete mit ihr das Handelsimperium der DschöngHo, Familienclans, die von einer gemeinsamen Idee zusammengehalten werden. Diese Ideen werden bestätigt: Ohne die Hilfe einer Zivilisation würden Aufsteiger und Dschöng Ho im EinAus-System nicht überdauern können, geschweige denn jemals wieder starten können.
Aber auch andere Schicksale werden beleuchtet: So das des Anwärters Ezr Vinh; nachdem Nau alle Führungsoffiziere umgebracht hat, ist er der überforderte neue Anführer der zur Kooperation genötigten Dschöng Ho. Seine Freundin Trixia Bonsol ist fokussiert, ihr Talent als Übersetzerin der völlig fremdartigen Spinnensprache unerreicht – Nau wird sie wohl niemals vom „Fokus“ befreien. Die Aufsteigerin Anne Reynolt ist ein besonderer Fall: Sie ist eine der wenigen Personen, die man auf Menschenführung fokussieren konnte. Sie kontrolliert die „Blitzköpfe“ genannten Fokussierten, welche Überwachung und Abwehr von Rebellionen sowie die Automatik der Aufsteigerschiffe koordinieren. Das Besondere, geradezu Zynische an ihrem Schicksal: Sie war eine der erbittertsten Gegnerinnen der Aufsteiger … bis man sie fokussiert hat. Eine weitere tragische Figur ist Qiwi Lisolet, die Tochter der ehemaligen Kommandatin, die von Nau als Geliebte missbraucht wird – sobald sie ahnt, dass er sie über gewisse Fakten der Vergangenheitbelügt und betrügt, wird sie neu „konditioniert“ und einer Gehirnwäsche unterzogen, ihre Erinnerung teilweise gelöscht.
Wenn man „Ein Feuer auf der Tiefe“ und die dort vorgestellten Ideen kennt, weiß man, dass Vinge den Menschen als limitierenden Faktor der Entwicklung ansieht – die Technologie ist ihm weit voraus, der Mensch ist kaum imstande, sie voll auszunützen. „Fokus“ kann das zum Teil beheben – etwas, das auch der geheim eine Revolution planende Pham Nuwen ahnt. „Fokus“ würde seinen Traum einer effizienter operierenden Dschöng Ho ermöglichen, die Welten vor dem Rückfall in die Barbarei rettet, was ihm selbst nur ein einziges Mal gelang, aber zu seinem legendären Ruf beitrug. Aber ist der Preis des „Fokus“ es wirklich wert? Wie wird Nuwen sich entscheiden?
Interessanter als die Probleme der Menschen sind jedoch die Spinnenwesen: Feldwebel Hrunkner Unnerbei, der geniale Scherkaner Unterberg und seine Frau Generalin Viktoria Schmid sowie ihre Familie und die gesamte Spinnenzivilisation wachsen dem Leser ans Herz. Die menschlichen Namen erklärt Vinge auf gerissene Weise: Die wahren kann kein Mensch aussprechen, aber sie entsprechen dem Wesen der Spinnen am ehesten und wurden ihnen von der Übersetzerin Trixia Bonsol verliehen. Diese muss auch für die „Vermenschlichung“ der spinnischen Verhaltensweisen herhalten.
Hier macht es Vinge sich allerdings ziemlich leicht; Spinnen, die sich in ihren Tiefen während des Dunkels durch während dieser Zeit gegrabene Tunnel gegenseitig „vergasen“ und ähnliches, all das erinnert an die Zeit zwischen dem 1. und 2. Weltkrieg, ebenso die Entdeckung und Nutzung der Atomenergie als Waffe. Der technische Stand und die Entwicklung der Spinnen, Fernsehen und Radio zum Beispiel, sind eine exakte Kopie menschlicher Entwicklungsgeschichte. Religiöse Moralvorstellungen, Terroranschläge, revolutionäre soziale Neuerungen – all das ist ein Spiegel der Menschheit, keine wahrhaft fremdartige Rasse/Zivilisation.
Dies ist auch einer der wesentlichen Kritikpunkte an der „Tiefe“: Faszinierende Analogien bei größerer Fremdartigkeit bot bereits der Vorgänger „Ein Feuer auf der Tiefe“ (wobei hier eine andere „Tiefe“ gemeint ist). Ebenfalls fehlt mir ein wenig der |sense of wonder|, den transzendente Superintelligenzen und überlichtschneller Raumflug sowie Vinges Gliederungen der Galaxis in gewisse Zonen der Entwicklung boten.
Dafür menschelt es wesentlich mehr in der „Tiefe“, auch hat Vinge schriftstellerisch noch einmal deutlich zugelegt, seine Charaktere sind deutlich feiner ausgearbeitet und die Konzepte, die er vorbringt, sind einfacher und werden klarer verständlich, wobei er viel mit Analogien arbeitet, zum Beispiel der Bestätigung von Nuwens Theorien im Fall der gestrandeten Flotte und der der Menschheitsentwicklung analog verlaufenden der Spinnen.
Ob der Nachfolger nun besser oder schlechter ist, ist Geschmackssache. Meine Empfehlung ist, zuerst „Eine Tiefe am Himmel“ zu lesen, da es leichter verständlich ist und chronologisch 20.000 Jahre vor dem zuerst veröffentlichen „Ein Feuer auf der Tiefe“ liegt – zusätzlich gibt die „Tiefe“ dem Charakter Pham Nuwen auf angenehme Weise die Vorgeschichte, die man im „Feuer“ nur in Bruchstücken erfährt. Zudem versteht man die Probleme von Zivilisationen ohne überlichtschnelle Raumfahrt besser, wenn man dieses Buch davor liest.
Wer beide Romane kennt, ist im Urteil gespalten: Handwerklich ist die „Tiefe“ besser, die faszinierenderen Ideen hat meiner Ansicht nach aber das „Feuer“.
Eines ist jedoch sicher: Beide Romane haben ihre |Hugos| zu Recht erhalten, beide haben mich fasziniert und sind eine Empfehlung wert und behandeln zahlreiche hochinteressante Aspekte, bessere und fundiertere Science-Fiction findet man nur selten. Die anspruchsvolle Übersetzung ist Erik Simon wirklich hervorragend gelungen, getrübt nur durch kleinere Fehlerchen des Korrektorats (Buchstabendreher etc.).
Mein Tipp: Zuerst „Eine Tiefe am Himmel“ lesen und bei Gefallen „Ein Feuer auf der Tiefe“ sofort nachschieben!
Mehr über Vernor Vinge und sein Werk:
http://en.wikipedia.org/wiki/Vernor_Vinge
Es herrscht Krieg. Aufgrund eines Missverständnisses zwischen den Menschen und den außerirdischen |Tauren| ist ein erbitterter, brutaler Kampf zwischen diesen beiden Rassen ausgebrochen. Geführt wird der Krieg auf hohem technologischem Niveau im Weltraum und auf fremden Planeten – der einfache Soldat Will Mandella ist der Protagonist dieses Romans. Nach einer brutalen Ausbildung befindet er sich auf einem Raumschiff und wird von Gefecht zu Gefecht gebracht. Trotz modernster Ausrüstung und psychischer Konditionierung lässt ihn nur der ausgiebige Konsum von Drogen die Gräuel des Krieges ertragen. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten der Raumschiffe und der damit verbundenen Zeitdilatation vergehen auf der Erde Jahrzehnte und Jahrhunderte, während die Einsätze für die Soldaten von relativ kurzer Dauer sind. Zurück auf der Erde, kann sich Mandella nicht wieder eingliedern. Wichtige Bezugspersonen sind verstorben und die gesellschaftlichen Systeme wirken fremdartig auf ihn. Die Bevölkerung der Erde arbeitet nur noch für den Krieg, der sich verselbständigt hat. Mandella verpflichtet sich erneut und fliegt zum nächsten Kriegsschauplatz dieses ewigen Krieges …
Joe Haldeman wurde 1943 in Oklahoma City geboren und studierte Physik und Astronomie. In den Jahren 1968–1969 kämpfte er als Soldat in Vietnam und wurde schwer verwundet (Auszeichnung |Purple Heart|). Seit 1970 arbeitet Haldeman als Schriftsteller und ist seit 1983 am Massachussets Institute of Technology (MIT) tätig. Er ist verheiratet und lebt heute zeitweise in Florida und in Massachussets.
„Der ewige Krieg“ ist ein Anti-Kriegsroman, wie er schonungsloser kaum sein kann. Das Werk, das sowohl den |Hugo| als auch den |Nebula Award| gewonnen hat, reflektiert Haldemans Kriegserlebnisse in Vietnam. Der Mensch als Werkzeug – brutal instrumentalisiert für einen Krieg, den er nicht verstehen kann. Haldeman benutzt dabei die Mittel der Science-Fiction, um die Sinnlosigkeit des Krieges in aller Härte aufzuzeigen. Kommunikation zwischen Tauren und Menschen ist nicht möglich, Auslöser des Konflikts war ein Missverständnis, auf der Erde vergehen Jahrhunderte und der Krieg dauert an. Es ist eine albtraumhafte Welt und für den Protagonisten gibt es kein Entrinnen aus diesem Hades, wo jeder Tag dein letzter sein kann. Nachdem man überlebt hat, wird man mit einer Welt und Menschen konfrontiert, die man nicht mehr versteht. Eine Integration in diese Systeme ist nicht möglich – die Parallele zu den Vietnamheimkehrern in den USA ist überdeutlich. Der einzig mögliche Ausweg sind die weitere Verpflichtung als Soldat und die Rückkehr in ein hoffnungsloses Inferno. Während der Lektüre des Buches fiebert man förmlich mit dem Protagonisten mit – genau wie er frustriert und resigniert der Leser. Das Thema ist vor den derzeitigen Hintergründen unserer Welt aktueller denn je – immer wieder werden einem die Sinnlosigkeit und vor allem die menschenverachtende Schrecklichkeit eines Krieges vor Augen geführt. Dabei tut Haldeman dies nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern auf eine sehr intelligente Art und Weise. Das Buch ernüchtert und hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack – es ist sicherlich nichts für schwache Nerven. Ein Meisterwerk der Science-Fiction, dss das Thema „Krieg“ in einer nachhaltigen Art und Weise variiert – dazu ist es enorm spannend. Dieser Anti-Kriegsroman ist ein Klassiker – indes jedoch nicht nur für Fans des Genres geeignet, da die Botschaft dieses harten und schonungslosen Werks von 1972 gegenwärtiger und wichtiger ist denn je.
J. R. R. Tolkiens drei Hauptwerke sind so unterschiedlich im Ton, im Stil und in ihrer Beschaffenheit, dass man fast nicht glauben mag, dass sie alle aus der Feder eines Autoren stammen. „The Lord of the Rings“ (dt. „Der Herr der Ringe“) ist ein gigantisches, detailverliebtes Epos. [„The Silmarillion“ 408 (dt. „Das Silmarillion“) ist sowohl Mythos, Epos als auch eine breit angelegte Chronik von Tolkiens imaginärer Welt. „The Hobbit“ (dt. „Der kleine Hobbit“) jedoch, seine erste belletristische Veröffentlichung, ist ein verspieltes und leichtfüßiges Kinderbuch, das auch dem erwachsenen Leser das eine oder andere Lächeln aufs Gesicht zaubern wird. Vergeblich sucht man hier nach dem Faktenreichtum des „Silmarillion“ oder der Handlungsbreite des „Herrn der Ringe“. Stattdessen erzählt Tolkien im „Hobbit“ kurzweilig, gut gelaunt und vor allem mit einem guten Schuss Ironie, der nahelegt, dass der mittlerweile als Genie gefeierte Tolkien seine eigene Geschichte nicht unbedingt bierernst nimmt. Denn der „Hobbit“ soll in erster Linie unterhalten und Spaß machen!
Der Hobbit, das ist Bilbo Baggins, in den besten Jahren, delikatem und reichlichem Essen durchaus zugeneigt und ein Liebhaber guten Tabaks. Abenteuer sind das Letzte, woran er denkt, als Gandalf – seines Zeichens Zauberer – vor seiner Hobbithöhle auftaucht. Gandalf nun, komplett mit spitzem Zaubererhut und dem passenden Stab, sucht für eine Kompanie Zwerge einen vierzehnten Mann und hat sich in den Kopf gesetzt, dass Bilbo die perfekte Wahl wäre. So sieht sich der Arme tags darauf dreizehn hungrigen Zwergen unter der Führung von Thorin gegenüber, die ihn auf eine Reise zum Lonely Mountain mitnehmen wollen, um dem dort ansässigen Drachen Smaug einen ganzen Haufen Gold zu entwenden. Nun hat, wie bereits erwähnt, der sehr respektable Bilbo mit Abenteuern nichts am Hut, doch wäre die Geschichte hier zu Ende, hätte Gandalf es nicht geschafft, Bilbo aus seiner Höhle zu locken. So überstürzt muss er aufbrechen, dass er gar sein Schnupftuch vergisst.
Nun erleben Zwerge, Hobbit und Zauberer allerlei wundersame Abenteuer, bis sie zum Lonely Mountain kommen. So nimmt Bilbo beispielsweise dem geheimnisvollen Gollum einen gewissen Ring ab, der später noch eine prominente Rolle in Tolkiens Schaffen spielen soll. Auf dem Weg nach Rivendell wollen drei hungrige Trolle sie kochen. In den Misty Mountains geraten sie an eine ganze Horde Orks. In Mirkwood müssen sie sich mit Riesenspinnen und scheuen Waldelben rumschlagen. Und schließlich am Lonely Mountain angekommen, gilt es immer noch, einen ziemlich unleidlichen Drachen zu besiegen und einen Krieg zu verhindern, der zwischen Zwergen, Elben und Menschen ob des in greifbare Nähe geratenen Schatzes zu entbrennen droht. Und in all diesen prekären Situationen denkt Bilbo zwar am liebsten an seine gemütliche Hobbithöhle und sein zweites Frühstück; doch alles in allem erweist er sich zumeist als Retter in der Not und durchaus brauchbarer Abenteurer.
Dass „The Hobbit“ als Kinderbuch konzipiert ist, wird ziemlich schnell klar. Ein väterlicher Erzähler nimmt den (jugendlichen) Leser an die Hand, erklärt ihm Hobbits und Zauberer und Mittelerde und hält auch sonst mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Recht amüsant kommentiert er so, was in der Geschichte passiert, spricht den Leser von Zeit zu Zeit auch direkt an. Darüberhinaus ist der Roman in Kapitel eingeteilt, die sich jeweils gemütlich in einer Sitzung lesen lassen und jedes Mal ein abgeschlossenes Abenteuer behandeln. Außerdem ist „The Hobbit“ fast komplett bar aller Hintergrundinformationen, die das „Silmarillion“ und „Lord of the Rings“ zu so reichhaltigen (und schwer verdaulichen) Texten machen. Es wird hier zwar schon auf zukünftige Ereignisse angespielt (die Handlung spielt rund 60 Jahre vor „The Lord of the Rings“) – so begegnet man hier bereits Elrond, Gandalf und auch Sauron wird verschlüsselt erwähnt -, doch im Großen und Ganzen ist der Text viel geradliniger und einfacher als das, was man sonst von Tolkien gewohnt ist. Damit eignet sich „The Hobbit“ auch hervorragend als Einstiegsdroge für jene, die sich Mittelerde langsam und bedächtig nähern wollen.
Die englische Taschenbuchausgabe ist, obwohl preiswert, mit Liebe gestaltet worden. Das elegant schwarze Cover schmücken der Titel in Silber und ein Porträt Smaugs in auffälligem Rot aus der Feder Tolkiens. Und wie es sich gehört, beinhaltet der Roman auch einige Illustrationen, um das Buch für junge Leser ansprechender zu gestalten. Für all jene, die sich in der Geographie Mittelerdes nicht gut auskennen, schmückt die letzte Seite des Romans eine Karte der Route, die Bilbo und die Zwerge genommen haben, sodass man Mirkwood und die Umgebung von Lake Town dort gut nachvollziehen kann.
Zu Recht ist „The Hobbit“ ein Klassiker der modernen Kinderliteratur. Tolkien hat hier mit den Hobbits originäre Kreaturen erschaffen, die Kinder jeden Alters ansprechen dürften. Man erlebt die Geschichte durch Bilbos Augen und mit ihm kann sich der Leser identifizieren. Er ist kein überlebensgroßer Held, sondern ein Persönchen von einem Meter zwanzig, das sein Leben auch gern in der sorglosen Abgeschiedenheit des Auenlandes weitergelebt hätte. Eigentlich vollkommen unneugierig und genügsam, kann er sich doch einer gewissen Begeisterung für die Reise nicht erwehren und dieser Gegensatz des Charakters ist wohl der sympathischste Zug, den Tolkien seinem Bilbo verleihen konnte. Denn ohne es zu wollen, macht das Abenteuer Bilbo zu einem Abenteurer, ohne dass er dadurch ein Held würde. So bleibt er, gerade für Kinder, immer verständlich und begreifbar. Doch auch erwachsene Leser werden sich Bilbos Charme kaum enziehen können!
Hinweis: Unsere Rezension zur deutschen Hörbuchfassung findet ihr [hier. 130
Henry glaubt nicht an Elfen. Er ist schließlich schon vierzehn! Früher, vor unendlich langer Zeit, als er noch ein Kind war – damals glaubte er die Geschichten über kleine, geflügelte Wesen, die guten Menschen drei Wünsche gewährten. Heute glaubt er nicht mehr an sie. Doch was, wenn ihm ein Elf begegnet?
Der Autor
Herbie Brennan hat zahlreiche Bücher für Kinder und Erwachsene geschrieben, die in mehr als fünfzig Ländern und in einer Gesamtauflage von über 7,5 Millionen Exemplaren erschienen sind. Nebenbei entwickelt er Spiele und Software und arbeitet fürs Radio. Er lebt in County Carlow in Irland.
Der Inhalt
Der Purpurkaiser herrscht gerecht über das Volk der Elfen. Die Lichtelfen sind zufriedene Untertanen, doch die Nachtelfen scheinen Übles zu planen. Das allein bereitet dem Kaiser schon genug Kopfschmerzen, doch zu allem Überfluss ist sein Sohn Pyrgus, der Kronprinz, verschwunden.
Pyrgus ist ein Tiernarr. Er kann es nicht ausstehen, wenn Tiere gequält werden. So entwendete er den Phönix aus dem Haus Lord Hairstreaks, wobei er unglücklicherweise ertappt wurde. Auf seiner Flucht gelangt er in die Leimfabrik Chalkhill & Brimstone, wo er das nächste erschütternde Erlebnis hat: Die Zauber-Klebe-Formel besteht in einem lebenden Kätzchen, das täglich dem Leim geopfert werden muss! Hier ist also wieder eine Rettungsaktion gefragt – doch diesmal wird Pyrgus prompt von den Wächtern der Fabrik festgenommen, fast zu Tode geprügelt und dem Geschäftsführer – Brimstone – vorgeführt, der gerade einen teuflischen Pakt mit Beleth, dem Fürsten der Dämonen, abgeschlossen hat. Zufälligerweise ist es Pyrgus, den der Dämon als Opfer verlangt, und so kommt Brimstone die Gefangennahme sehr gelegen.
Kurz vor dem Opfergang kommt es zu einem Zwischenfall, der Pyrgus aus dem Dämonenkreis befreit. Bevor Brimstone eingreifen kann, erscheint die Palastwache des Purpurkaisers und eskortiert Pyrgus zum Palast.
Politische Verwicklungen zwischen Licht- und Nachtelfen verlangen höchste Sicherheit für den Kronprinzen, und so soll Pyrgus durch das Elfenportal, das sich im Besitz der Kaiserfamilie befindet, in die Gegenwelt transportiert werden, um dort das Ende der Streitigkeiten zu erwarten. Eine einsame Insel in der Karibik ist das Ziel, doch als man nach gelungenem Transfer überprüfen möchte, ob es dem Prinzen gut geht, ist er nicht auffindbar. Offensichtlich wurde er durch Sabotage an einen anderen Ort befördert …
In der Gegenwelt: Henrys Eltern liegen im Streit. Die Mutter hat eine Affäre mit der Sekretärin ihres Mannes (!), und der soll darum aus dem Familienleben treten. Ob all dieser Ungerechtigkeiten bleibt dem vierzehnjährigen Jungen nur die zeitweilige Flucht. Er geht zu Mr. Fogarty, um dem alten Mann beim Aufräumen seines Hauses oder Gartens zu helfen. Kaum steht er vor dem bruchfälligen Schuppen, als Fogartys Kater einen Schmetterling einfängt. Henry, der sehr tierlieb ist, verbietet dem Kater seine Beute und fördert – keinen Schmetterling zu Tage, sondern ein geflügeltes kleines Menschlein, offenbar ein Elf! Henry glaubt nicht an Elfen, aber er weiß, dass Mr. Fogarty an sie wie auch an Außerirdische und dergleichen glaubt. Also bringt er seinen Fund in die Küche, und mit Hilfe des alten Mannes bringen sie ein Verstärkergerät zustande, das die Stimme des kleinen Wesens hörbar macht.
Henrys Weltanschauung ist über den Haufen geworfen. Es ist tatsächlich ein Elf, und zwar Pyrgus, der Sohn vom Purpurkaiser des Elfenreichs! Ärgerlich für Pyrgus ist, dass der Filter des Portals versagt haben muss und er nun in der lächerlichen Gestalt eines kleinen fliegenden Würmchens in der Gegenwelt ist. Auf jeden Fall ist allen klar, dass Pyrgus so schnell wie möglich in seine Welt zurückkehren muss. Dort steht mittlerweile eine große Konfrontation zwischen Nacht- und Lichtelfen bevor, und auch die Dämonen scheinen einen Plan zu haben …
Kritik
„Das Elfenportal“ mutet erstmal wie ein Jugendroman an – Vierzehnjährige, die in Abenteuer verstrickt werden und das Schicksal der Welt in den Händen halten. Doch Brennan verstrickt in dieser Geschichte Abenteuer gekonnt mit Fantasy, Ironie und Humor, zeigt auf diese Art nicht nur Ausschnitte aus dem – unheimlich vertrauten – Elfenreich, sondern auch Aspekte unserer Gesellschaft, des Familienlebens und des Klischees, dass scheinbar immer die Ehemänner Affären mit ihren Sekretärinnen haben, wenn eine Ehe zu Bruch geht.
Interessant ist auch die Verknüpfung der Elfengeschichte – klein, geflügelt, drei Wünsche – mit dem Außerirdischen-Mythos – dürre, graue, großköpfige Wesen mit riesigen Augen, die Unmengen Amerikaner entführen. Nach diesem Buch wissen wir, woher diese Außerirdischen kommen und was es mit unseren kleinen, niedlichen Elfchen auf sich hat. Und wir haben einen spannenden Einblick in das Leben der echten Elfen bekommen, das sich von dem unsrigen gar nicht so sehr zu unterscheiden scheint. Natürlich gibt es im Elfenreich andere Technik – dort als Magie bezeichnet – und andere Mythen, aber die Wesen scheinen zu fühlen wie Menschen, unabhängig davon, dass sie sich Elfen nennen.
Es hat auf jeden Fall nichts mit den Elben aus Tolkiens „Herrn der Ringe“ zu tun und steht also Abseits der Diskussion, ob die weit verbreiteten Fantasy-Elfen mit Tolkiens Elben identisch sind. Hier handelt es sich tatsächlich um diese kleinen, geflügelten Geschöpfe unserer Märchen, die – wie wir nun wissen – eigentlich gar nicht so klein und schon gar nicht geflügelt sind.
Der Konflikt zwischen Lichtelfen und Nachtelfen sowie den Dämonen ist facettenreich geschildert, und ein Lösungsansatz führt genauso in die Irre wie der nächste. Jede Partei ist überzeugt, die anderen zu durchschauen und hintergehen zu können oder ihnen überlegen zu sein, bis es im Finale zu einer überraschenden Wendung kommt, bei der auch der mysteriöse Mr. Fogarty eine Rolle spielt. Die Geheimnisse, die dieser Mann mit sich herumträgt, tragen allerdings nur noch zu Henrys Verwirrung bei. Ist ihm irgendwann aber auch egal, denn er trifft ja auf Holly Blue, die Schwester von Pyrgus.
Wo wir grad bei den Geschwistern sind: Comma, der Dritte im Bunde, steht nach Pyrgus in der Thronfolge. Und hier sieht man wieder einen Aspekt, der – da nicht eindeutig erwähnt – eventuell aus diesem Buch mehr macht als nur ein Jugendbuch. Mit Ironie wird deutlich, dass Comma zwar auch hintergangen wird, aber als einer der wenigen vom Verschwinden Pyrgus‘ profitiert hätte.
Fazit
Ein schnelllesiges Buch, wenn ich diesen Ausdruck mal kreieren darf. Und wirklich kurzweilig. Wie Mr. Colfer auf dem Umschlag bemerkt, ist dieser Plot durchaus der einen oder anderen Erweiterung fähig. Ein schönes Lesevergnügen, bei dem man nicht selten zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken angeregt wird. Empfehlenswert – mal wieder für jedermann!
Ein wenig Kritik am Einband: Es prangt das Symbol „dtv premium“ darauf. Aber bezieht sich das nur auf den Inhalt und nicht auf die Verarbeitung? Die Verklebung der Seiten lässt – zumindest bei meiner Ausgabe – doch sehr zu wünschen übrig.
Tolkiens „Der Herr der Ringe“ ist an sich schon ein Mammutwerk (meine Ausgabe beispielsweise hat nicht weniger als 1300 eng bedruckte Seiten) und auch (literatur)wissenschaftlich hat man sich immer wieder mit dem Roman auseinandergesetzt. Doch seit der Verfilmung durch Peter Jackson ist nochmal ein ganzer Stoß begleitender Bücher auf den Markt geschwemmt worden, die dem alten und neuen Fan Mittelerde, Elben und böse Zauberringe erklären sollen. Was da Wunder, dass sich auch der |List|-Verlag eine Scheibe vom Kuchen abschneiden wollte. Anders lässt es sich kaum erklären, dass der Verlag ein Buch aus dem Jahre 1969 ausgrub, es mit einem Cover versah, das frappant an das Design der Verfilmungen erinnert, und das Ganze kurzerhand 2002 in deutscher Erstfassung auf den Markt warf. Das Vorwort zur deutschen Ausgabe weist das Buch als „authentisches Dokument der allgemeinen Faszination aus, die Tolkiens mythisches Universum bereits vor Jahrzehnten ausübte.“ Damit ist bereits in blumigen Worten umschrieben, um was es sich bei Lin Carters „Tolkiens Universum“ eigentlich handelt – nämlich ein Buch, das höchstens noch literaturhistorisch von Interesse ist, ansonsten aber komplett veraltet daherkommt. Einsichten in die Grundlagen von Tolkiens Mythologie und die Fundamente seines Weltenentwurfs finden sich höchstens im letzten Teil von Carters Ausführungen.
Lin Carter war selbst Autor von Fantasyromanen; ein Mann vom Fach also. Er editierte für |Ballatine Books| die „Adult Fantasy“-Reihe und interessierte sich augenscheinlich für den Werdegang der Fantasy in der Weltliteratur. Dass ihn Tolkiens Werk, das bei vielen alten Mythen Anleihen nimmt, dabei besonders faszinierte, überrascht kaum. In „Tolkiens Universum“ versucht er nun, anderen Lesern diese Welt nahe zu bringen, schließlich war „Der Herr der Ringe“ zu diesem Zeitpunkt erst gute zehn Jahre auf dem Markt und begann erst langsam, seinen Kultstatus zu entwickeln. Carter betrat zu seiner Zeit also relatives Neuland und tastete sich dementsprechend vorsichtig an sein Studienobjekt heran.
Zunächst bringt er einige biographische Fakten zu Tolkien, seine universitäre Laufbahn als Professor, sein Interesse für alte Mythen und Legenden (hier nennt er besonders den „Beowulf“ und die [„Edda“) 62 und seine Beschäftigung mit der Form des Märchens.
Von da kommt er auf die Entstehungsgeschichte vom „Herrn der Ringe“ und eine erste kleine Rezeptionsgeschichte, die illustriert, dass ein so unhandliches Buch unmöglich einen einfachen Start haben kann. Dieser Teil von „Tolkiens Universum“ ist mäßig interessant, besonders unterhaltsam muten Carters Spekulationen über den Inhalt des [„Silmarillion“ 408 an, das zu dem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht war.
Um seine Studie über den „Herrn der Ringe“ ordentlich vorzubereiten, bietet Carter dann eine Zusammenfassung sowohl des [„Hobbit“ 22 als auch des „Herrn der Ringe“. Auf nicht weniger als 60 Seiten erläuert er, worum es in den Büchern geht und man fragt sich zwangläufig, an welchen Leser diese Zeilen wohl gerichtet sein mögen. Carters Buch werden sicherlich nur zwei Arten Leser in die Hand nehmen: Diejenigen, die den „Herrn der Ringe“ kennen und tiefer in die Materie einsteigen wollen und diejenigen, die noch vorhaben, das Buch zu lesen. Beide Gruppen werden keine 60-seitige Inhaltsangabe benötigen. Für die einen ist sie überflüssig und für die anderen der ultimative Spoiler. Was Carter also mit diesem Teil seines Buches erreichen wollte, bleibt ungeklärt.
Im Anschluss daran nimmt er den Leser mit auf eine Tour durch die Weltliteratur und erklärt ihm, dass die Form des Epos eine Art Urformel der heutigen Fantasy ist und führt als Beweis unzählige bekannte und unbekannte Epen mitsamt Inhaltsangaben auf. Dies mag lesenswert sein, wenn man sich ohnehin für diese Form interessiert und mehr über „Edda“, „Nibelungenlied“, „Beowulf“ etc. erfahren will. Doch auch für diesen Leser ist Carters Buch nicht unbedingt zu empfehlen. Für einen Überblick bringt er einfach zu viel Material auf zu kleinem Raum und büßt dafür die Tiefe seiner Analyse ein. Seine Betrachtungen bleiben oberflächlich und polulärwissenschaftlich, höchstens ein kleiner Appetitmacher auf Texte wie die „Ilias“. Den Hunger muss man jedoch mit anderen Publikationen stillen. Auch bleibt er den Zusammenhang zwischen den genannten Epen und Tolkiens Schaffen schuldig. Vergleiche werden niemals gezogen und somit stehen Carters Betrachtungen zum Epos frei im Raum ohne direkt für die Tolkien-Analyse herangezogen zu werden.
Im letzten Teil kommt Carter dann endlich zur Sache und gräbt einige Primärtexte aus, die Tolkien beeinflusst und inspiriert haben. Der Mehrwert dieser Entdeckungen ist unterschiedlich. So ist es nicht gerade eine Erleuchtung, herauszufinden, dass „theoden“ (bei Tolkien der König Rohans) das angelsächsische Wort für „Fürst einen Stammes“ ist oder dass „myrkwid“ (engl. „Mirkwood“, dt. „Düsterwald“ – Legolas‘ Heimat) 17-mal in der „Alten Edda“ erwähnt wird. Schon erstaunlicher sind die inhaltlichen Zusammenhänge, wenn er beispielsweise den Sternenfahrer Earendil bis zur „Prosa-Edda“ zurückverfolgt und feststellt, dass die Figur (die ebenfalls Earendil bzw. Orvandel heißt) auch dort mit einem Stern in Verbindung gebracht wird. (Bei Tolkien wird Earendil mit seinem Schiff an den Himmel gesetzt und der Silmaril an seiner Stirn leuchtet den Bewohnern Mittelerdes als Stern der Hoffnung – entspricht dem Morgen- und Abendstern.)
Große Erleuchtungen bleiben bei der Lektüre also aus, was sicherlich dem frühen Entstehungsdatum von „Tolkiens Universum“ geschuldet ist. Wer sich für die Rezeptionsgeschichte Tolkiens interessiert, wird hier sicherlich fündig und kann an Carters Ausführungen ablesen, wie „Der Herr der Ringe“ damals aufgenommen wurde. Wer jedoch wirklich etwas über die Hintergründe des Romans erfahren will, der wird in diesem Buch hauptsächlich im Kreis herumgeführt. Eine Publikation neueren Datums ist da empfehlenswerter und materialreicher.
Die von dem in die USA emigrierten Schweizer Gary Gygax erfundene |Dungeons & Dragons|-Reihe („Verliese und Drachen“) – kurz D&D oder AD&D („advanced“) – darf sich rühmen, das populärste Fantasy-Rollenspiel der Welt und Urvater von Systemen wie dem in Deutschland bekannten DSA („Das Schwarze Auge“) oder Midgard zu sein.
Ein Welterfolg, der wie nicht anders zu erwarten auch auf jede erdenkliche Weise vermarktet wird. Vom ursprünglichen „Pen & Paper“-Rollenspiel wurden neben Zinnfiguren (Ral Partha), Kartenspielen und sonstigen Fanartikeln und Spielideen auch etliche Computerspiele („Pool of Radiance“, „Eye of the Beholder“, „Baldur’s Gate“) mehr oder minder inspiriert.
Auch auf dem Buchmarkt ist die Reihe erfolgreich, die der „Forgotten Realms“ oder deutsch „Die Vergessenen Reiche“ dürfte neben „Dragonlance“ die wohl bekannteste AD&D-Fantasywelt sein.
_Sympathieträger mit Burnout-Syndrom_
Maßgeblichen Anteil an der Popularität dieser Welt und eines ihrer schillerndsten Charaktere, dem Dunkelelfen Drizzt Do’Urden, hatte ihr Autor und Schöpfer, der 1959 geborene Amerikaner R. A. Salvatore. Salvatore hatte mit dem ersten Band der Vergessenen Reiche „The Crystal Shard“ / „Der gesprungene Kristall“ so großen Erfolg, dass er der wohl schillerndsten Figur, dem ganz entgegen der sonst bösartigen Natur seines Volkes „guten“ Drow Drizzt, eine eigene Trilogie, die |Saga vom Dunkelelf|, gewidmet hat.
Der krummsäbelschwingende Dunkelelf und seine Freunde, der Zwerg Bruenor, der Barbar Wulfgar, der Halbling Regis und Catti-brie (eine Menschenfrau – der so genannte Quotenmensch) kämpften sich fortan durch unzählige Abenteuer, bis hin zu dem Punkt, an dem Salvatore ein wenig die Ideen ausgingen. Die kurzweilige Action und Faszination einer gewaltigen, langsam auf gigantische Ausmaße gewachsenen Fantasywelt reichte nicht mehr – was nun?
Nach dem Ende des bösen Pendants von Drizzt, Artemis Entreri, und einigen faszinierenden Ausflügen in das legendäre Unterreich der Dunkelelfen, hatte Salvatore einige fatale Ideen: Ein bisschen viel Seifenoper, Wulfgar wurde zum Alkoholiker, von Dämonen gefoltert, er verliebte sich in Catti-brie, behandelte sie schlecht, musste über satte vier Bände von seinen Freunden vor sich und der Welt gerettet werden. Nachdem am Ende Drizzt selbst seine Zuneigung zu Catti-brie entdeckte und Wulfgar mit einer neuen Freundin und Familie versorgt und ein Intermezzo auf den Meeren Faerûns beendet worden war, konnte ich nicht anders als den Niedergang der einstmals so geliebten |Swords & Sorcery|-Reihe zu bedauern. Das war es wohl nicht, was die Fans lesen wollten. An die alten Klassiker kamen diese Romane bei weitem nicht mehr heran.
_Ein Neuanfang?_
Während Salvatore über einer Fortsetzung brütete, erschien mit dem „Krieg der Spinnenkönigin“ eine Reihe von Romanen von Jungautoren, die sich so in den Vergessenen Reichen ihre ersten Sporen verdienen durften, wie Richard Lee Byers mit dem ersten Band [„Zersetzung“ 183 in der Dunkelelfen-Metropole Menzoberranzan.
Der Altmeister selbst legt eine neue Trilogie vor, die bezeichnenderweise „Die Rückkehr des Dunkelelf“ (US: „The Hunter’s Blades“) heißt und mit den dank der Verfilmung des |Herrn der Ringe| derzeit sehr populären Orks aufwarten kann… sogar gleich mit tausenden davon:
_“Die Invasion der Orks“ / „The Thousand Orcs“_
Drizzt zieht mit seinen Freunden und Bruenor Heldenhammers Zwergensippe heim, nach Mithrilhalle. Alle sind froh über Wulfgar, der sein seelisches Gleichgewicht wiedergefunden hat. König Bruenor plant, auf dem Heimweg die Konkurrenz von Mithrilhalle, die Stadt Mirabar, aufzusuchen und den dort zusammen mit Menschen lebenden Zwergensippen einen Besuch abzustatten, Kontakte zu knüpfen und ein wenig Spionage zu betreiben – denn der Markgraf Elastul ist wegen der wirtschaftlichen Einbußen, die Mirabars Bergwerke und Schmieden wegen der überlegenen Qualität der Waffen und Erze aus Mithrilhalle erleiden, ausgesprochen feindselig gestimmt.
Der Besuch verläuft friedlich, jedoch verursacht er einen Bruch zwischen den seit Jahrhunderten mit den Menschen Mirabars zusammenlebenden Zwergen und dem Markgrafen, der ihnen auf unkluge Weise vorwirft, mehr auf ihre Verwandten aus Mithrilhalle zu achten denn auf die Interessen Mirabars.
Während Drizzt und Bruenor weiterziehen, wird dessen Wunsch, die geheimnisvolle Zwergenfeste Gauntlgrym zu suchen und so der Langweile des Herrschens in Mithrilhalle zu entgehen, auf ihm nicht unliebe Weise von Orks vereitelt:
Eine Schar Orks und Frostriesen hat einen Trupp Zwerge überfallen, und das Menschendorf, in dem die Überlebenden gepflegt wurden, niedergebrannt. Bruenor persönlich zieht mit einer kleinen Truppe Zwerge und seinen kampferprobten Gefährten den Orks entgegen, während er die anderen Zwerge nach Mithrilhalle schickt.
Doch alle haben die Gefahr unterschätzt: Der Ork Obould und die Frostriesin Gerti haben dank der Hilfe abtrünniger Dunkelelfen eine unheilige Allianz gebildet, die ein gewaltiges Heer in Richtung Mirabar entsendet hat. Die Orks überrennen das Dorf, in dem Bruenor sich verschanzt; der alleine hinter den feindlichen Reihen kämpfende Drizzt kommt zu spät und findet nur noch Leichen unter von den Frostriesen geschleuderten Steinen und eingestürzten Gebäuden, hält seine Freunde fälschlicherweise für tot. Während Bruenor verschüttet und abgeschnitten von seinen Zwergen ist und Drizzt ihren Tod betrauert, schickt Markgraf Elastul seine fähige Beraterin Shoudra Sternenglanz zwecks Sabotage nach Mithrilhalle …
_Ein Schritt in die richtige Richtung …_
Besondere Überraschungen und Finessen bietet die Handlung nicht gerade, andererseits zeichnet sich „Die Invasion der Orks“ durch viele der alten Stärken Salvatores aus, die vorhergehenden Bänden leider völlig abgingen.
So hat Salvatore angenehm vielfältige Handlungsebenen miteinander verknüpft, von dem Ork Obould und seinem dümmlichen Sohn Urlgen und ihrem Bündnis mit den Frostriesen bis hin zu den vier Dunkelelfen, die aus verschiedenen Gründen das Unterreich verlassen und Asyl an der Oberfläche suchen mussten, wo es vor allem den in ihrer Heimat von den Drow-Frauen unterdrückten Männern ausgesprochen gut gefällt. Dabei kommt der Humor nicht zu kurz, schon der Prolog, der Überfall auf die kleine Zwergenschar, liest sich sehr angenehm, wie auch spätere Dialoge der Orks recht kurzweilig sind.
|“‚Warum kämpfen wir überhaupt gegen die verdammten Zwerge?‘ wagte ein anderer aus der Gruppe zu fragen. Obould drehte sich um und versetze ihm einen Hieb, der ihn zu Boden warf. So viel zu diesem Diskussionspunkt.“|
Angenehm auch die differenzierte Darstellung des Zusammenlebens der Zwerge und Menschen in Mirabar, bei der mir besonders die gelungene und glaubhafte Darstellung der schönen und klugen Sceptrana Shoudra Sternenglanz, der menschlichen Beraterin Elastuls, gefallen hat. Die Handlung ist kurzweilig, humorvoll und in gewissem Sinne sogar originell, die Dialoge des Markgrafen mit seinem überschätzten Alchemisten, dem Gnom Nanfoodle, sind gut durchdacht und eine gelungene Umsetzung des Klischees des chaotischen Gnomen-Alchemisten, der bei seinen Versuchen, die Qualität des Erzes zu verbessern, vermeintlich große Erfolge erzielt, die sich bei genauerer Betrachtung aber als ganz gewöhnliche Legierungen mit höherwertigen Metallen erweisen …
Salvatore packt aus, was die Vergessenen Reiche an Kulturen, Abenteuern und Rassen zu bieten haben, was mir sehr gut gefallen hat, leider hat sich meine Begeisterung im letzten Drittel merklich gelegt.
Neben zwei Mondelfen und ihren Pegasi konnte er es sich nicht verkneifen, Dick und Doof, pardon, Pikel und Ivan, die lustigen Kameraden des Zwergenklerikers Cadderly, ebenfalls in das Kampfgebiet zu schicken. An beiden scheiden sich die Geister, jedoch hätte ich es begrüßt, wenn stattdessen den bereits vorgestellten neuen Figuren mehr Raum eingeräumt worden wäre, als dieser das Buch unnötig in die Länge ziehende Episode mit den Elfen und den beiden Zwergen. Diesen Platz hätte man auf den Charakter des Markgrafen verwenden können, der nur selten glänzt und oft inkonsistent als dümmlich die Zwerge vergrätzender Tyrann dargestellt wird, was nicht zu der nachvollziehbareren Darstellung seiner klugen Berater wie Agrathan und Shoudra passt, denen Salvatore wohl einen Maulkorb verpassen musste, um ihren Herren unberaten ins Verderben rennen zu lassen.
Unpassend zu dem derben, einfachen Humor ist auch der leidige Versuch, Drizzt und seinen Gefährten tiefere Gefühle verleihen zu wollen. Bei diesem kampflustigen Haufen wirken tiefenpsychologische Erklärungsversuche einfach nur lächerlich, zum Beispiel rettet Wulfgar seine ehemalige Liebe Catti-brie, die nun die Gefährtin von Drizzt ist, wofür Drizzt ihm dankt, was ihn aber beleidigt, weil es unter Gefährten ja selbstverständlich ist und es so wirkt, als wäre das, was er getan hat, mehr, als er von ihm erwarten könne. Inklusive der Befürchtung, Wulfgar könne wieder ein Auge auf Catti-brie werfen … Mit diesen Liebesgeschichten und Wulfgars Alkoholproblemen hat Salvatore einige seiner schlechtesten Romane verbrochen, warum wärmt er diesen alten Käse also noch einmal auf, er stinkt zum Himmel.
_Unterm Strich …_
Nach dem überzeugenden, humorvollen und gelungenen Auftakt enttäuscht das Ende leider sehr, ein Rückfall in bekannte Unarten. So leuchtet es nicht ein, wie fünf Frostriesen Drizzt weit vom Kampfgebiet wegjagen können, hat er doch schon ganz andere Monster mit dem Dönermesser zu Konfetti verarbeitet. Leichtgläubig scheint der Elf auf seine alten Tage auch zu werden – stammt nicht von ihm auch der Spruch, er glaube nicht an den Tod einer Person, solange er nicht ihre Leiche mit eigenen Augen gesehen habe, und selbst dann gäbe es unter Umständen noch Zweifel? Bruenors Helm und ein Haufen Steine überzeugen ihn jedenfalls, dass alle mausetot und erschlagen sind.
Schade, einige hundert Seiten weniger, ein überzeugenderes Ende und der Roman hätte fast wieder an alte Ruhmeszeiten anschließen können. So ist er zwar empfehlenswert, aber auch nur für Fans der Vergessenen Reiche, als Einstieg ist er schon wieder viel zu komplex, trotz der verlockenden „Orks“ im Titel. Auf ganzer Linie überzeugen können jedoch Lektorat und Übersetzung, Regina Winter hat sich bis auf einen kleinen Lapsus (Aegis-fang statt Aegisfang für Wulfgars Hammer) keinerlei Fehler geleistet und den Roman sehr flüssig und gut zu lesen übersetzt, was besonders bei den lebendigen Diskussionen der Orks und des Alchemisten mit Elastul angenehm auffällt.
Trotz der Wermutstropfen ist „Die Invasion der Orks“ ein kurzweiliger, unterhaltsamer Fantasyroman für Rollenspieler. Zwar, wie nicht anders zu erwarten, kein anspruchsvolles Meisterwerk, aber ein Schritt in die richtige Richtung und ein Beweis dafür, das Salvatore nicht umsonst der Altmeister der Vergessenen Reiche ist.
Mit seinem Debüt-Werk „Nebelriss“ liefert Markolf Hoffmann den ersten Teil der phantastischen Trilogie |Zeitalter der Wandlung| ab.
Eine ganze Welt steht vor dem Untergang – oder vielleicht doch nur vor dem Aufbruch in ein neues Zeitalter?
|Gharax| heißt diese Welt, sie umfasst vier Königreiche (Arphat, Candacar, Gyr und Kathyga), ein selbsternanntes Kaiserreich (Sithar) und die Ländereien eines zunehmend unberechenbaren Gildenrates (Troublinien).
Nach Jahren des Friedens sehen sich die Völker Gharax mit einer Gefahr konfrontiert, die nur in den fast vergessenen Legenden der magischen Logen und religiösen Orden Erwähnung findet. |Goldéi| heißen die zweibeinigen echsenartigen Eindringlinge, die ein Königreich nach dem anderen im Handstreich erobern. Die Zauberer und Priester schweigen und glauben in ihrer unermesslichen Arroganz, sie könnten dem Feind entgegentreten und ihn in die Schatten der Legenden zurückdrängen. Nachdem Candacar und Gyr von der Übermacht der Angreifer vernichtend geschlagen sind und der Herrscher von Kathyga vor den goldgeschuppten humanoiden Reptilien sein Haupt gebeugt hat, um seinem Volk ein brutales Massaker zu ersparen, marschieren die Goldéi in Richtung der Grenzen der letzten beiden freien Reiche.
Sithar, dessen naiver und ungesitteter Kaiser Akendor seine Macht an |das Gespann|, zwei machthungrige und intrigante Fürsten des Thronrates, abgegeben hat, war einstmals ein Teil des Königreiches Arphat, bevor es sich im Südkrieg vor 348 Jahren von dessen Herrschaft lossagen konnte. Trotz des tief verwurzelten gegenseitigen Hasses dieser beiden Reiche, wagt es Fürst Baniter Geneder, der ewige Gegenspieler |des Gespanns|, eine Gesandtschaft nach Arphat zu führen, um ein Bündnis mit der grausamen Königin Inthara zu schließen …
In der Kirche Tathrils steht ein Machtwechsel kurz bevor und so erreichen auch hier die Intrigen eine kritische Phase, in der es sich entscheiden wird, welchen Kurs die Priesterschaft in der kommenden Zeit einschlägt. Nhordukael, ein junger Priester und der ergebene Diener des Kirchenoberhaupts, trägt inmitten dieses aufkeimenden Tumults einen Glaubenskrieg in seinem Inneren aus …
An einem anderen Ort wird ein junger Eleve, ein Schüler der Magie, aus der Hand der Goldéi befreit. Laghanos weiß um ihre Pläne, die magischen Quellen, die vor über einem Jahrtausend von dem mächtigen Zauberer Durta Slargin gebändigt und unterworfen wurden, zu befreien. Erreichen die Reptilien ihr Ziel, könnten große Teile der Welt im Chaos der Natur vergehen …
Markolf Hoffmann wurde 1975 in Braunschweig geboren und lebt derzeit als Student der Geschichte und Literaturwissenschaft in Berlin. Schon während seiner Schullaufbahn nahm er an einigen Schreibwettbewerben teil und erhielt sogar den ersten Preis im Literaturwettbewerb des FDA Baden-Württemberg. 1996 absolvierte er sein Abitur und erhielt den Scheffelpreis für hervorragende Leistungen im Fach Deutsch. Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit und dem Studium engagiert er sich zudem in Kurzfilmprojekten und war 1998 mit dem Film „Schnittfehler“ (Buch und Regie) im Auswahlprogramm des Internationalen Jugendfilmfestivals |up-and-coming| vertreten. 1999 ging er als Stipendiat des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes für ein Jahr nach London. Der Themenschwerpunkt seines Studienaufenthalts war die |Britische Literatur der 90er Jahre|.
Seine ersten Veröffentlichungen erschienen im Jahr 2003 – die Kurzgeschichte „Ein meisterliches Mahl“ in der Anthologie |Tolkiens Geschöpfe| (Heyne) und die Erzählung „In Poseidons Armen“ in der Anthologie |Matrixfeuer| (|Phönix|-Verlag).
Nebelriss – so nennen die Bewohner eine Schlucht am nördlichen Rande des Hochlands, der Grenze zwischen Sithar und Arphat. Alten Legenden zufolge werden in ihr die Wolken geboren, um dann über die Welt zu ziehen und sie mit Regen zu belohnen oder mit Stürmen zu strafen.
Über diese Schlucht führt die alte Brücke von Pryatt Par, die auch Fürst Baniter Geneder beschreiten muss, um seine Gesandtschaft in das verfeindete Königreich Arphat zu führen.
Markolf Hoffmann nimmt den geneigten Leser mit auf eine atemberaubende Reise, in deren Verlauf er mit seiner leidenschaftlich düsteren Erzählweise eine Welt zum Leben erweckt. Viele liebevoll arrangierte Details, die manchmal wie die Requisiten in einer gemütlichen Taverne anmuten, machen den Reiz dieser bis ins Kleinste ausgearbeiteten Welt aus. „Nebelriss“ birgt ein unvergleichliches Erlebnis für alle Freunde phantastischer Literatur. Seine mitreißende Art und die stilistisch eindrucksvolle Sprache bringen ein literarisches Werk zum Vorschein, welches international seinesgleichen sucht.
Dem Autor ist etwas gelungen, was gerade in der phantastischen Literatur leider eine Rarität ist; er hat eine komplexe und vielseitige Geschichte erschaffen, wie sie sonst nur das Leben selbst zu erzählen vermag. Die Protagonisten, wie auch wichtige Nebenfiguren, zeigen auf ihrem Weg neben ihren Stärken ebenso ihre Schattenseiten und der eine oder andere wächst unerwartet über sich selbst hinaus – es gibt keinen schillernden Helden in einer goldenen Rüstung und genauso wenig finden sich schwarze Drachen auf einem Hort aus purem Gold oder menschenfressende Trolle. Hier geht es nicht um den immerwährenden Kampf zwischen Gut und Böse, vielmehr geht es um eine dem Untergang geweihte Welt, in der die einzelnen Personen ihrer Bestimmung nachgehen, um ihren Platz in der neuen Ordnung zu finden. Bei seinen Figuren hat Markolf Hoffmann großen Wert darauf gelegt, dass sie natürlich erscheinen und eine Konsistenz im Denken und Handeln aufweisen. Aus der Sicht des jeweiligen Charakters erscheint sein Streben gut und richtig, auch wenn es für einen anderen bedeuten mag, dass ihm daraus Unannehmlichkeiten erwachsen oder er gar mit dem Rücken an die Wand gedrückt wird. Selbst die unheilbringenden Goldéi, welche danach trachten, eine längst vergangene Ordnung wieder herzustellen, scheinen ein gerechtes Ziel zu verfolgen – natürlich nur aus ihrer Sicht. Auf Grund dieser menschlichen Züge, der Stärken und Schwächen und der teils eigennützigen Zielen fällt es schwer, einen eindeutigen Sympathieträger auszumachen.
Gestattet mir ein paar Worte zum Buch selbst. Das Cover-Artwork ist wahrlich eine gelungene Arbeit von Christopher Vacher, doch auch wenn es die teils bedrückende Atmosphäre der Geschichte malerisch widerzuspiegeln vermag, so habe ich doch meine Schwierigkeiten, es in einen Kontext zum Roman zu bringen – mag sein, dass es einen Teil des Rochenlandes darstellt oder die |Augen von Talanur| im Yanur-Se-Gebirge in Arphat. Auf jeden Fall macht das Buch allein schon wegen des Einbandes auf sich aufmerksam.
Sollte der geneigte Leser und Liebhaber phantastischer Literatur nun allerdings auf die Idee verfallen, das Buch umzudrehen, um sich mittels des Klappentextes einen Einblick in die Geschichte zu verschaffen, so erfährt er eine herbe Enttäuschung, denn die Art und Weise, wie hier versucht wird, dem potenziellen Leser das Buch schmackhaft zu machen, zielt wohl eher auf die falsche Zielgruppe ab. Ganz oben der unnötige und völlig irreführende Vergleich mit J. R. R. Tolkiens „Herr der Ringe“, direkt gefolgt von ein paar allgemein gehaltenen Phrasen, die eher zu einer |Sword & Sorcery|-Reihe passen. Warum nur, lieber |Heyne|-Verlag, erachtest du das, und dann in dieser Form, als unbedingt erwähnenswert? Ich möchte noch auf ein weiteres Manko hinweisen; ich finde es ziemlich schade und auch ein wenig irritierend, dass von außen nichts darauf hindeutet, dass es sich um den ersten Teil einer Trilogie handelt. Auf der Vorderseite finden nur der Verlag, der Autor und der Titel des Romans – nebst einem Verweis darauf, dass es sich eben um einen Roman handelt – Erwähnung und auch auf dem Buchrücken steht nichts von einer Trilogie. In diesem Zuge sei erwähnt, dass wegen des Verkaufs der Fantasy-Reihe von |Heyne| an den |Piper|-Verlag der zweite Teil dieser Trilogie, „Flammenbucht“, – und hoffentlich auch der abschließende dritte Teil – bei Piper erscheint, und zwar zeitgleich mit der Neuveröffentlichung dieses ersten Bandes im November 2004.
Nun aber wieder zu den erfreulichen Seiten dieses Buches, nämlich den ersten. Dort findet der Leser ein Aufstellung der |dramatis personae|, eine Karte der Welt Gharax und die dazugehörige Legende. Da der Roman ohne ein großartiges Präludium direkt ins Geschehen einsteigt, mag die Erläuterung, wer wohin gehört und welches Amt er dort bekleidet, dem einen oder anderen Leser hilfreich sein; ich persönlich liebe derart komplexe Stories und habe sie, während ich mich von der Welt und den Personen habe entführen lassen, nicht benötigt. Bei der Rezension war sie mir allerdings eine große Hilfe, da ich so ohne größeres Suchen die Schreibweise von Orten und Personen nachschlagen konnte. Meines Erachtens ist diese Idee eine angenehme Bereicherung für das Buch. Die Karte entstammt der Feder von Markolfs Schwester, Hjördis Hoffmann, und erlaubt dem Leser trotz ihrer geringen Größe, den Wegen Baniter Geneders und denen der Goldéi geographisch zu folgen.
Und damit kommen wir auch schon zu einem weiteren, wie ich finde, sehr gelungenen und ungewöhnlichen Leckerbissen, den Markolf Hoffmann seinen Lesern bietet: die [Nebelriss-Homepage,]http://www.nebelriss.de die er eigenhändig pflegt. Neben einem reichhaltigen Angebot an Hintergrundinformationen bietet der Nachwuchsautor seiner Leserschaft eine kostenlose Probe seines Könnens. In der Rubrik „Online-Konzept“ hat er eine kurze Vorgeschichte, „Der Preis des Verrats“, in Form eines Briefwechsels verfasst, mit dem der geneigte Leser einen kleinen Einblick in die Welt Gharax und die Bedrohung durch die Goldéi erlangen kann. Der kathygische König Eshandrom hat seinen Ratgeber Pushindra in das Nachbarreich Candacar entsandt, damit dieser den Gerüchten über eine gesichtete Invasionsflotte goldgeschuppter Echsen auf den Grund gehe. In zehn kurzen Kapiteln, die bereits in den Wochen vor der Veröffentlichung von „Nebelriss“ auf der Homepage präsentiert wurden, wird dieser Briefverkehr wiedergegeben.
Ein ähnliches Konzept ist auch im Vorfeld der Veröffentlichung von „Flammenbucht“ geplant.
Abschließend bleibt mir nur noch, euch einige wunderschöne Leseabende mit „Nebelriss“ bei Kerzenschein und einem guten Glas Wein zu wünschen.
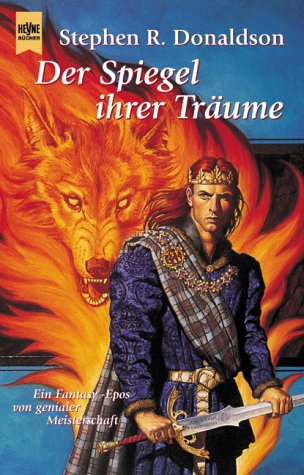
Dort auf Schloss Orison angekommen, traut Terisa ihren Augen nicht: Sie ist im Mittelalter gelandet, Magie gibt es auch – allerdings nur eine einzige Form, die sogenannte Imagomantie. Die Imagomanten Mordants vermögen durch ihre Spiegel fremde Wesen zu erblicken und sie in ihre Welt zu rufen, oder selbst durch den Spiegel an den Ort zu reisen, den sie in ihm sehen.
Stephen R. Donaldson – Der Spiegel ihrer Träume (Mordants Not) weiterlesen

Was hier auf den ersten Blick ausgesprochen absurd wirkt, ist in einer gut vierhundert Jahre in der Zukunft liegenden Wirklichkeit weit weniger anormal, als man zunächst glauben möchte. In der Welt von Richard Morgans Debütroman „Das Unsterblichkeitsprogramm“ (Originaltitel: „Altered Carbon“, 2002) hat die Menschheit eine nahezu vollständige Kontrolle über Informationen und benutzt dieses Wissen unter anderem dazu, sämtliche Hirn-Inhalte zu extrahieren, zu speichern und bei Bedarf zurückzukopieren – in den meisten Fällen allerdings in einen anderen Menschenkörper. Diese sterblichen Hüllen sind daher auch zu |Sleeves| degradiert, sie werden getragen und gewechselt wie Anzüge, können gemietet, verkauft und eingelagert werden und haben zumeist höchstens nostalgischen und emotionalen Wert für den jeweiligen Träger.
Wiebke Eymess stellt euch „Otherland“ im Rahmen ihres Essays „Fantasy als Flucht und Fluch – Der ultimative Logout“ ausführlich vor.
Im neunzehnten Jahr seiner unverwüstlichen Existenz präsentiert sich |Heynes| „Science Fiction Jahr“ [Der Lektor zuckt geringfügig zusammen.] nicht nur äußerlich im neuen, schmucken Gewand, sondern inhaltlich geordnet. Elf Großkapitel beinhalten die trotzdem meist bekannten Kategorien. Der Auftakt ist freilich spezifisch: Das „SF Jahr 2004“ hat nun einen Themenschwerpunkt und liefert auf mehr als 250 seiner 1047 Seiten einen Abriss der Geschichte eines heiß geliebten und viel geschmähten Genres: der Space Opera.
„Die neue Space Opera“: Nie flogen sie erfolgreicher, die Riesenraumschiffe der Zukunft; sie durchmessen Raum und Zeit und durchqueren galaktische Imperien, deren menschliche oder außerirdische Bewohner von recht gegenwärtigen, aber ins Gigantische übersteigerten Alltagsproblemen umgetrieben werden. Wieso dies einst so gern gelesen ward, eine gewisse Zeit als literarisch (und auch sonst) verwerflich galt und heute wieder ganz im Trend liegt, erläutern uns Fachleute aus dem In- und Ausland mittels einschlägiger Exempel.
So informiert David G. Hartwell über den erstaunlichen Paradigmenwandel, den die Space Opera zwischen ihren primitiven Anfängen und ihrem Aufstieg zur SF-Literatur der Gegenwart erfuhr. John Klute, berühmter SF-Kritiker und inzwischen selbst Autor, verwirrt mit einem wenig aussagekräftigen Artikel, in den sich kräftige Eigenwerbung für sein Werk mischt. Thomas M. Disch präsentiert eine wunderbare Zeitreise in die „Prähistorie“ der Science-Fiction und beleuchtet das Werk der Pioniere Jules Verne und H. G. Wells aus bisher unbekannten Winkeln, wobei sich einige Überraschungen und Neubewertungen ergeben, die u. a. den Franzosen vom Ruch des chronisch kritiklosen Fortschrittsanbeters befreien. Eric Simon arbeitet ein weiteres Kapitel der lange hinter dem Eisernen Vorhang verborgenen „Ost-SF“ auf und präsentiert mit Sergej Snegow den prominentesten (und wohl auch einzigen) Space-Opera-Verfasser der seligen UdSSR.
Natürlich findet daneben die aktuelle Space-Opera-Szene ausführlich Berücksichtigung. Sie wird am Beispiel ihrer derzeit prominentesten Vertreter (Peter F. Hamilton, Dan Simmons, Vernon Vinge, Ken MacLeod, Iain Banks und David Weber) aufgerollt. Dazu gesellt sich (verdient) der wieder in die |Heyne|-Familie aufgenommene (und folglich verstärkt zu vermarktende) deutsche Repräsentant: unser Perry Rhodan, dessen Abenteuer die Themen der modernen Space Opera präziser aufgreifen als das die Kritik einem „Groschenheft- Helden“ zugestehen mochte.
Abgeschlossen wird der „Space Opera“-Komplex durch einen umfangreichen Artikel von Uwe Neuhold, der die Technik der Weltraumspektakel auf ihren Realitätsbezug abklopft. Das schwankt zwischen berechtigter Skepsis (Beamen, Subraum, Zeitmaschine) und der sympathisch naiven Hoffnung auf eine freundliche, an Forschung, Geld oder Wundern reichere Zukunft.
„Bücher und Autoren“: Hier weitet sich die thematische Bandbreite über die „Space Opera“ hinaus und arbeitet einige Kapitel der SF-Historie auf. Michael K. Iwoleit beginnt unter dem Titel „Mythen der nahen Zukunft“ mit einer Betrachtung der „Muster und Quellen im Werk J. G. Ballards“, der seit jeher von der Kritik mehr geschätzt wird als von den Lesern, die von diesem Verfasser intellektuell deutlich stärker gefordert (und belohnt) werden als von (allzu) vielen anderen Vertretern des Genres. Dass auch heute SF- Schriftsteller gibt, deren Werk anspruchsvoll ist, ohne damit das Publikum abzuschrecken, belegt Ralf Reiter in seinem Text „Auf den Schultern von Riesen“ über die Romane von China Miéville, einem neuen Star am SF-Himmel.
Kurios mutet Linus Hausers Erinnerung an eine merkwürdige Episode der Science-Fiction an. „Schweden im Weltall“ befasst sich mit den Zukunftsfantasien des „Jungdeutschen Ordens auf dem Planeten Värnimöki“. Wir erfahren quasi nebenbei, dass sich „völkische“ Tendenzen auch in der doch scheinbar dem Zukünftig-Irrealen verhafteten SF-Szene der frühen Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts feststellen lassen. Gleitend ist der Übergang zu nationalsozialistisch-faschistischem Gedankengut: Es gab (und gibt) eben keine Nischen, die SF eignet sich als Instrument politischer und sozialer Propaganda so gut wie jede andere Sparte der Literatur.
An zwei Pioniere des Phantastischen erinnern Karlheinz Steinmüller und Erik Simon. „Der erste letzte Mensch“ ist ein Werk der ganz frühen Science-Fiction, das anders als Mary Shelleys „Frankenstein“ unverdient in Vergessenheit geriet. Steinmüller geht der Lebensgeschichte seines Verfassers Cousin de Grainville (1746-1805) nach und rekonstruiert den Weg eines Klassikers, der jetzt wieder in deutscher Übersetzung greifbar ist (wo er – da sollte man Realist bleiben – weiterhin ein Nischendasein fristen wird).
Erik Simon lässt Leben und Werk des russischen SF-Autors Igor Moshejkos Revue passieren, der unter dem Pseudonym Kir Bulytschow schrieb. Für den westlichen Leser, der diesseits des „Eisernen Vorhangs“ aufwuchs, sind die spezifischen Schwierigkeiten, mit denen Schriftsteller in einem Regierungssystem zu kämpfen hatten, das auch als „Kulturdiktatur“ bezeichnet werden könnte, schwer oder gar nicht verständlich. Insofern ist Simons Beitrag auch wertvoll als Information, die über die SF hinausgeht.
Gundula Sell schließt dieses Großkapitel des „SF Jahrs“ mit dem Aufsatz „Bücher statt Plüschtiere! Die neue Fantasy im Zeichen der Globalisierung“. Es geht um Harry Potter, Artemis Fowl und weitere Neustars des Genres, das durch pubertäts- und sonstwie realitätsgeplagte Junghelden irgendwie an Wert gewonnen hat, auch wenn der Autorin nicht recht gelingen will, uns zu sagen wie, so dass sie sich im Finale in den Gemeinplatz von der „guten“ Literatur flüchtet, die uns einerseits zum (Nach-)Denken bringt und uns andererseits an „künftige Bruchstellen“ des Alltags bringt. Aha … (Gundula Sell, Ex-Bürgerin der DDR, ist es übrigens auch, die gleich auf zwei Seiten über ihre Befindlichkeit als Konsumgeisel des überheblich-ungastlichen Westens Auskunft gibt, bevor sie mit dem eigentlichen Beitrag anhebt – das „Jahrbuch“ bietet schon immer Raum auch für persönlichen Reminiszenzen.)
Die beiden Interviews des „SF Jahrs 2004“ bleiben dieses Mal deutschen SF-Schaffenden vorbehalten. Andreas Eschbach berichtet anlässlich seines neuen Bestsellers „Der Letzte seiner Art“ von seinem oft turbulenten Alltag als Schriftsteller und seinen Erfahrungen mit Verlagen, Film und Fernsehen. Robert Feldhoff gewährt Einblick in das Räderwerk der größten SF-Serie der Welt: „Perry Rhodan“ hat im 21. Jahrhundert teilweise unauffällige, teilweise gravierende Veränderungen und Überarbeitungen hinter sich, über deren Gründe hier Näheres zu erfahren ist.
Nach der „Fiction“ geht das „Jahrbuch“ nun zur „Science“ über: 1993 erregte Vernor Vinge mit seiner Theorie der „technologischen Singularität“ gewaltiges Aufsehen. Ihre „Geburt“ erfolgt seiner Ansicht nach zu dem Zeitpunkt, an dem die „KI“ (die „Künstliche Intelligenz“) – ein alter, aber allmählich greifbar werdender Traum – das Stadium erreicht, da sie der menschlichen gleichkommt und sie schließlich übertrifft, was auf einen Schlag die bisher bekannten Regeln der menschlichen Entwicklung außer Kraft setzen würde. Vinge zieht nach zehn Jahren Bilanz und kommt zu dem Schluss, dass er eigentlich Recht hatte: Besagten Quantensprung erwartet er weiterhin circa 2030, und er ist guten Mutes, dass die KI der Menschheit einen gewaltigen technologischen und geistigen Fortschritt bescheren wird.
Es fällt auf, dass Vinge sehr „US-amerikanisch“ argumentiert, d. h. in seiner Singularität recht naiv vor allem einen Segen sieht. Sein Landsmann Alex Steffen unternimmt es, den |advocatus diaboli| (oder Spielverderber) zu mimen bzw. gewisse Aspekte anzusprechen, die Vinge einfach ausblendet, weil sie seine Vision beeinträchtigen würden. Unter dem Titel „Was passiert, wenn die Technik den Rahmen sprengt?“ stellt Steffen vor allem die ketzerische, aber überaus kluge Frage, wer denn diese schöne neue Welt bezahlen wird oder kann. Falls die Schere zwischen künstlich erschlauter Elite und armem Pöbel gar zu deutlich klafft, könnte dies die Quelle für einen Klassenkrieg der futuristischen Art werden.
Wolfgang Neuhaus zeichnet in „Eine kurze Zukunftsgeschichte der Technologie“ Leben und Werk des Freeman Dyson nach, dem das seltene Kunststück gelang, als Wissenschaftler „Kultstatus“ à la Einstein oder Hawkins zu erlangen. Neuhaus stellt einen breitfächrig gebildeten, unkonventionellen Denker vor, der sich zurückhaltend Gedanken über die Zukunft der Menschheit in und außerhalb ihrer Welt macht, sich dabei durchaus irrt und bereit ist dies zuzugeben.
Michael K. Iwoleit macht uns mit einer bilderstürmerischen Gruppe von Computerwissenschaftlern bekannt, die das Wesen der Welt entdeckt zu haben glauben: „Das Matrix-Enigma“ ist der etwas boshafte Titel dieses Beitrags. Er spielt auf die gleichnamige Schwurbel-SF-Filmtrilogie an, welche die Welt, in der wir leben, als rechnergenerierte Illusion“entlarvt“. Dem ist tatsächlich so, meinen besagte Forscher: Auch wenn keine durchgeknallten Computerviren die Menschenpuppen tanzen lassen, ist das Universum ihrer Meinung nach ein kosmischer Rechner, dessen Bausteine sich letztlich auf ein Grundelement reduzieren lassen: die Information. Im Verbund bilden diese Informationen die Bestandteile des Universums. Zu denen gehören auch wir Menschen, so dass es sein könnte, dass „Gott“ ein Überwesen ist, in dessen Notebook ein Programm namens „Universum-Simulation“ läuft …
Den längsten Beitrag des „Jahrbuchs“ liefert Rüdiger Vaas mit „Die ferne Zukunft des Lebens im All“. Ein bisschen knapper hätte es auch getan (zumal der Verfasser vor allem eigene Beiträge aus früheren Jahren „recycelt“), aber es braucht zugegebenermaßen Raum, wenn der Autor mit Jahrmillionen, dann Milliarden und schließlich mit Zahlen jongliert, an deren Ziffernschwanz sich ein Elefant Gassi führen ließe. Was geschieht mit der Erde, dem Sonnensystem, dem Universum – und mit uns Menschen? Gehen wir irgendwann mit unserem Heimatplaneten unter? Nehmen wir ihn ins Schlepptau und suchen uns einen neuen Ankerplatz, wenn unsere Sonne dereinst platzt? Oder bauen wir uns einen neuen Stern? Der wissenschaftlichen Fantasie scheint da keine Grenze gesetzt zu sein. Vaas listet übersichtlich die seltsamsten Theorien auf, die vor allem eines beweisen: Der Mensch ist erstaunlicher Denkleistungen fähig, wenn man ihn denn lässt und nicht endgültig durch globalisierte Manager-Dummköpfe und Kosten-Nutzen-Sparschweine ersetzt.
Ebenfalls Rüdiger Vaas schließt das „Science“-Kapitel mit einer kundigen Vorstellung gelungener Wissenschaftsbücher des Jahres 2003 ab. Nun wird es unterhaltsam und multimedial:
„Film“: Aufgelistet und kommentiert werden Kinofilme und TV-Premieren des Jahres 2003, hinzu kommen (Fernseh-)Wiederaufführungen klassischer Lichtspiele – dies sogar doppelt, denn es dürfen sich gleich zwei Spezialisten (bzw. ein Einzelkritiker und ein Kritikerduo) äußern. Sie kommen zu dem leider gut begründbaren Schluss, dass 2003 (nicht nur) dem Freund des phantastischen Films zum Jubel wenig Anlass gab. Lahme Fortsetzungen und missglückte Comic-Adaptionen beherrschten vor allem das auf Instant-Blockbuster fixierte Hollywood, dem entsprechende Flopp-Quittungen an den Kinokassen ausgestellt wurden.
Warum dieses Elend im Jahrbuch gleich zweifach kommentiert wird, bleibt schleierhaft, zumal sich die Kritiker in ihren Urteilen recht einig sind. Doch man ist rasch froh über die Texte von Lutz Gräfe und Jürgen Wimmer, da ihr Kollege Peter M. Gaschler sich offenbar im freien Assoziieren übt und seine Leser mit einer Flut stakkatohafter Satzfragmente zu ertränken droht, in der ponkiehaft nachgedrechselte Wortspielchen treiben. W a s er zu sagen hat, ist ihm offensichtlich weniger wichtig als das W i e – dies mit dem Ergebnis, dass sich wohl primär der Autor selbst an seinem Geistreichtum berauscht haben dürfte.
Das Kapitel „Hörspiel“ listet und wertet die aufs Ohr zielenden phantastischen Beiträge eines SF-Jahres und ist damit dieses Mal rasch fertig, da sich die Zahl der einschlägigen Spiele sowie ihre Qualität in einem beklagenswert überschaubaren Rahmen hält.
„Comic“: Die „Siebte Kunst“ ist bekanntlich aus dem Medium SF nicht wegzudenken. Helmut Kaspar blickt unter dem Titel „Der Weltraumhumorserienwettlauf – ost-west-deutsche Sektion“ auf ein Kapitel Comic-Geschichte zurück, das man in diesem Umfeld nicht erwartet hätte. Aber es gab ihn: Humor in Deutschland-West und Deutschland-Ost, und das sogar im ansonsten auch mit dem Zeichenstift geführten „Kalten Krieg“, der auch im Weltraum erbittert geführt wurde.
„Computer“: Gespielt wurde auch 2003, was die Daumen hergaben. Eine ganze Reihe neuer Games für PC und Konsole/n kamen auf den Markt, die hier jeweils kurz vorgestellt und auf ihren Spielspaß sowie ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Kritik kommt dabei nicht zu kurz, auch wenn sich die Auswahl vernünftigerweise auf die besser gelungenen Spiele beschränkt. (Diese lassen sich übrigens in die Kategorien „Ballern“, „Taktieren“ und „Taktieren mit Ballern“ einteilen.) Hinzu kommt dank des Fortschritts immer stärker die kreative Nutzung der Technik, die auch dem Privatmann die Herstellung eigener „Spielfilme“ ermöglicht, welche inhaltlich und formal nicht selten Erstaunliches zu bieten haben.
„Rezensionen“: Aus dem SF-Repertoire deutscher Verlage werden einige für repräsentativ gehaltene Titel ausgewählt und vorgestellt, was den Verfassern Gelegenheit zu ausführlichen Exkursen gibt, die über das jeweilige Buch hinaus sekundärliterarische Einblicke in die aktuelle Science-Fiction-Szene bieten. Besondere Berücksichtigung findet dabei die SF von jenseits des „Eisernen Vorhangs“, deren Geschichte für den westlichen Interessenten noch manchen weißen Flecken ausweist.
Fachkundige Rezensionen liest der SF-Fan gern, entgeht ihm doch in der zunehmend zersplitterten deutschen Verlagswelt leicht der eine oder andere interessante Titel. Das (bekannte) Problem ist dabei: Wie objektiv ist der Rezensent? Er (oder sie) ist es im Grunde nie, was ja auch einen großen Reiz ausmacht. Schlimm wird es, wenn der Kritiker sich an den eigenen Worten berauscht oder gar einen Feldzug für oder gegen ein Einzelwerk, einen Autoren oder ein Genre vom Zaun bricht. So weit kommt es im „SF Jahr“ nicht. Dennoch wirft die Auswahl der besprochenen Titel Ratlosigkeit auf – noch immer scheint didaktisch begründbare Unleserlichkeit als Qualitätsmerkmal zu gelten. Die „großen“ |Heyne|-Titel sind natürlich dabei – so viel Eigenwerbung muss sein, zumal sie begründet ist: Zwar nur mehr selten, aber immer noch bringt |Heyne| richtig gute SF, d. h. keine Simpel-Module breit getretener Endlos-Zyklen heraus.
„Marktberichte“: Die SF-Szene wird jeweils in den Regionen Deutschland, USA und Großbritannien in Zahl, Tabelle (unbedingt Lupe bereit legen!) und Wort vorgestellt. Knapp aber umfassend werden anhand der Aktivitäten der Verlage (Bücher, Hefte, Magazine) die relevanten Marktentwicklungen in 2003 nachgezeichnet, die wichtigsten Autoren und ihre Werke genannt. Weiterhin gibt es einen Ausblick auf kommende Attraktionen (von denen die meisten unübersetzt bleiben werden). Eine Würdigung der im vergangenen SF-Jahr verstorbenen Genre-Schriftsteller schließt jedes der drei Unterkapitel ab.
Den Schlusspunkt des „SF Jahrs 2004“ bildet wie immer die „Bibliografie“ der Anno 2003 im |Heyne|-Verlag erschienenen, der Phantastik zuzurechnenden Titel, geordnet in ihrem ersten Teil nach Reihen und Nummern, im zweiten nach Autoren.
Damit ist es vollbracht; das SF-Feld ist abgeräumt und kann für das kommende Jahr neu bestellt werden. Das „Jahrbuch“ wird uns hoffentlich auch 2005 wieder beschert; man hat sich an dieses segensreiche, weil umfassende, kompetent informierende Monumentalwerk gewöhnt.
Wobei sich dieser Segen freilich leicht in einen Fluch verwandeln kann. In dem Bestreben, noch den letzten Genrebrocken zu erhaschen, verwandelt sich das „SF Jahr“ mehr und mehr in eine kommentierte Mega-Statistik. Muss denn wirklich jedes halbwegs der Phantastik zuschlagbare Werk vorgestellt werden? Wen interessiert das außer den fanatischen Komplettisten? Wären denn nicht aussagekräftige Beispiele nützlicher, denen – soll’s denn unbedingt vollständig sein – eine kurze Aufstellung der übrigen Titel folgt? Sind nicht Analysen des Gesamtbildes dem Leser wertvoller? Jetzt muss er es sich aus vielen Einzelstücken selbst zusammensetzen. Na gut, wir Deutsche gelten ja als Detailfanatiker, so dass sich diese Fragen womöglich als ketzerisch von selbst erledigen …
Wohlgemerkt: Diese Kritik zielt nicht auf die Themenwahl. Die ist ohnehin ein Angebot der Herausgeber, über das der Leser sich freuen oder unzufrieden sein kann. Allen kann man es bekanntlich niemals Recht machen. Es ist auch gar nicht nötig; jede/r wird Artikel von Interesse finden. Die übrigen lassen sich überspringen.
Isaac Asimov (1920-1992) hat in seiner langen SF-Karriere ab 1939 neben vielen Romanen – die immer noch bekanntesten und beliebtesten entstammen dem 1951 gestarteten |Foundation|-Zyklus – naturgemäß auch zahllose kürzere Erzählungen veröffentlicht, viele davon gerade in seiner frühen Phase für das Pulp-Magazin |Amazing Stories| seines Entdeckers und Förderers John W. Campbell. Die Behauptung, bei der hier vorliegenden Sammlung handle es sich um das Beste, was der SF-Pionier im Story-Bereich geschaffen hat, darf aber gleich aus mehreren Gründen nicht ganz so ernst genommen werden. Zum einen stammt „The Best of Isaac Asimov“ im Original bereits aus dem Jahr 1973 und wurde 1983 bei Bastei-Lübbe auch schon mit der Bandnummer 24113 veröffentlicht. Und auch wenn der Autor seine Glanzzeit und besonders auf dem Kurzgeschichtensektor produktivste Phase in den vierziger und fünfziger Jahren hatte, werden damit die fast 20 letzten Jahre seines Schreibens schlicht unterschlagen. Was hier ebenfalls fehlt, sind seine Robotergeschichten. Die wurden zwar an anderer Stelle oft genug veröffentlicht, doch dies trifft für einen Großteil der hier versammelten Storys ebenfalls zu, zählt also nicht als Entschuldigung. Gerade die Robotergeschichten sind nun einmal ein wesentlicher Bestandteil des Asimov’schen Schaffens. Dies wird dieser Tage gerade durch eine auf diesem Werk basierende Verfilmung namens „I, Robot“ gezeigt. Die Zusammenstellung besorgte Asimov übrigens auch nicht selbst, sondern ein namentlich ungenannter Herausgeber, so dass man über die getroffene Auswahl durchaus geteilter Meinung sein kann. Asimov gibt das im Vorwort in ungewohnt bescheidener Manier zu und schreibt, eigentlich solle das Buch besser den Titel „Die recht guten und recht typischen Geschichten Isaac Asimovs“ tragen – so viel dazu.
Höhepunkt der zwölf Storys ist „Und Finsternis wird kommen…“ (Nightfall) aus dem Jahr 1941, eine Geschichte, welcher der Autor ob ihres enormen Erfolgs recht hilflos gegenübersteht und von der er selbst erklärt, sie sei nicht seine persönliche Favoritin. Der SF-Leser an sich widerspricht dieser Meinung gern und häufig, immer wieder wird „Und Finsternis wird kommen…“ unter den beliebtesten Kurzgeschichten aller Zeiten genannt. Der Reiz dieser faszinierenden Story liegt vor allem in ihrem beeindruckenden Szenario: Der ungewöhnliche Plot – die Welt Lagash wird nur in großen Abständen mit völliger Dunkelheit konfrontiert, da ansonsten immer eine der Sonnen am Himmel steht, was in unschöner Regelmäßigkeit die Zivilisation in völligem Wahnsinn zerbrechen lässt und sie auslöscht – hat sicherlich den Löwenanteil am hohen Beliebtheitsgrad. Stilistisch ist Asimov in dieser frühen Phase sicher nicht völlig ausgereift, sondern noch sehr den |Pulps| verhaftet. Das heißt keineswegs schwach, eher einfach, fast naiv gehalten, aber auch in der relativ nüchternen Manier durchaus ansprechend. Die Charaktere dürften zweifelsfrei noch schärfer gezeichnet sein. Erst Robert Silverbergs Romanfassung, deutsch als „Einbruch der Nacht“ bei |Heyne| erschienen, hilft dem Manko der etwas wissenschaftlich-sterilen Protagonisten dann ab. Die Original-Geschichte zählt aber allein wegen der ungewöhnlichen Idee, von der sie lebt, verdientermaßen zu den Klassikern der SF der vierziger Jahre.
Die erste verkaufte Story des Autors, „Havarie vor Vesta“ (Marooned off Vesta, 1939), kann besonders durch die Plausibiltät gefallen, mit der sich die havarierten Raumfahrer an Bord der Silver Queen aus ihrer scheinbar aussichtslosen Lage retten. Ein früher Verweis auf Asimovs spätere Ausflüge ins Krimigenre? Sprachlich ist das Debüt ebenfalls sehr einfach gehalten, auch hier lebt die Geschichte mehr von der Idee. Genau zwanzig Jahre später wurde dann „Jahresfeier“ (Anniversary) geschrieben, das die Charaktere der Geretteten noch einmal aufgreift und schließlich gemeinsam mit „Havarie vor Vesta“ in |Amazing Stories| abgedruckt wurde, eben um den Geburtstag der ersten Story Asimovs gebührend zu feiern. Mehr Krimi als SF, ist diese Geschichte die wohl schwächste der hier vertretenen, da die Lösung des Falls den Leser hilflos zurücklässt und ihm kaum eine Chance bietet, wenigstens mitzuraten, wer denn nun der Täter war.
Der gereiftere Asimov begegnet dem Leser in der erstmals 1972 veröffentlichten Story „Spiegelbild“ (The Mirror Image), die auch ein Wiedersehen mit dem Detektiv Elijah Baley und dem Roboter R. Daneel Olivaw aus den frühen Romanen „Die Stahlhöhlen“ (The Caves of Steel) und „Die nackte Sonne“ (The Naked Sun) parat hält, die später in der |Foundation|-Fortschreibung auch wieder auftauchen. Zwei Wissenschaftler beschuldigen sich darin gegenseitig des geistigen Diebstahls. Baley droht an dem Fall zu verzweifeln, kann ihn dann aber dank seiner eigenen Logik – die den Roboter verblüfft – doch aufklären. Ein weiterer Kriminalfall wird in „Das Nullfeld“ (The Billard Ball) gelöst. Hier steht allerdings nicht die Frage nach dem Täter im Raum, sondern die Überlegung, ob Zufall oder Absicht die Tat lenkten und wie sie überhaupt möglich war. Eine reizvolle Story.
„Geschichte eines Helden“ (C-Chute), ursprünglich in |Galaxy| veröffentlicht, hat dann mehr von einer typischen SF-Story der frühen fünfziger Jahre. Während eines Kriegs zwischen Menschen und den Kloros, einer Insektenrasse, wird die Besatzung eines irdischen Raumschiffs gefangen genommen. Ausgerechnet der unscheinbare Buchhalter Randolph Mullen avanciert unter den Gefangenen zum Helden und findet einen Weg zur Flucht. Flott zu lesen, recht farbige Charaktere und damit eine der besseren Storys des Buchs. „Das Chronoskop“ (The Dead Past) kann ebenfalls durch die starken Charaktere, die in vielen Nuancen geschildert und so lebendig werden, überzeugen. Die weiteren Storys: „Die Verschwender vom Mars“ (The Martian Way), „Die in der Tiefe“ (The Deep), „Der Spaß, den sie hatten“ (The Fun They Had), „Wenn die Sterne verlöschen“ (The Last Question) sowie „Die schwindende Nacht“ (The Dying Night).
Alles in allem eine gute Zusammenstellung typischer Asimov-Geschichten, nicht das Beste, aber doch mehr Gutes als Schlechtes.
_Armin Rößler_ © 2001
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Unterstützung und Genehmigung unseres Partnermagazins [Buchrezicenter.de]http://www.buchrezicenter.de/ veröffentlicht.|
Seit den Romanen von Jean M. Auel um ihre Urzeit-Heldin „Ayla“ sind Bücher über die Frühgeschichte der Menschheit nicht mehr aus den Regalen wegzudenken. Ob für Erwachsene oder Kinder – es scheint die Autoren zu faszinieren, 40.000 oder gar 200.000 Jahre in die Vergangenheit zu gehen und sich das Leben damaliger Menschen (oder Menschenvorfahren) vorzustellen. So geht es auch dem Engländer Peter Dickinson. Seine Geschichten um die „Kinder des Mondfalken“ erschienen in Deutschland bereits als Buch für Kinder und Jugendliche bei |Carlsen|. Für die Taschenbuchausgabe hat man die beiden ersten Bände in einen zusammengefasst.
Der Stamm der Mondfalken ist überfallen und in eine viel unwirtlichere Gegend vertrieben worden. Die Überlebenden wollen beim Marsch durch die Wüste die Kleinsten und Schwächsten zurücklassen, aber der Junge Suth, der auf der Schwelle zum Erwachsensein steht, und das Mädchen Noli, das immer wieder Visionen hat, lassen das nicht zu. Sie trennen sich vom Stamm und retten die Kinder. Auf sich allein gestellt, versuchen sie zu überleben, was nicht immer leicht ist.
Dann aber finden sie Aufnahme bei einem anderen Stamm. Suth begreift nach und nach, dass sie seine Gruppe dabehalten wollen, um das Blut des Stammes, in dem immer mehr missgebildete Kinder geboren werden, aufzufrischen. Er versucht das zu verhindern, doch selbst Noli scheint von der Magie der Anführerin des Stammes gefangen. Dann zwingt ein Vulkanausbruch die Kinder des Mondfalken zu einer Entscheidung. Sie kommen nur knapp mit ihrem Leben davon und finden in einem anderen Tal Zuflucht, wo Humanoide leben, die sie bisher nicht als Menschen betrachtet haben. Jetzt müssen sie lernen, ihre Vorurteile zu vergessen, damit auch sie hier eine Heimat finden können …
In einer bewusst einfachen Sprache schildert Peter Dickinson die Erlebnisse der Frühmenschenkinder erst aus der Sicht von Suth, dann von Noli. Jedes Kapitel wird von einer sogenannten „Ursage“ begleitet, die das Selbstverständnis und die Vorstellungswelt der jungen Helden und die Gründe für ihr Handeln plausibler macht. Er bringt dem Leser auf höchst lebendige Weise den Alltag, die Sorgen, Nöte aber auch Freuden der Kinder näher, ohne dabei belehrend oder wissenschaftlich zu werden, wenn auch der versteckte Appell an Toleranz und Offenheit nicht fehlen darf. Aber genau diese Dinge werden wohl auch in der Urzeit ein friedliches Miteinander zwischen sich fremden Stämmen und Volksgruppen ermöglicht haben, wenn genug Nahrung da war. Die Kinder sind lebendig geschildert, machen Fehler oder reagieren instinktiv richtig. Sie akzeptieren Dinge, die sind, und lassen auch das Neue zu.
Phantastische Elemente tauchen im Roman eher selten auf, meistens wenn Noli von dem Geist ihres Stammestotems berührt wird und seine Botschaften empfängt, woraufhin der Stamm in eine neue Richtung gelenkt wird.
Die Abenteuer sind klein und meistens alltäglich, wenn man einmal von dem Kampf gegen einen bedrohlichen Löwen absieht. Aber darauf kommt es auch nicht an, da Spannung anders erzeugt wird. Dennoch sollten all jene, die mit als Kinderbücher konzipierten Urzeit-Romanen, nicht viel anfangen können, ihre Finger von dem Roman lassen.
Wer eher ruhige Geschichten mit Mythen und einfachen Abenteuern mag, in dem die Figuren im Vordergrund stehen, wird an den „Kindern des Mondfalken“ seine Freude haben.
_Christel Scheja_ © 2004
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Unterstützung und Genehmigung unseres Partnermagazins [Buchrezicenter.de]http://www.buchrezicenter.de/ veröffentlicht.|