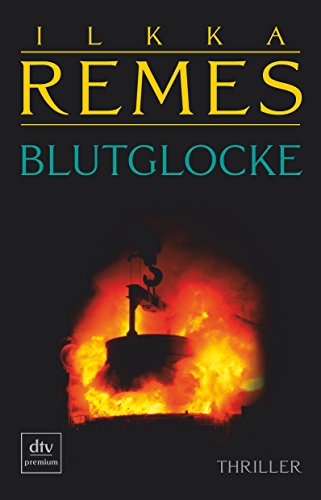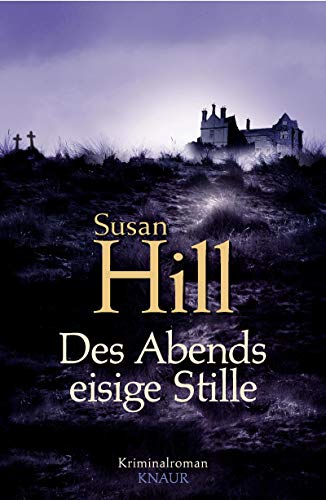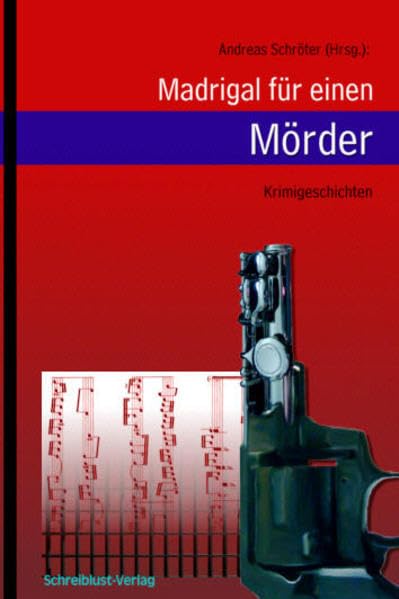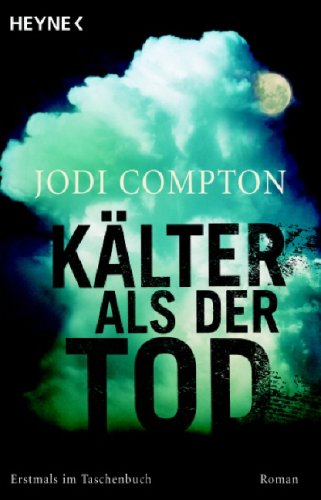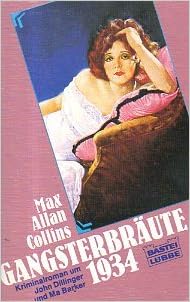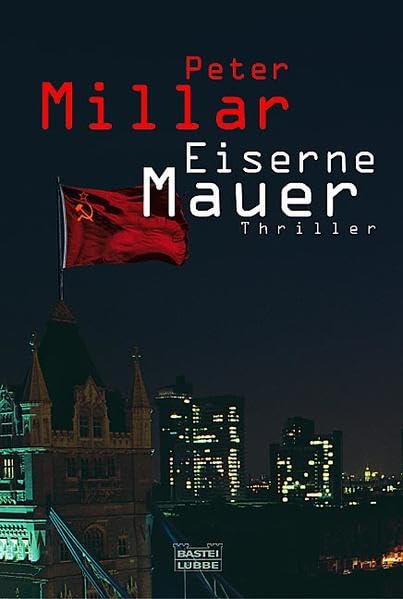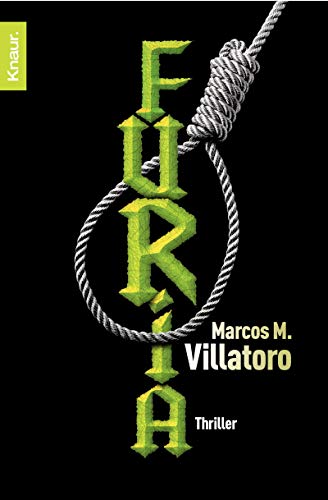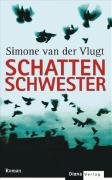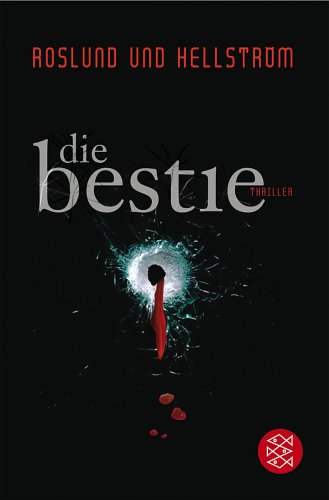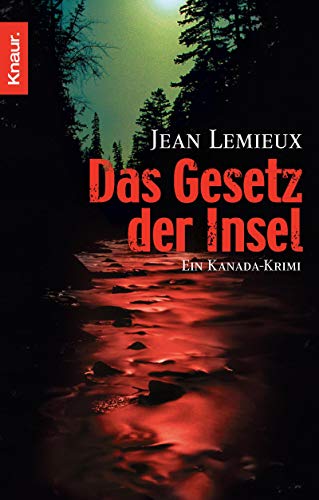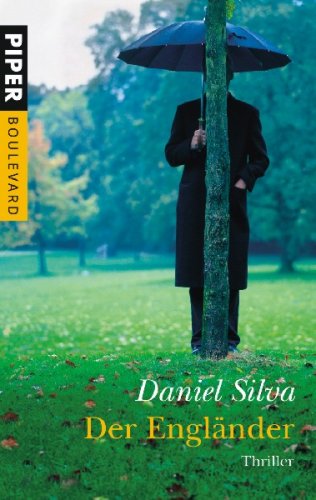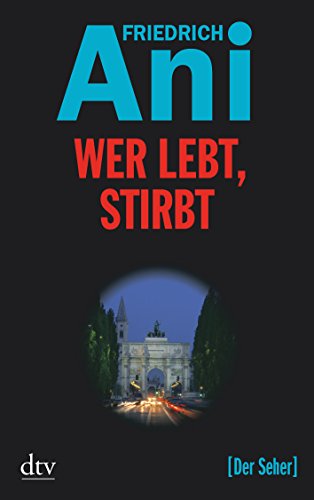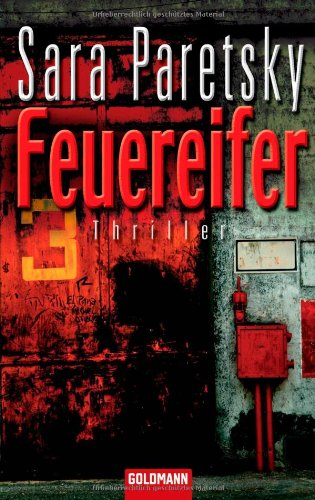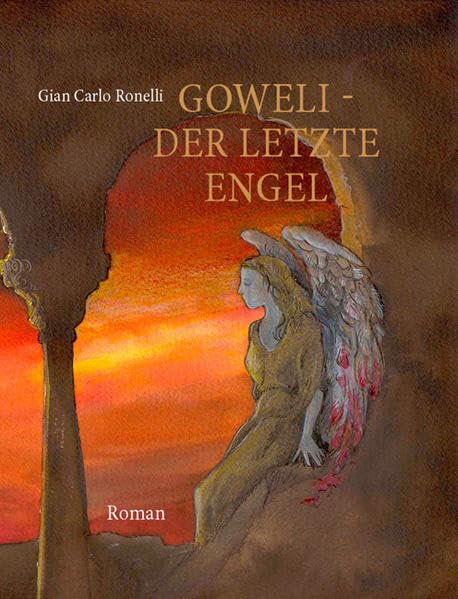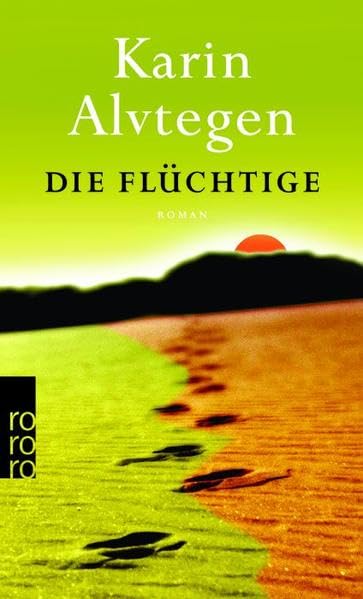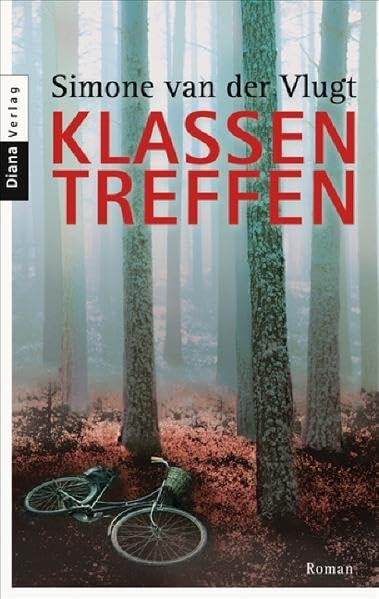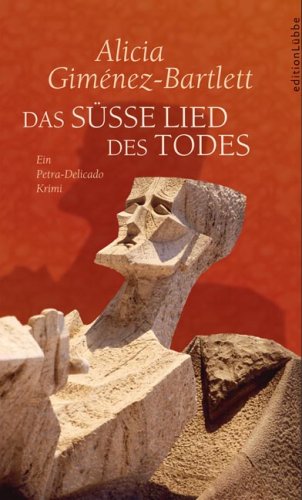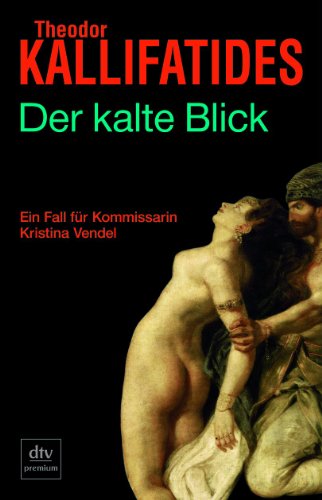Der finnische Bestsellerautor Ilkka Remes hat sich mit seinen rasanten Thrillern einen Namen als Meister der Spannung gemacht, sodass auch sein aktuelles Werk „Blutglocke“ von seinen Fans heiß erwartet wurde. Schauen wir uns an, ob sich das sehnsüchtige Warten denn auch gelohnt hat.
_Kling, Glöckchen, kling_
Zu Beginn des Buches werden wir Zeuge, wie der sechzehnjährige Sohn des deutschen Innenministers Klein beim Baden entführt wird. Schnell schaltet Remes zur finnischen Kommissarin Johanna Vahtera, der beim Zahnarzt gerade eine kleinere Tortur bevorsteht, vor der sie ein wichtiger Anruf allerdings vorerst rettet. Vahtera wird als Profilerin nämlich hinzugerufen, als die Entführung Sebastian Kleins bekannt wird. Doch die Entführer locken den Innenminister ohne polizeiliche Unterstützung zum vereinbarten Übergabeort. Dort lassen sie den Sohn fast unverletzt zurück, doch der Vater hat es nicht so gut getroffen: Klein ist nicht nur ermordet, sondern ausgeblutet worden. Was um Himmels Willen will der Mörder mit Kleins Blut, fragt sich nicht nur Vahtera, doch dauert es noch lange, bis sie des Rätsels Lösung finden wird.
Der Leser hat es hier besser, denn er lernt den Strippenzieher hinter der Entführung schnell kennen. Dabei handelt es sich um Rem Granow, der jüngst seine Mutter verloren hat und dessen Vater – ein berühmt-berüchtigter russischer Mafiaboss – nun ebenfalls im Sterben liegt. Er möchte eine Blutglocke anfertigen, also eine Glocke, in die Kleins Blut eingearbeitet ist, um sie zur Beerdigung seiner Mutter besonders hell erklingen zu lassen. Doch das ist nicht Granows einziger Plan, denn seine ausgefeilte Racheaktion ist bereits angelaufen. Bei einer Polizeiaktion, angeordnet vom deutschen Innenminister Klein, die eigentlich Rems Vater treffen sollte, stirbt durch einen dummen Zufall Rems Mutter. Rem sinnt auf blutige Rache, die die ganze deutsche Politikerriege treffen soll.
Dazu heuert er die unterschiedlichsten Handlanger an, die ihn mit Bakterienstämmen und diversem technischen Material versorgen, die für Rems teuflischen Plan gebraucht werden. Auch der deutsche Umweltminister Beck spielt eine tragende Rolle in Rems Plan, denn er ist es, der künftiger Bundeskanzler werden soll, wenn der bisherige Rems Anschlag zum Opfer gefallen ist. Johanna Vahtera kommt früh auf Rems Spur, doch traut sie zeitweise ihrer eigenen Intuition nicht und lässt sich von einigen Internetbekanntschaften ablenken, die nicht immer das sind, was sie zu sein vorgeben …
_Wie Bauern auf einem Schachbrett_
Ilkka Remes‘ Plot in „Blutglocke“ ist vielschichtig und spaltet sich in zahlreiche Handlungsfäden auf, in denen wir die beteiligten Personen (mehr oder weniger) kennen lernen. Rem Gramows Vorhaben ist dermaßen ausgefeilt, dass er unzählige Helfer benötigt, um seine Pläne in die Tat umzusetzen. Lange braucht es, damit wir überhaupt erahnen können, was Rem beabsichtigt und welche Rolle den einzelnen Figuren dabei zufällt. Kaum bilden wir uns ein, nun alle wichtigen Personen zu kennen, bringt Remes weitere (Schach-)figuren auf sein literarisches Spielbrett, die oftmals unwissend Teil von Rem Gramows Plan werden, was sie meistens mit dem Leben bezahlen müssen. Denn eins ist klar: Gramow geht rücksichtslos über Leichen und tut alles, um seine Eltern zu rächen, die seiner Meinung nach dem deutschen Innenminister zum Opfer gefallen sind.
Aufgrund der zahlreichen Figuren lässt die Charakterzeichnung leider an manchen Stellen zu wünschen übrig. Nur wenige Charaktere sind es, die Profil erhalten und uns im Gedächtnis bleiben werden. Zum einen wäre das auf jeden Fall Johanna Vahtera, die von Anfang an daran glaubt, dass Rem Gramow hinter der Ermordung des deutschen Innenministers steckt. Doch sie ist unsicher, weil sie keine Beweise findet, die ihr Gefühl untermauern könnten. Und wenn sie ehrlich ist, so spricht objektiv gesehen vieles gegen Gramow. Auch privat ist Vahtera nicht gerade vom Glück verfolgt; mit Männern hat sie einfach kein Glück und auch ihre Internetbekanntschaften sind nicht mehr als ein verzweifelter Hoffnungsschimmer für ihre einsamen Abende und Wochenenden. Unverhofft taucht jedoch ihr Exfreund Craig wieder in ihrem Leben auf, der inzwischen allerdings mit einer neuen Frau zusammenlebt. Doch scheint Johanna vielleicht trotzdem eine zweite Chance zu bekommen.
Eine weitere Hauptfigur ist sicherlich Rem Gramow selbst, der erst kaltblütig den Innenminister ermordet hat und nun weitere Morde plant, die wohl noch schwerer wiegen dürften, denn eines seiner Opfer soll der Bundeskanzler werden. Gramow ist auf der einen Seite eine tragische Figur, hat er doch gerade beide Elternteile kurz hintereinander verloren, auf der anderen Seite kann er aufgrund seiner Kaltblütigkeit trotzdem keine Sympathiepunkte sammeln, obwohl wir einen größeren Teil der Handlung an seiner Seite verbringen.
Anders ist es bei Nick Boyd, der sich einen Namen als Werbefilmregisseur gemacht hat und nun in die Geschichte hineinstolpert, weil er für Gramows Propaganda benötigt wird. Zunächst läuft Boyd unwissend in sein Unglück, doch bald beginnt er zu ahnen, dass nicht nur sein Leben in Gefahr ist, sondern auch das seiner Frau und seiner Tochter. Verzweifelt versucht Boyd im weiteren Verlauf der Geschichte, sich und seine Familie zu retten, doch leider wurde er in ein kleines Dörfchen in Russland verschleppt, wo niemand seine Sprache spricht. Die Zeichen stehen also schlecht für ihn.
Dies sind zwar noch lange nicht alle wichtigen Figuren, aber doch alle, die uns Ilkka Remes etwas näher vorstellt. Die meisten anderen auftauchenden Personen werden zu Randfiguren degradiert, auch wenn sie in Gramows teuflischem Plan eine entscheidende Rolle spielen. Viele Menschen müssen dabei ihr Leben lassen, doch da Remes kaum Zeit darauf verwendet, seine Figuren alle entsprechend vorzustellen, war es mir irgendwann auch ziemlich gleichgültig, wenn mal wieder eine seiner Schachfiguren zum Bauernopfer wurde. Trauer habe ich keine empfunden, da man im Verlauf der Lektüre höchstens zu Johanna Vahtera und Nick Boyd eine „Beziehung“ aufbauen kann.
_Ausgefranst_
Die vielen einzelnen Handlungsstränge führen zwar dazu, dass Ilkka Remes‘ Erzählung ein hohes Tempo aufnimmt, doch leider ist es schwierig, sich in dem Gewühl verschiedener Schauplätze und in der Masse von Menschen zurechtzufinden. Ich hatte teilweise tatsächlich Probleme, Namen und Biografien richtig zuzuordnen, und musste mich auch dabei ertappen, dass ich überrascht war, eine Person in Deutschland anzutreffen, obwohl ich sie in der Geschichte eigentlich in Russland vermutet hatte. Denn Ilkka Remes begnügt sich nicht damit, seinen Thriller klassisch in seiner Heimat Finnland spielen zu lassen. Von dort „flüchtet“ bald sogar Johanna Vahtera, um den Ereignissen näherzukommen. Die Hauptgeschichte spielt in Deutschland, und zwar genauer in Berlin und Umgebung, doch die Hintergründe sind fast sämtlich in Russland zu suchen. So reisen wir gemeinsam mit den handelnden Personen kreuz und quer durch die Gegend, sodass es fast schon verständlich ist, dass man zwischendurch den Überblick verlieren kann.
Ilkka Remes‘ vorliegender Thriller ist leider schwer durchschaubar; es ist nicht nur schwierig, alle Figuren richtig zuzuordnen, sondern auch deren Handlungen und Funktion im Gesamtgeschehen. Erst spät erhalten wir so viele Erklärungen, dass wir in etwa abschätzen können, was Rem Gramow ausgeheckt hat. Doch sein Racheplan ist so verworren, dass er nicht all sein Gräuel entfachen konnte, weil die Lektüre den Leser zu sehr verwirrt, um wirklich schockiert sein zu können. Ein roter Faden hätte der Handlung sicher sehr gut getan und vielleicht hätte auch die Hälfte der Handlungsfäden ausgereicht. Manchmal habe ich mich gefühlt wie in einem Labyrinth, aus dem nur schwer herauszufinden ist und bei dem auch nicht klar ist, was einen am Ausgang erwarten wird. Zudem kamen mir einige der Handlungsstränge völlig überflüssig vor, da sie weder für Gramows Rache notwendig erschienen noch die Geschichte vorangebracht haben.
Kiefer Sutherland und Jon Cassar hätten aus der verworrenen Story vielleicht eine spannende Staffel [„24“ 3118 gestalten können, aber diese wäre auch getragen gewesen von einem überragenden Kiefer Sutherland, für den alleine man immer wieder einschalten würde. Doch Remes hat leider keine Helden wie Cassar, die auch einen völlig überkonstruierten Plot retten und über hanebüchene Wendungen hinwegtrösten können.
_Klingelingeling_
Am Ende war ich doch etwas enttäuscht von Ilkka Remes‘ neuestem Thriller, der meines Erachtens inhaltlich völlig überfrachtet war, sodass man schnell im Personen- und Handlungsgewirr unterzugehen droht. Zu viele Figuren treten auf den Plan, als dass Remes Zeit gehabt hätte, sie alle entsprechend zu würdigen, aber auch viele Szenen kamen mir so überflüssig vor, dass ich mir wünschte, Remes hätte sich mehr auf das Wesentliche konzentriert. „Blutglocke“ ist sicherlich kein absoluter Fehlgriff gewesen, die Geschichte hatte durchaus ihren Reiz und entwickelte eine gewisse Spannung, aber Remes hat viel Potenzial verspielt, das dieser Virenthriller mit politischem Hintergrund in sich hat. Ich hatte den Eindruck, dass Remes zu viel wollte und jede seiner (Schnaps-)Ideen Einzug in das Buch gefunden hat. Der Killer hätte sicherlich nicht einen Privatjet mit Sauna fliegen müssen, Vahtera hätte auch nicht unbedingt den Clarice-Starling-Touch benötigt und auch das ziemlich überzogene Ende war vielleicht doch etwas zu viel des Guten.
Insgesamt ist „Blutglocke“ eher etwas für Leser, die sich gerne durch einen Wust an Handlungssträngen kämpfen und bereit sind, sich mindestens zwei Dutzend fremdländische Namen zu merken, auch wenn die Personen keine wirklich tragende Rolle spielen. So bleibt zu hoffen, dass Ilkka Remes mit diesem Buch seine Durststrecke überwunden hat und mit dem nächsten Thriller wieder mehr zu überzeugen weiß.
|Siehe ergänzend dazu auch:|
[„Ewige Nacht“ 2039
[„Das Hiroshima-Tor“ 2619
http://www.ilkka-remes.de/
http://www.dtv.de