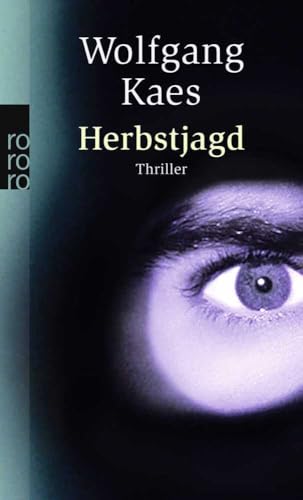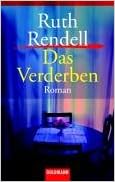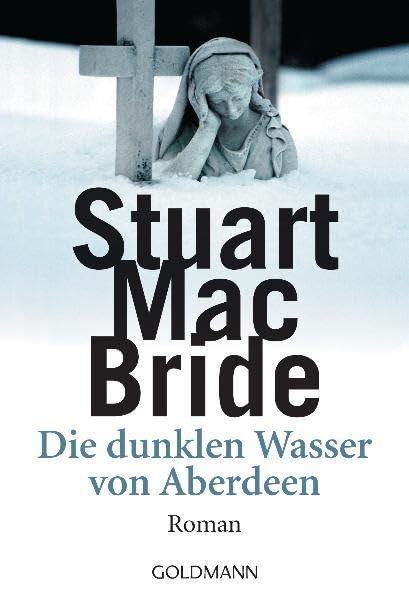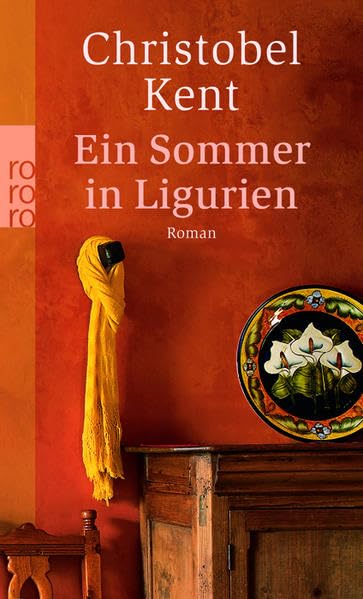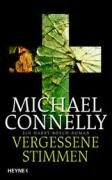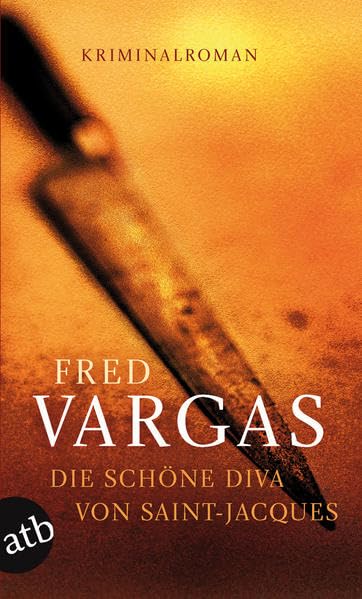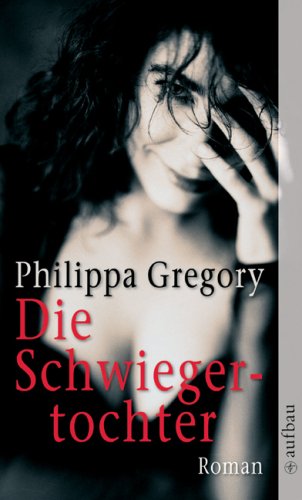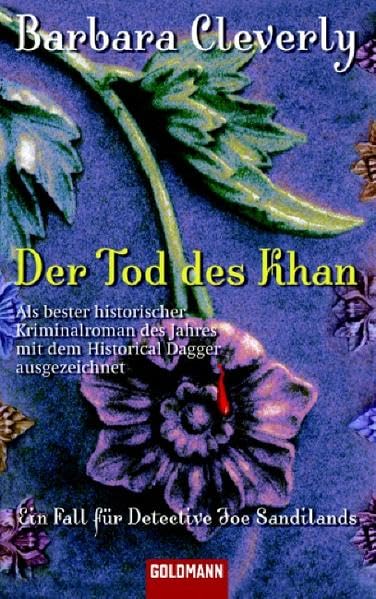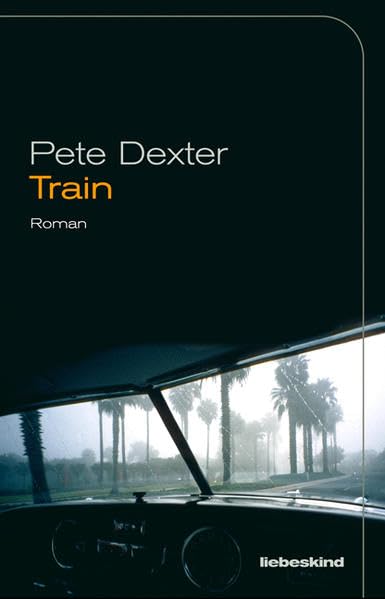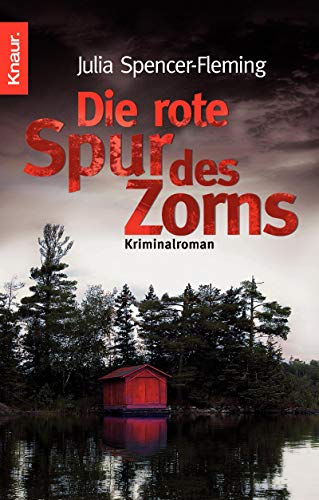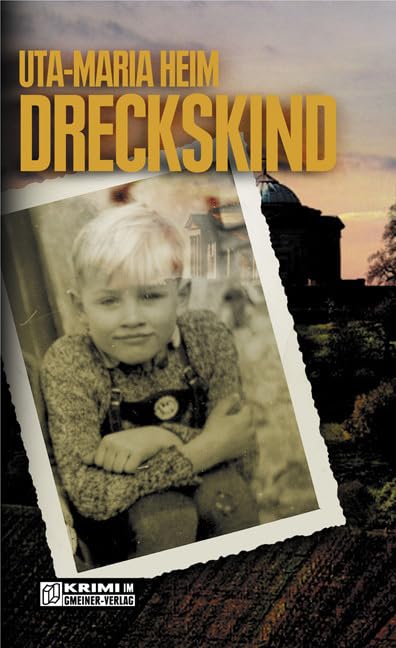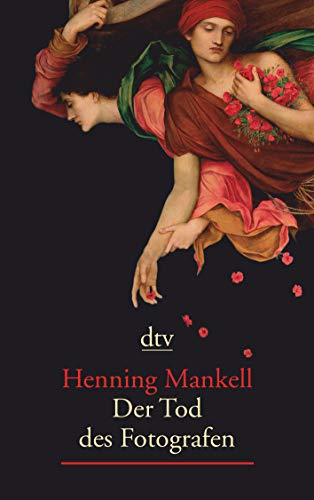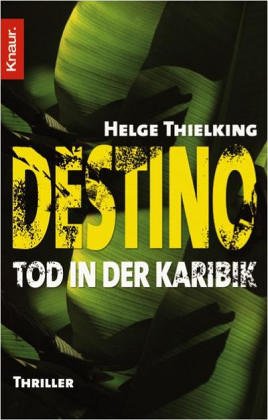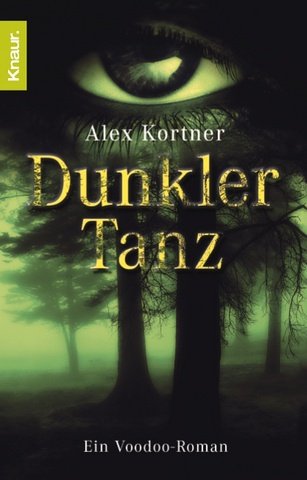Martina Hahne, alleinerziehende Mutter von zwei Teenagern, hat kein Glück mit Männern. Nach der Geburt ihrer Tochter verlässt sie ihr Mann, auch alle weiteren Beziehungsversuche enden in einer Enttäuschung. Tochter Jasmin will um jeden Preis Model werden, der ältere Boris rebelliert, die harte Arbeit im Supermarkt reibt die gestresste Mutter auf. Da gibt ihr eine Kollegin den Tipp, sich per Internet eine Bekanntschaft zu suchen. Auf diesem Weg lernt sie Mario kennen, einen reichen Kölner Unternehmer, der sie mit Komplimenten und Aufmerksamkeiten überschüttet. Die ersten Treffen verlaufen zaghaft, erst nach und nach werden sie intim miteinander. Dabei verlangt Mario von Martina so genannte „Liebesbeweise“, die immer demütigender für sie werden. Martinas Liebe verwandelt sich in Angst. Als es ihr zu viel wird, trennt sie sich per E-Mail von ihrem einstigen Traummann. Mario verkraftet das Aus nicht und stellt ihr mit Anrufen und drohenden E-Mails nach.
An einem regnerischen Septembertag verschwindet Martinas Tochter Jasmin. Die Fünfzehnjährige kehrt nicht von der Schule heim. Gegen Mitternacht verständigt Martina die Polizei. Zur gleichen Zeit wird auch die vierzehnjährige Anna vermisst gemeldet. Anna stammt aus gutem Haus und kennt Jasmin nicht, doch bei beiden lässt der Täter den Eltern ein Foto der Mädchen zukommen, aufgenommen nach ihrer Entführung. Anhand eines der Bilder gelingt es der Polizei, die beiden Mädchen in einem Naturschutzgebiet zu finden – aber nur eines von ihnen lebt noch.
Der rauhe Bonner Hauptkommissar Jo Morian und seine junge, burschikose Kollegin Antonia Dix übernehmen den Fall. Obwohl sie in alle Richtungen ermitteln, steht der mysteriöse „Mario“ auf ihrer Verdächtigenliste ganz oben. Doch die Nachforschungen erweisen sich als problematisch. Zeugenaussagen ergeben zwei völlig unterschiedliche Phantombilder von „Mario“ und dem Entführer, wichtige Spuren wurden verwischt und einige Polizeimitarbeiter halten die Stalking-Theorie für unglaubwürdig. Auch persönlicher Druck lastet auf dem Duo – Antonia Dix wird wegen ihrer Unerfahrenheit längst nicht von allen Kollegen respektiert. Morian dagegen fühlt sich gegen seinen Willen zu Annas Lehrerin Dagmar, selbst ein Stalking-Opfer von „Mario“, hingezogen. Für die Ermittler beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn niemand weiß, wann der Täter wieder zuschlägt …
Nach „Todfreunde“ und „Die Kette“ bekommen die Leser nun einen dritten Fall von Kommissar Morian präsentiert, der sich nach Kindesmissbrauch und Terror mit dem Thema Stalking befasst. Auch hier beweist der Autor wieder einmal sein Gespür für brisante Themen und liefert einen äußerst spannenden und gelungenen Thriller ab.
|Charakterstarkes Ermittler-Duo|
Serienermittler gibt es in der Krimi- und Thrillerwelt mittlerweile wie Sand am Meer. Schwer genug für einen Autoren, einen Ermittler zu erschaffen, der sich von seinen zahlreichen Kollegen, heißen sie nun Wallander, Cross, Wexford oder Pitt, abhebt und dem Leser einprägt. Mit der Figur des Kommissar Josef Morian ist ihm so ein Charakter gelungen. Dabei ist Morian, wie ihn fast alle Kollegen nennen, eigentlich ein Durchschnittstyp und gewiss nicht fehlerlos, was ihn aber gerade so sympathisch macht. Der ehemalige Amateurboxer hat mittlerweile an Gewicht zugelegt, lebt nach seiner Scheidung alleine, hat zu wenig Zeit für seine beiden Kinder, schweigt mehr als dass er redet und ist bekannt für das Vertrauen, das er gegenüber Zeugen ausstrahlt. Morian ist kein makelloser Superman, der jedes Verbrechen im Handumdrehen löst, doch er ist ein zuverlässiger Kollege, der mit viel Herzblut an seinen Fällen arbeitet und in seiner aufreibenden Arbeit seine Berufung gefunden hat. Kollegin Antonia Dix bietet den perfekten Gegenpol. Erfreulicherweise bilden die beiden kein Liebespaar, sondern stehen vielmehr in einer Art leicht distanziertem Vater-Tochter-Verhältnis zueinander. Antonia ist knapp dreißig, verbirgt ihre rassige Schönheit hinter einem raspelkurzen Haarschnitt und burschikosen Auftreten inklusive stämmiger Kickboxerin-Figur und Militär-Jacke. Morian schätzt die scharfsinnige und ehrgeizige Ermittlerin und verspürt des Öfteren einen Beschützerinstinkt in ihrer Nähe. Ganz anders sieht es dagegen Oberstaatsanwalt Arentz, der, wie auch einige der Polizeimitarbeiter, der Jugend und der Unerfahrenheit von Antonia skeptisch gegenübersteht. Vor allem Arentz nutzt jede Gelegenheit, um die junge Frau zu diskriminieren und ihr offen zu widersprechen. Bei den Ermittlungen lastet nicht nur der Druck der Öffentlichkeit auf Antonia, sondern der Fall weitet sich für sie zu einer Bewährungsprobe aus. Gerade unter diesem Druck unterlaufen der sonst so gefassten Kriminalbeamtin kleine Schnitzer, die sie noch verletztlicher und menschlicher wirken lassen. Auch das Privatleben der beiden wird gestreift, angenehmerweise aber nie zum Hauptthema erhoben. Antonia ist einsamer Single, Morian wehrt sich gegen seine Gefühle für die Zeugin Dagmar Losem; beide haben mit ihren privaten Empfindungen zu kämpfen, doch im Fokus steht zu jeder Zeit die Jagd nach dem psychopathischen Stalker.
Unterstützung erhält Morian dabei wie schon in den vorherigen Bänden von seinem Freund Max Maifeld, einem ehemaligen Journalisten, der nach den Rachedrohungen eines Schwerkriminellen in Köln-Mülheim untergetaucht ist und nun als Detektiv schwierige Fälle übernimmt. Mit dabei ist der durchtrainierte Schwarzamerikaner Hurl, Max Maifelds Partner, der nicht viele Worte verliert, dafür aber mit bestechender Verlässlichkeit selbst gefährlichste Einsätze übernimmt. Morian, Antonia, Max und Hurl bilden ein buntes Quartett, das sich trotz oder gerade wegen seiner Gegensätzlichkeit als ein nahezu unschlagbares Team präsentiert. Hin und wieder gibt es trotz aller Aufregung und der Ernsthaftigkeit des Themas bei Max und Hurl sogar amüsante Erlebnisse – denn obwohl sie die perfekte Zusammenarbeit liefern, ist vor allem Max zeitweise genervt von den unterschiedlichen Lebensvorstellungen innerhalb der Zwangs-WG.
|Spannung und Dramatik bis zum Schluss|
Über 500 Seiten umfasst der Schmöker, doch beachtlicherweise wird der Spannungsfaktor von der ersten bis zur letzten Seite konstant hochgehalten. Viele Fragen warten auf die Beantwortung: Werden sie dem Internet-Stalker das Handwerk legen? Wird es bis dahin noch weitere Opfer geben? Wer ist der Informant, der die Presse immer wieder mit vertraulichen Polizei-Interna über den Fall versorgt? Glaubwürdig werden Höhen und Tiefen der Ermittlungsarbeit aufgezeigt. Morian und seine Helfer verzeichnen wichtige Erfolge, die sie dem Täter näher bringen, doch es gibt auch zahlreiche Rückschläge – entweder, weil Fehler passieren oder weil „Mario“ ihnen intellektuell gewachsen ist. Positiv ist zudem, dass der Autor sich nicht scheut, Charaktere sterben zu lassen oder lieb gewonnenen Figuren Enttäuschungen geschehen zu lassen. Bereits vor den letzten Seiten ahnt man, dass den Leser hier kein geschöntes Hollywood-Ende erwartet, sondern dass Wolfgang Kaes es durchaus wagt, auch hier konsequent zu sein und die harte Realität einfließen zu lassen, in der nicht alle Konflikte eine ideale Lösung erfahren. Bis zum Schluss heißt es bangen um die Protagonisten und die Nebencharaktere – und hoffen, aber nicht wissen, dass die Gerechtigkeit siegen wird.
Den ganzen Roman über ist offensichtlich, dass der Autor lange Jahre als Polizei- und Gerichtsreporter tätig war. Detailgenau und immer verständlich bringt er Einblicke in die Ermittlungsarbeit, sodass man spürt, dass hier ein Experte über Dinge schreibt, die er selber erlebt hat, nicht bloß über angelesenes Bücherwissen. Gleiches gilt für das ausgeprägte Lokalkolorit. Bewohner des Köln-Bonner Raums werden nicht nur zentralen Örtlichkeiten, die auch flüchtige Besucher der Gegenden kennen, begegnen, sondern auch unscheinbaren Straßen und Ecken, die zeigen, dass hier ein Einheimischer seine Kenntnisse spielen lässt.
|Nur kleine Mankos|
Schwächen besitzt dieser Roman nur wenige. Eine davon liegt in der Fülle von Handlungssträngen, die das Werk äußerst komplex machen. Die Schauplätze wechseln häufig; am meisten steht natürlich Morian im Zentrum, aber es wird auch zu Antonia, zu Max und Hurl, zu Stalking-Opfer und Zeugin Dagmar Losem sowie auch zum Täter selbst übergeblendet. Bei manchen Absätzen muss man sich erst ein paar Sätze lang einlesen, ehe man weiß, in welchem Handlungsstrang man sich gerade befindet. Die vielen Schicksale, darunter natürlich auch die der Familien der Opfer, bilden ein miteinander verbundenes Netzwerk. Zum Schluss laufen tatsächlich alle Fände zusammen – doch bis dahin ist es zeitweise mühsam, den Überblick zu behalten, wer in welcher Form mit dem anderen verbunden ist. Auch der Zufall wird hier manches Mal zu oft bemüht. Ein paar der Verbindungen sind nicht naturgegeben, sondern entstehen durch unvorhersehbare Ereignisse, die dafür sorgen, dass sich die Wege mancher Personen kreuzen. Das macht es Morian und seinem Team mehrmals zu einfach, eine Spur zu verfolgen. Während in der ersten Hälfte viele Untersuchungen im Sande verlaufen und die Jagd nach „Mario“ phasenweise fast aussichtslos erscheint, fallen vor allem im letzten Drittel den Ermittlern einige Erkenntnisse durch Zufälle oder Dummheit der Täter in die Hände.
Nicht abschrecken lassen darf man sich vom Stil, der einem auf der ersten Seite entgegenspringt: In der hektischen Erzählweise der erlebten Rede, sogar bis hin zu Anklängen an den Bewusstseinsstrom, werden hier stakkatoartige Sätze verwendet, die oft nur aus einem Wort und aus inhaltlichen Gedankensprüngen bestehen. Allerdings zeigt sich bald, dass dieser Stil nur bei „Marios“ Perspektive zum Einsatz kommt und selbst dort nie mehr so penetrant wie auf der ersten Seite. Zwar durchzieht gründsätzlich ein nüchterner Stil mit kurzen Sätzen den Roman, der sich aber flüssig lesen lässt.
_Unterm Strich_ bleibt ein hochspannender Thriller über das brisante Thema „Stalking“, das durch ein sympathisch-interessantes Ermittlerduo, überraschende Wendungen und Dramatik bis zum ungewissen Ende besticht.
_Der Autor_ Wolfgang Kaes, geboren 1958 in der Eifel, arbeitete nach seinem Studium der Politikwissenschaft, Kulturanthropologie und Pädagogik viele Jahre lang als Journalist. Er schrieb unter anderem als Polizei- und Gerichtsreporter für den |Kölner Stadt-Anzeiger|, für den |Stern| und als Lokalchef der |Rhein-Zeitung| in Bonn. 2004 erschien sein erster Roman „Todfreunde“, 2005 der Nachfolger „Die Kette“, beide mit dem Ermittler Kommissar Morian. Mehr über ihn gibt es auf seiner Homepage http://www.wolfgang-kaes.de.
http://www.rowohlt.de